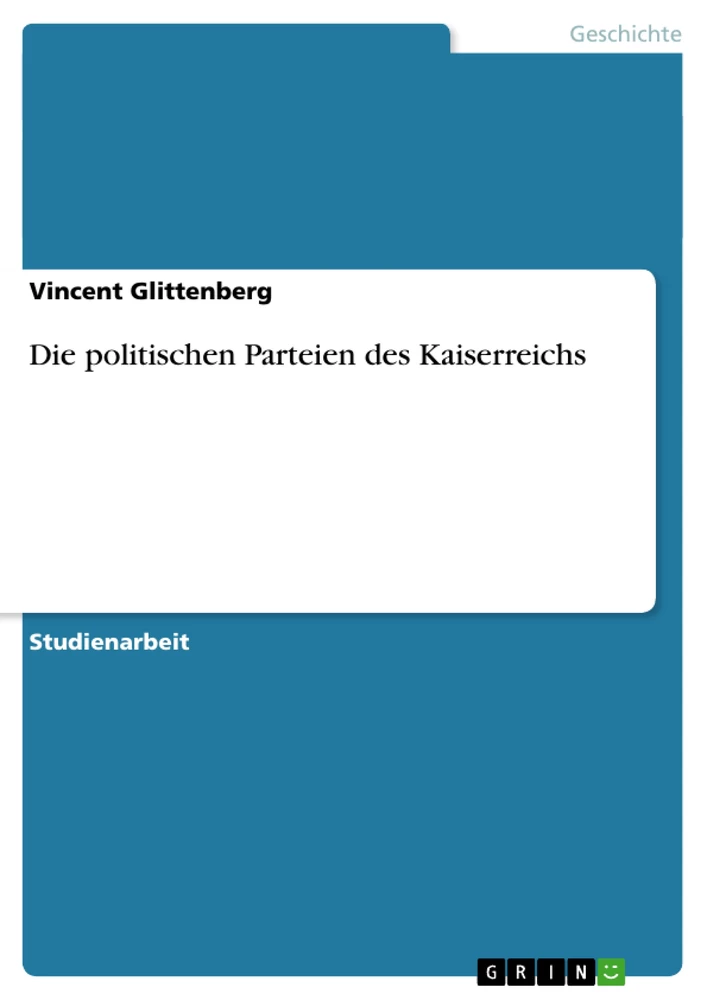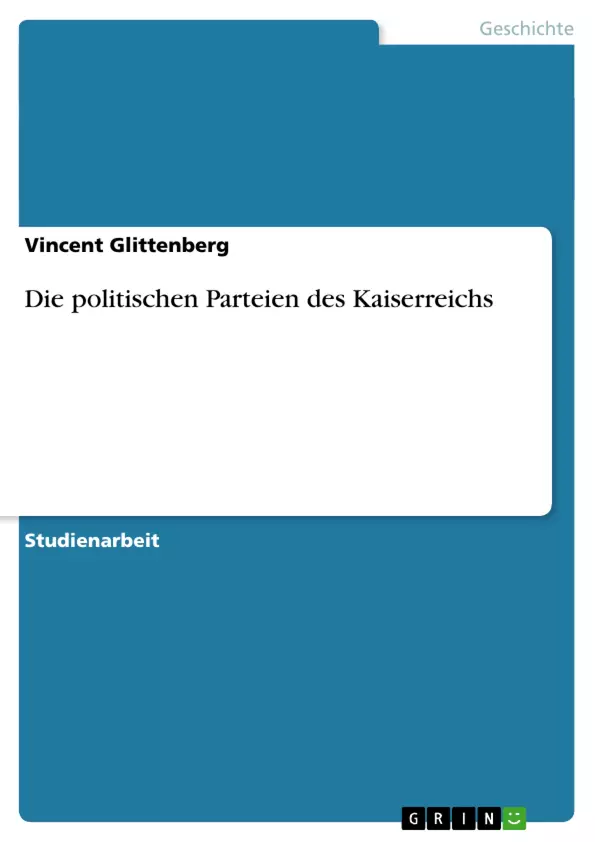In dieser Arbeit sollen die politischen Parteien im deutschen Kaiserreich nach der
Reichsgründung 1871beschrieben und untersucht werden, schwerpunktmäßig während
Bismarcks Kanzlerschaft. Um mich diesem komplexen Thema nähern zu können, werde
ich versuchen zu analysieren, ob die Parteien im Kaiserreich nur im Vorhof der Macht
existierten, oder ob sie sich zu tatsächlichen und einflussreichen politischen
Mitgestaltern entwickeln konnten.
Inhaltsverzeichnis
- Inhalt und Gliederung
- Einleitung
- Historischer Kontext
- Rolle und Organisation der Parteien
- Generelle Defizite des Parteiensystems
- Forschungsdebatte
- Fazit und persönliche Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis (Darstellungen, Lexika und Internetseiten)
- Anmerkungen (Endnoten)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den politischen Parteien im deutschen Kaiserreich nach der Reichsgründung 1871, insbesondere während Bismarcks Kanzlerschaft. Ziel ist es, die Rolle der Parteien im Kaiserreich zu analysieren und zu untersuchen, ob sie nur im Vorhof der Macht existierten oder sich zu einflussreichen politischen Mitgestaltern entwickelten.
- Die Entstehung und Entwicklung der politischen Parteien im Kaiserreich
- Die Rolle der Parteien im politischen System des Kaiserreichs
- Die Organisation und Struktur der Parteien
- Die wichtigsten politischen Strömungen und Parteien
- Die Beziehung zwischen den Parteien und der Regierung
Zusammenfassung der Kapitel
-
Die Einleitung führt in das Thema der politischen Parteien im deutschen Kaiserreich ein und stellt die Forschungsfrage nach der Rolle der Parteien im politischen System des Kaiserreichs.
-
Der Abschnitt „Historischer Kontext“ beleuchtet die Vorgeschichte der politischen Bewegungen vor der Reichsgründung 1871. Er beschreibt die Entstehung von politischen Gesinnungsgruppen im Vormärz und die Bedeutung der sozialistischen Auslandsorganisationen der Handwerker und Arbeiter.
-
Der Abschnitt „Rolle und Organisation der Parteien“ analysiert die Rolle der Parteien im Kaiserreich und ihre Organisation. Er stellt fest, dass die Parteien in der Reichsverfassung keine Erwähnung fanden und auf dem Vereinsrecht beruhten. Die Arbeit beschreibt die wichtigsten politischen Strömungen und Parteien, wie den Liberalismus, Konservatismus, politischen Katholizismus und Sozialismus. Sie beleuchtet die Organisation der Parteien als Honorationsparteien und die Besonderheiten der Zentrumspartei und der Sozialdemokratischen Partei.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die politischen Parteien im deutschen Kaiserreich, die Reichsgründung 1871, Bismarcks Kanzlerschaft, die Rolle der Parteien im politischen System, die Organisation und Struktur der Parteien, die wichtigsten politischen Strömungen und Parteien, der Liberalismus, Konservatismus, politische Katholizismus, Sozialismus, die Zentrumspartei, die Sozialdemokratische Partei, die Honorationsparteien, die Beziehung zwischen den Parteien und der Regierung.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Status hatten politische Parteien in der Reichsverfassung von 1871?
Die Parteien wurden in der Reichsverfassung gar nicht erwähnt. Sie basierten rein auf dem Vereinsrecht und galten offiziell nicht als Teil der Staatsorgane.
Was versteht man unter „Honoratiorenparteien“?
Dies waren Parteien, die primär von lokal angesehenen Persönlichkeiten (Honoratioren) getragen wurden und meist keine festen Mitgliederstrukturen oder moderne Organisationen hatten.
Welche Rolle spielten die Parteien unter Kanzler Bismarck?
Bismarck sah die Parteien oft als Störfaktor und versuchte, sie gegeneinander auszuspielen. Dennoch mussten sie Gesetze im Reichstag verabschieden, was ihnen eine gewisse Macht gab.
Welche großen politischen Strömungen gab es im Kaiserreich?
Die wichtigsten Strömungen waren der Liberalismus, der Konservatismus, der politische Katholizismus (Zentrumspartei) und der Sozialismus (SPD).
Warum waren die SPD und das Zentrum Ausnahmen im Parteiensystem?
Im Gegensatz zu den Honoratiorenparteien entwickelten sie schon früh moderne Massenorganisationen mit festen Strukturen, Programmen und einer loyalen Anhängerschaft.
- Quote paper
- Vincent Glittenberg (Author), 2009, Die politischen Parteien des Kaiserreichs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130911