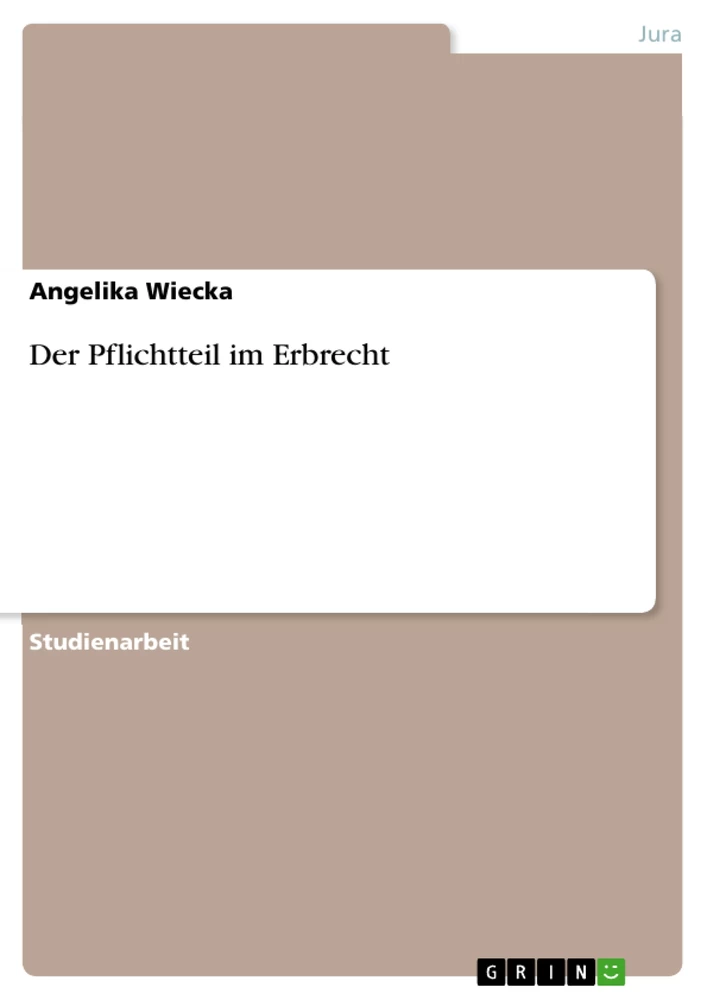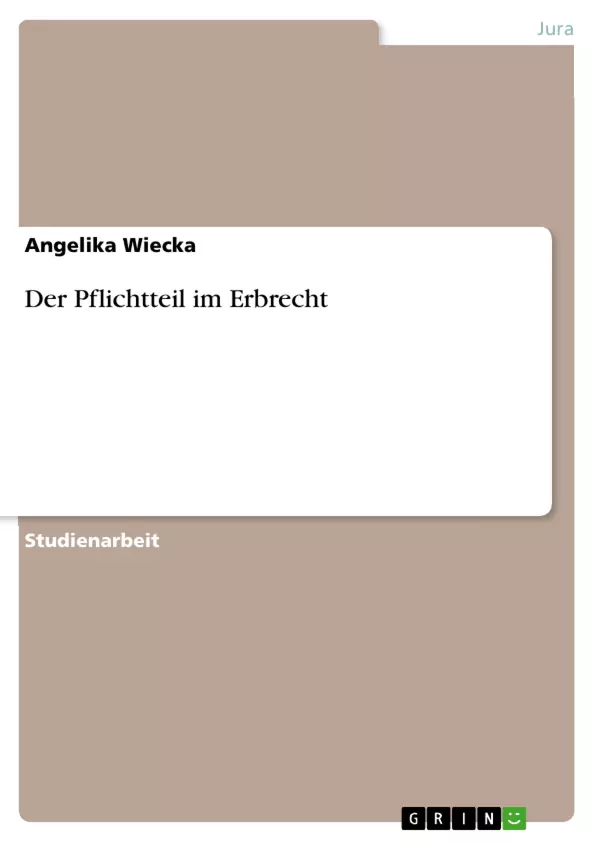In dieser Seminararbeit wird erläutert, dass durch den bloßen Ausschluss von Todes wegen nicht gleich das gesamte Erbe ausgeschlossen wird. Im ersten Teil der Hausarbeit werden zunächst die einzelnen Grundbegriffe erläutert. Daraufhin wird auf die gesetzliche Erbfolge eingegangen und zum Schluss auf den Pflichtrechtsteil.
Durch die Testierfreiheit des Erbrechts, ist es dem Erblasser selbst überlassen, sein Vermögen, abweichend von der gesetzlichen Erbfolge, zu verteilen. Hierbei kann er seine nächsten Angehörigen auch ausschließen, da er nicht dazu verpflichtet ist, ihnen etwas zuzuwenden. Aufgrund dessen ist der Pflichtteil dazu da, den nächsten Angehörigen einen Mindestwertanteil am Erben zu sichern. Man spricht auch von einer Kompromisslösung zwischen dem gesetzlichen Familienerbrecht einerseits und der Testierfreiheit andererseits.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Vorgehensweise
- Zielsetzung und Gang der Arbeit
- Grundbegriffe
- Erbfall/Erblasser
- Erbschaft/Nachlass
- Erbe/Erbfähigkeit/Erbrecht
- Gesetzliche Erbfolge
- Einführung
- Wann tritt die gesetzliche Erbfolge ein?
- Welche Erben kommen in Frage?
- Begriff der Abkömmlinge
- Der Pflichtteil im Erbrecht
- Einführung
- Grundgedanke des Erbrechts
- Voraussetzungen für den Anspruch
- Pflichtteilsberechtigte Personen
- Verlust des gesetzlichen Erbrechts
- Entziehung des Pflichtteils
- Pflichtteilsunwürdigung
- Pflichtteilsbeschränkung in guter Absicht
- Höhe des Pflichtteils
- Entstehung und Wegfall des Pflichtteils
- Verzicht auf den Pflichtteil
- Ausschluss von der Erbfolge durch Verfügung von Todes wegen
- Völlige Enterbung
- Teilweise Enterbung
- Besteuerung des geltend gemachten Pflichtteils
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Pflichtteil im Erbrecht. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen und die Anwendung des Pflichtteils im deutschen Erbrecht. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die Bedeutung und Funktion des Pflichtteils im Kontext der Testierfreiheit des Erblassers zu geben. Darüber hinaus werden die Voraussetzungen für einen Pflichtteilsanspruch, die Höhe des Pflichtteils und die möglichen Auswirkungen von Enterbungen auf den Pflichtteilsanspruch beleuchtet.
- Der Pflichtteil als Schutzmechanismus für die nächsten Angehörigen des Erblassers
- Die Abwägung zwischen Testierfreiheit und Pflichtteilsrecht
- Die Voraussetzungen für den Pflichtteilsanspruch
- Die Höhe des Pflichtteils und dessen Berechnung
- Die Auswirkungen von Enterbungen auf den Pflichtteilsanspruch
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung, die Vorgehensweise und die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Im zweiten Kapitel werden die wichtigsten Grundbegriffe des Erbrechts definiert, darunter Erbfall, Erblasser, Erbschaft und Nachlass. Kapitel 3 widmet sich der gesetzlichen Erbfolge, die eintritt, wenn der Erblasser keine Verfügung von Todes wegen getroffen hat. Der Schwerpunkt von Kapitel 4 liegt auf dem Pflichtteil im Erbrecht. Hier werden die Voraussetzungen für einen Pflichtteilsanspruch, die Höhe des Pflichtteils und die Möglichkeiten des Verzichts oder Ausschlusses vom Pflichtteilsanspruch erläutert. Das Kapitel thematisiert zudem die Auswirkungen von Enterbungen auf den Pflichtteil. Ein Fazit rundet die Arbeit ab.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem deutschen Erbrecht, dem Pflichtteil, der Testierfreiheit, dem Erblasser, den Erben, den Pflichtteilsberechtigten, der Enterbung, dem gesetzlichen Erbteil, der Erbschaft, dem Nachlass und der Erbschaftsteuer.
- Citar trabajo
- Angelika Wiecka (Autor), 2022, Der Pflichtteil im Erbrecht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1309242