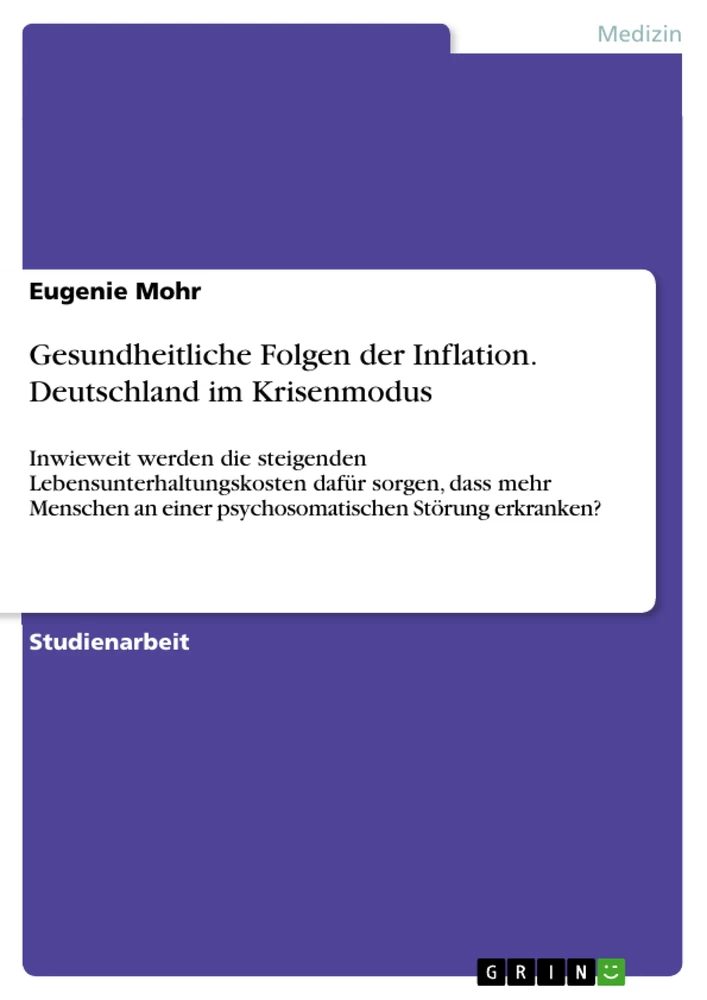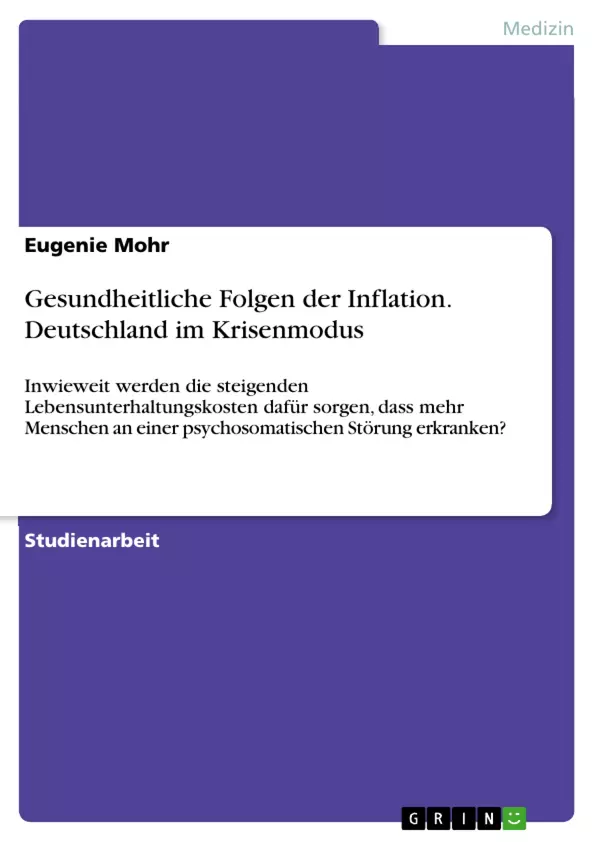Die gesamtheitliche Auseinandersetzung mit psychosomatischen Erkrankungen als Einheit von Körper, Geist und Seele gewinnt zunehmend an Bedeutung und rückt in den Fokus von wissenschaftlichen und medizinischen Disziplinen. Ziel der Arbeit ist es herauszuarbeiten, ob die Menschen aufgrund der Inflationsentwicklung anfälliger für psychosomatische Krankheiten werden. Unter Berücksichtigung der Forschungsfrage: "Inwieweit werden die steigenden Lebensunterhaltungskosten dafür sorgen, dass mehr Menschen an einer psychosomatischen Störung erkranken?" werden Hypothesen aus den drei Hauptbereichen aufgestellt.
Möglich ist eine Korrelation des allgemeinen Gemütszustandes und der finanziellen Situation, aber auch der Einfluss sozialer Kontakte, bzw. die Abwesenheit dieser. Relevant können unter anderem berufliche Auslastung und das Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Freizeit sein. Die Beantwortung der Forschungsfrage erfolgt mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse von Experteninterviews.
Inhaltsverzeichnis
- Abstrakt
- Abstract
- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Stress als Ursache psychosomatischer Störung
- 2.2 Inflationsentwicklung in Deutschland
- 2.3 Forschungsstand
- 2.4 Forschungsfragestellungen und Hypothesen
- 3 Methode
- 3.1 Messinstrument
- 3.2 Stichprobe
- 3.3 Untersuchungsdesign und -vorgehen
- 3.4 Gütekriterien
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Ergebnisse 1. Hypothese
- 4.2 Ergebnisse 2. Hypothese
- 4.3 Ergebnisse 3. Hypothese
- 5 Zusammenfassung und Diskussion
- 5.1 Interpretation der Ergebnisse
- 5.2 Implikation der Ergebnisse
- 5.3 Limitationen und zukünftige Forschung
- 6 Literaturverzeichnis
- 7 Gesprächsleitfaden
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit der Frage, ob die steigende Inflation zu einem Anstieg psychosomatischer Erkrankungen in Deutschland führt. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Inflation auf das psychische Wohlbefinden der Bevölkerung und untersucht, inwieweit finanzielle Belastungen, soziale Kontakte und berufliche Belastung zu psychosomatischen Störungen beitragen können.
- Die Auswirkungen der Inflation auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung
- Der Zusammenhang zwischen finanziellen Belastungen und psychosomatischen Erkrankungen
- Die Rolle sozialer Kontakte und beruflicher Belastung für die Entwicklung psychosomatischer Störungen
- Die Bedeutung von Stress als Ursache psychosomatischer Erkrankungen
- Qualitative Inhaltsanalyse von Experteninterviews als Methode der Datenerhebung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage einführt. Anschließend wird der theoretische Hintergrund beleuchtet, wobei verschiedene Aspekte von Stress, der Inflationsentwicklung in Deutschland, dem Forschungsstand sowie den Forschungsfragestellungen und Hypothesen diskutiert werden. Im methodischen Teil werden das Messinstrument, die Stichprobe, das Untersuchungsdesign und die Gütekriterien der Studie näher erläutert. Die Ergebnisse werden in den folgenden Kapiteln präsentiert und in Bezug auf die Hypothesen interpretiert. Schließlich werden die Ergebnisse der Studie zusammengefasst und diskutiert, wobei auch die Limitationen der Studie und die zukünftige Forschung berücksichtigt werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Zusammenhänge zwischen Inflation, psychosomatischen Erkrankungen, Stress, finanziellen Belastungen, sozialen Kontakten und beruflicher Belastung. Sie untersucht die psychischen Auswirkungen der Inflation auf die Bevölkerung in Deutschland und die Rolle qualitativer Forschungsmethoden bei der Erhebung und Analyse der Daten.
Häufig gestellte Fragen
Führt die aktuelle Inflation zu mehr psychosomatischen Erkrankungen?
Die Arbeit untersucht diese Korrelation und stellt die Hypothese auf, dass steigende Lebenshaltungskosten den Stresspegel massiv erhöhen, was die Anfälligkeit für psychosomatische Störungen steigert.
Wie hängen finanzielle Sorgen und psychische Gesundheit zusammen?
Finanzieller Druck führt oft zu Existenzängsten, Schlafstörungen und chronischem Stress, die sich in körperlichen Symptomen ohne rein organischen Befund äußern können.
Welche Rolle spielen soziale Kontakte in Krisenzeiten?
Die Abwesenheit oder der Rückzug aus sozialen Kontakten aufgrund von Geldmangel (soziale Isolation) ist ein wesentlicher Risikofaktor für die Verschlechterung des allgemeinen Gemütszustandes.
Was wurde in den Experteninterviews untersucht?
Mittels qualitativer Inhaltsanalyse wurde erhoben, inwieweit Therapeuten und Mediziner einen Anstieg von Patienten mit psychosomatischen Beschwerden im Kontext der Wirtschaftskrise beobachten.
Kann berufliche Belastung die Folgen der Inflation verschlimmern?
Ja, wenn das Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Freizeit (Work-Life-Balance) durch den Zwang zu Mehrarbeit oder die Sorge um den Arbeitsplatz aus dem Gleichgewicht gerät.
- Quote paper
- Eugenie Mohr (Author), 2022, Gesundheitliche Folgen der Inflation. Deutschland im Krisenmodus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1309277