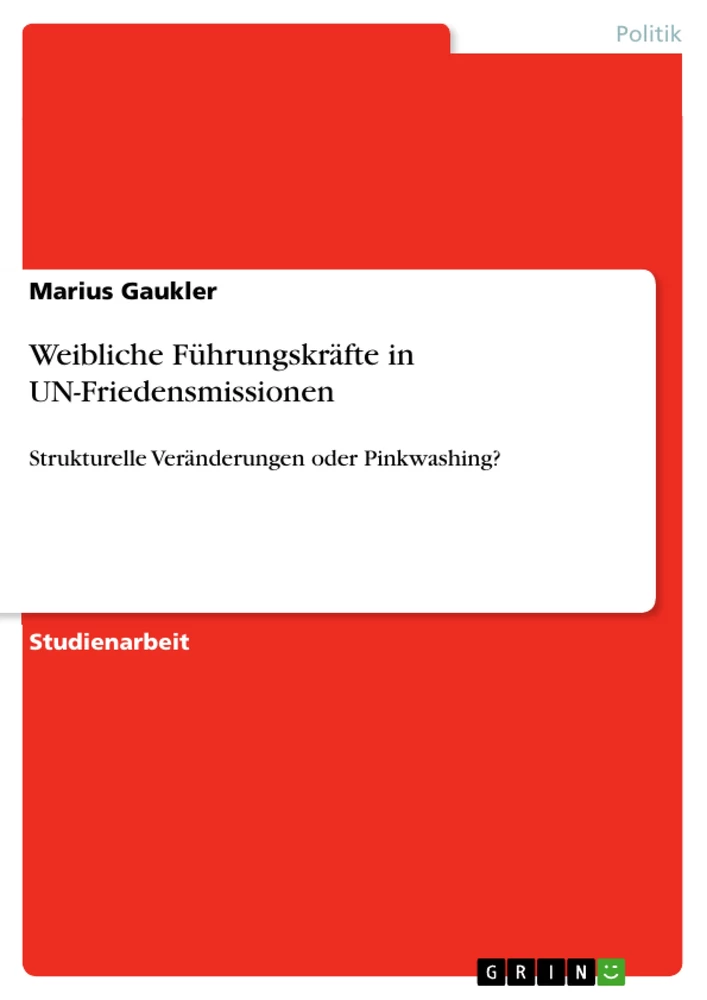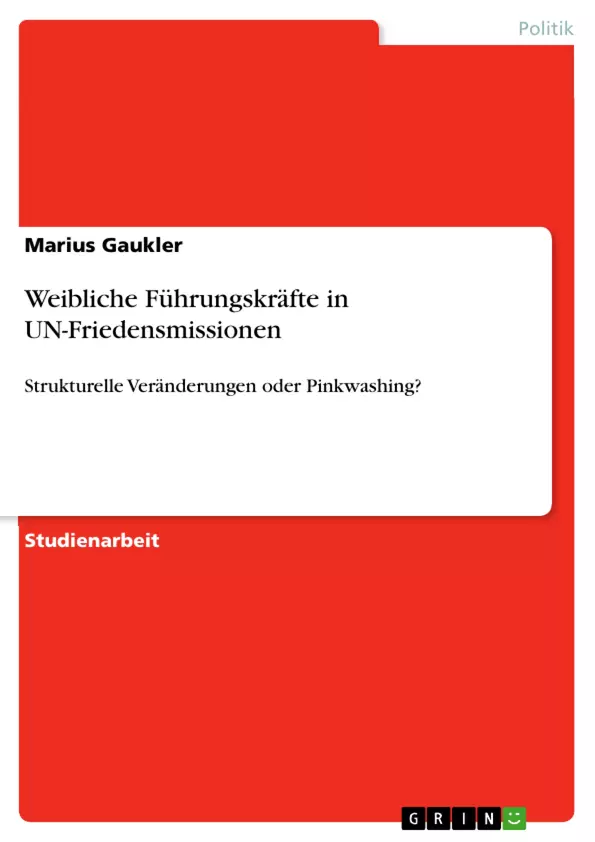Die Hausarbeit soll sich mit der Rolle von weiblichen Führungskräften in Friedensoperationen der Vereinten Nationen auseinandersetzen. Eine zentrale Persönlichkeit ist dabei Kristin Lund, als erste Kommandeurin einer Friedenstruppe der Vereinten Nationen. Sie hatte von 2014 – 2016 das Mandat in Zypern (UNFICYP) inne. Befürworter*innen des Gender-Mainstreaming versprechen sich positive Effekte auf die Arbeitsweise innerhalb der Vereinten Nationen und die konkrete Ausgestaltung der Friedensmissionen, beispielsweise im Zusammenhang von geschlechtsspezifischer Gewalt.
Der Hausarbeit liegt die zentrale Fragestellung zugrunde, inwiefern es sich bei der Besetzung weiblicher Führungskräfte in der Friedensmission auf Zypern um einen Meilenstein der UN-Genderpolitik oder um "Pinkwashing" handelt. Um die zentrale Fragestellung beantworten zu können, wird zunächst die Zielsetzung der UN-Genderpolitik basierend auf der UN-Resolution 1325, in Bezug auf die Auswahl weiblicher Führungskräfte bei Friedensmissionen skizziert. Zudem soll der Begriff des "Pinkwashing" definiert werden. Anschließend wird die Bedeutung der UN-Friedensmission in Zypern analysiert. Die Friedensmission wird zu diesem Zweck mit weiteren UN-Friedensmissionen verglichen. Kernaspekte des Vergleichs sind dabei die Einschätzung der Gefährlichkeit, inkludierende beziehungsweise exkludierende Strukturmerkmale der Missionen im Hinblick auf genderbasierte Lebenswirklichkeiten, eine mögliche Reduktion des Thema Gender auf Frauen sowie die Ausprägung von Geschlechterpolitik als sicherheitsrelevantes Thema. Die soziale Dimension der Beteiligungsmöglichkeiten innerhalb von Friedensmissionen soll hier beleuchtet werden.
Im Hauptteil der Arbeit soll auf Grundlage der Vergleichsergebnisse und den normativen Ansprüchen der Vereinten Nationen in Genderfragen beurteilt werden, ob die Besetzung der Friedensmission in Zypern durch die Kommandeur*in Kristin Lund eine Folge der veränderten Genderpolitik im Sinne UN-Resolution 1325 darstellt. Hierbei wird die These überprüft, dass es sich bei der Friedensmission in Zypern um eine vergleichsweise irrelevant Mission handelt die sich strukturell von dem Großteil der UN-Friedenmissionen unterscheidet. In einem weiteren Unterpunkt sollen Konsequenzen für die Art der Missionsausübung herausgearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung der UN-Gender-Politik
- Definition Pinkwashing
- Die UN-Friedensmission Zypern (UNFICYP) im Vergleich
- Weibliche Führungskräfte als Folge struktureller Veränderungen in der Sicherheitsarchitektur Vereinten Nationen
- Konsequenzen für Friedensmissionen mit weiblichen Führungskräften
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Rolle weiblicher Führungskräfte in UN-Friedensoperationen, insbesondere am Beispiel der ersten Kommandeurin einer UN-Friedenstruppe, Kristin Lund, die von 2014 bis 2016 die UN-Mission in Zypern (UNFICYP) leitete. Die Arbeit untersucht, ob die Besetzung dieser Position ein Meilenstein der UN-Genderpolitik oder "Pinkwashing" darstellt.
- Die Zielsetzung der UN-Gender-Politik, insbesondere die Rolle von weiblichen Führungskräften in Friedensmissionen.
- Die Definition und Bedeutung des Begriffs "Pinkwashing" im Kontext der UN-Genderpolitik.
- Die Analyse der UN-Friedensmission in Zypern im Vergleich zu anderen Missionen, unter Berücksichtigung von Genderaspekten und Sicherheitsrisiken.
- Die Beurteilung, ob die Ernennung von Kristin Lund als Kommandeurin in Zypern ein Zeichen für eine veränderte UN-Genderpolitik ist oder eher ein symbolischer Akt.
- Die Folgen der Besetzung weiblicher Führungspositionen in Friedensmissionen, insbesondere hinsichtlich der Berücksichtigung von geschlechtsspezifischer Gewalt.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den Kontext der UN-Gender-Politik, insbesondere im Hinblick auf die Rolle von weiblichen Führungskräften in Friedensmissionen. Sie stellt Kristin Lund als zentrale Figur der Arbeit vor und untersucht, ob ihre Positionierung als Kommandeurin in Zypern einen Fortschritt für die UN-Genderpolitik darstellt oder nur "Pinkwashing" ist.
- Kapitel 2: Zielsetzung der UN-Gender-Politik: Dieses Kapitel analysiert die Zielsetzung der UN-Gender-Politik, basierend auf der UN-Resolution 1325, und beleuchtet die Rolle weiblicher Führungskräfte in Friedensmissionen.
- Kapitel 3: Definition Pinkwashing: In diesem Kapitel wird der Begriff "Pinkwashing" definiert und seine Bedeutung im Kontext der UN-Gender-Politik erläutert.
- Kapitel 4: Die UN-Friedensmission Zypern (UNFICYP) im Vergleich: Dieses Kapitel untersucht die UN-Friedensmission in Zypern im Vergleich zu anderen UN-Missionen, unter Berücksichtigung von Genderaspekten und Sicherheitsrisiken. Es wird dabei auf die Einschätzung der Gefährlichkeit, die Strukturmerkmale der Missionen im Hinblick auf genderbasierte Lebenswirklichkeiten, die mögliche Reduktion des Themas Gender auf Frauen und die Ausprägung von Geschlechterpolitik als sicherheitsrelevantes Thema eingegangen.
- Kapitel 5: Weibliche Führungskräfte als Folge struktureller Veränderungen in der Sicherheitsarchitektur Vereinten Nationen: Dieses Kapitel analysiert, ob die Ernennung von Kristin Lund als Kommandeurin in Zypern ein Zeichen für eine veränderte UN-Genderpolitik ist oder eher ein symbolischer Akt.
- Kapitel 6: Konsequenzen für Friedensmissionen mit weiblichen Führungskräften: Dieses Kapitel untersucht die Folgen der Besetzung weiblicher Führungspositionen in Friedensmissionen, insbesondere hinsichtlich der Berücksichtigung von geschlechtsspezifischer Gewalt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Gender-Mainstreaming, UN-Friedensmissionen, weibliche Führungskräfte, Pinkwashing, UN-Resolution 1325, strukturelle Veränderungen in der Sicherheitsarchitektur, genderbasierte Gewalt, und Friedensmissionen in Zypern.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Kristin Lund im Kontext der UN-Friedensmissionen?
Kristin Lund war die erste Kommandeurin einer Friedenstruppe der Vereinten Nationen. Sie leitete von 2014 bis 2016 die Mission UNFICYP auf Zypern.
Was ist das zentrale Forschungsthema dieser Hausarbeit?
Die Arbeit untersucht, ob die Besetzung weiblicher Führungskräfte in der Friedensmission auf Zypern ein echter Meilenstein der UN-Genderpolitik oder lediglich "Pinkwashing" ist.
Welche Rolle spielt die UN-Resolution 1325?
Die UN-Resolution 1325 bildet die Grundlage für die UN-Genderpolitik und setzt Ziele für die Beteiligung von Frauen in Friedensprozessen und Führungspositionen fest.
Was bedeutet "Pinkwashing" in diesem Zusammenhang?
Der Begriff beschreibt eine Strategie, bei der Institutionen sich oberflächlich für Frauenrechte oder Gender-Themen einsetzen, um ein positives Image zu pflegen, ohne tiefgreifende strukturelle Veränderungen vorzunehmen.
Warum wird die Mission auf Zypern (UNFICYP) mit anderen Missionen verglichen?
Der Vergleich dient dazu, die Gefährlichkeit und Strukturmerkmale zu analysieren. Es wird geprüft, ob weibliche Führungskräfte bevorzugt in "weniger riskanten" Missionen eingesetzt werden.
Welche positiven Effekte erhoffen sich Befürworter von Gender-Mainstreaming?
Man verspricht sich positive Auswirkungen auf die Arbeitsweise der UN und eine bessere Adressierung geschlechtsspezifischer Gewalt in Krisengebieten.
- Citar trabajo
- Marius Gaukler (Autor), 2021, Weibliche Führungskräfte in UN-Friedensmissionen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1309620