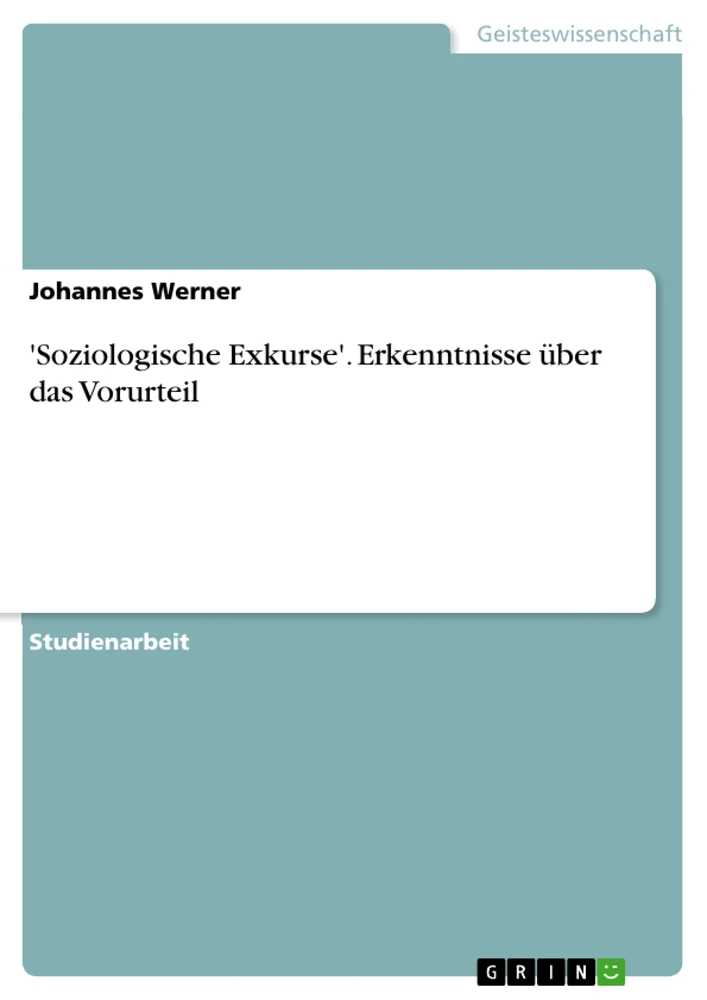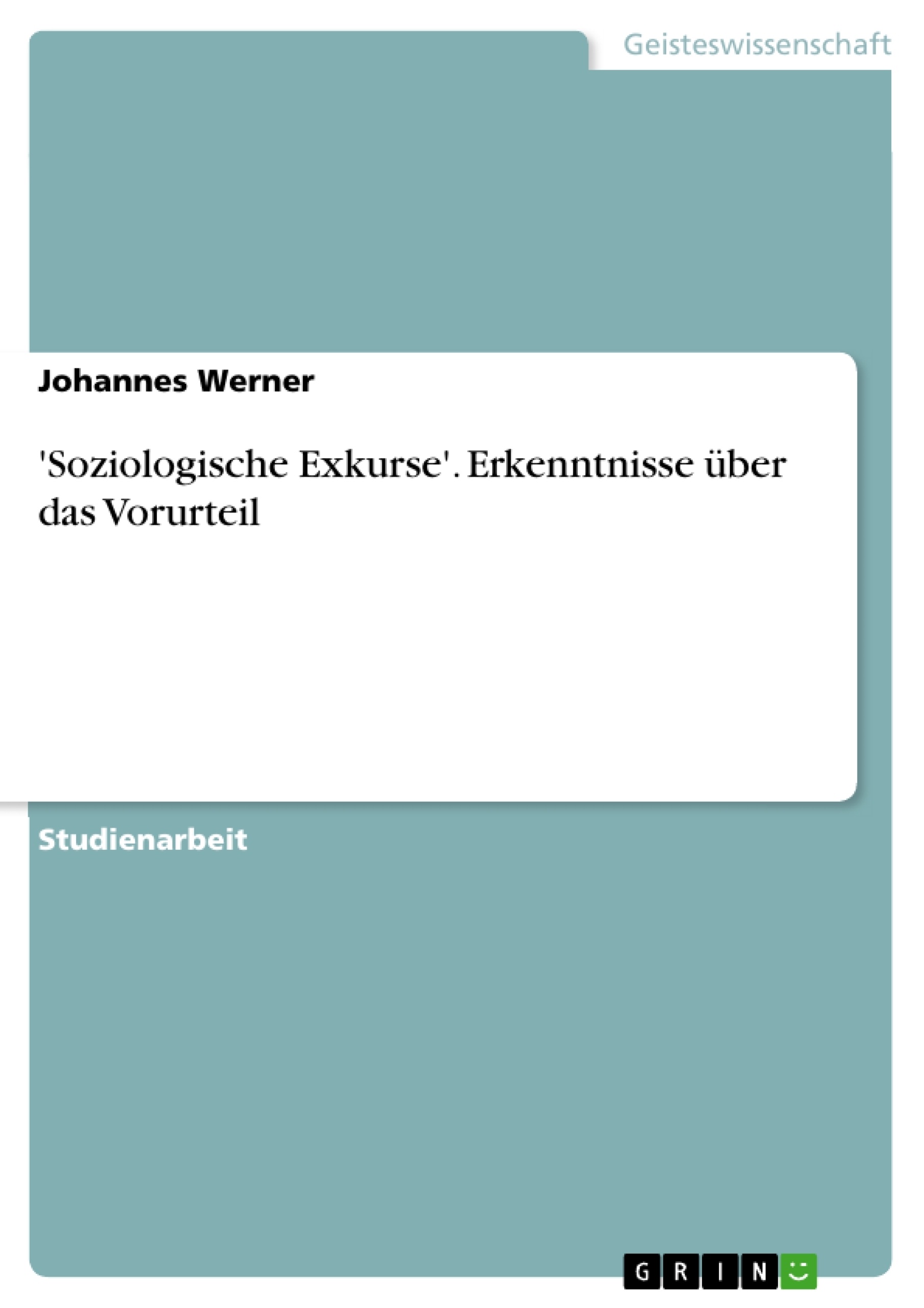Im Alltag ertappt man sich häufig selbst dabei, dass man vorschnelle und gleichzeitig wenig fundierte Gedanken gegenüber Anderen hegt, sogenannte Vorurteile. Doch wie kommt es dazu? Als wichtigster Indikator erscheint mir hierfür die jeweilige persönliche Umgebung der Heranwachsenden. Besonders im Kindesalter, in welchem der Einfluss der Eltern wohl verständlicher Weise noch am größten ist, da diese als vorbildliche Instanzen wahrgenommen werden, erscheint eine Übertragung von Vorurteilen durchaus möglich. Dies bestätigt Allport, indem er einräumt, „[o]bgleich die Konformität mit der Atmosphäre des Elternhauses ohne Zweifel der wichtigste einzige Ursprung des Vorurteils ist, dürfen wir nicht annehmen, daß das Kind heranwächst, um zum Spiegel der Einstellungen der Eltern zu werden“, denn mit zunehmender Reife sollten solche einst übernommenen vorgefertigten Meinungen und Werte vielmehr kritisch auf ihre Richtigkeit überprüft werden, da sonst die latente Möglichkeit besteht, dass „totalitäre Bewegungen und ihre Propaganda erheblichen Umfang annehmen“ , wie die Geschichte gezeigt hat.
Somit erscheint die Auseinandersetzung der Forschung mit dieser Thematik nur als konsequent um eine „Wiederholung des Unheils“ vermeiden zu können. Dabei war die Forschung über das Vorurteil von Beginn an durch ihren interdisziplinären Charakter geprägt, dadurch wurde „in der Vergangenheit das Vorurteil oder verwandte Erscheinungen auf verschiedene Weise“ interpretiert und erklärt. Je nach Erkenntnisinteresse der verschiedenen Einzelwissenschaften fokussierte man auf die unterschiedlichsten Aspekte, weshalb „beispielsweise Historiker und Politologen die geschichtliche Entstehung und die politischen Auswirkungen des […] Antisemitismus beschrieben“, währenddessen der Fachbereich der Psychologie größeres Interesse für die „tiefenpsychologischen Mechanismen“ hegt; analog lassen sich für jede andere Forschungsrichtung die unterschiedlichsten Erkenntnisinteressen darlegen.
In der heutigen Zeit „spielt […] die Sozialpsychologie auf diesem Gebiet eine führende Rolle“. Genau diesem Milieu entspringen auch die Studien über autoritäre Charaktere des Instituts für Sozialforschung, gleichfalls wird hier der Terminus Vorurteil abgehandelt. Die Seminararbeit will nun ausgehend von dem Aufsatz in den Soziologischen Exkursen einige wichtige Erkenntnisse über das Vorurteil darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Über das Vorurteil..
- Begriffsdefinition
- Unterschied: Vorurteil vs. Ethnozentrismus
- Vorurteil in Soziologische Exkurse.………………………..
- Erkenntnisinteresse des Instituts für Sozialforschung.
- Die Reize der Agitatoren......
- Das Klischee des Redners
- Die Aufteilung der Welt in Schafe und Böcke..
- Der autoritäre Charakter.
- Die Studie und ihr Erkenntnisinteresse.
- Ergebnisse und Problematik..
- Gegenmaßnahmen..
- Schlussgedanke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit setzt sich zum Ziel, anhand des Aufsatzes in den "Soziologischen Exkursen" des Instituts für Sozialforschung wichtige Erkenntnisse über das Vorurteil zu beleuchten. Die Arbeit verfolgt dabei eine interdisziplinäre Herangehensweise, um die Komplexität des Themas zu erfassen.
- Die historische Entwicklung des Vorurteilsbegriffs und seine Bedeutungsverschiebung
- Die Unterscheidung zwischen Vorurteil und Ethnozentrismus
- Die Rolle des Instituts für Sozialforschung und seine Forschungsarbeiten zum Vorurteil
- Die psychologischen und soziologischen Ursachen für Vorurteile
- Mögliche Gegenmaßnahmen zur Bekämpfung von Vorurteilen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Allgegenwärtigkeit von Vorurteilen im Alltag heraus und betont die Bedeutung der frühen Prägung durch die elterliche Umgebung. Sie verweist auf die Notwendigkeit, Vorurteile kritisch zu hinterfragen, um totalitären Tendenzen entgegenzuwirken.
- Über das Vorurteil: Dieses Kapitel analysiert den Begriff des Vorurteils und seine historische Entwicklung. Es beleuchtet die Bedeutungsverschiebung des Begriffs von einem juristischen Fachbegriff zu einem Ausdruck für voreilige und unfundierte Urteile. Das Kapitel erörtert die Definition des Vorurteils durch Max Horkheimer und wie dieser die irrationale Komponente des Vorurteils beschreibt.
- Unterschied: Vorurteil vs. Ethnozentrismus: Dieser Abschnitt verdeutlicht den Unterschied zwischen Vorurteil und Ethnozentrismus. Während das Vorurteil auf eine negative Beurteilung einer Person oder Gruppe basiert, zeichnet sich der Ethnozentrismus durch eine kulturelle Beschränktheit und Ablehnung von Fremdem aus.
- Vorurteil in Soziologische Exkurse: Das Kapitel beleuchtet verschiedene soziologische Exkurse zum Thema Vorurteil, die vom Institut für Sozialforschung erforscht wurden. Es werden die verschiedenen Erkenntnisinteressen der Sozialforschung und die Bedeutung des Instituts für das Studium des Vorurteils hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit behandelt wichtige Schlüsselwörter und Themenbereiche, die im Kontext des Vorurteils relevant sind. Dazu gehören der Begriff des Vorurteils selbst, die Rolle des Instituts für Sozialforschung, die Analyse der sozialen und psychologischen Mechanismen, die zu Vorurteilen führen, sowie die Unterscheidung zwischen Vorurteil und Ethnozentrismus. Die Arbeit beleuchtet außerdem die Bedeutung der interdisziplinären Forschung im Umgang mit dem komplexen Phänomen des Vorurteils.
Häufig gestellte Fragen
Wie entstehen Vorurteile laut der Sozialpsychologie?
Vorurteile entstehen oft durch die Übernahme von Einstellungen aus der sozialen Umgebung, insbesondere im Kindesalter durch das Elternhaus, sowie durch psychologische Mechanismen der Abgrenzung.
Was ist der Unterschied zwischen Vorurteil und Ethnozentrismus?
Ein Vorurteil basiert auf einer negativen Bewertung einer Gruppe. Ethnozentrismus beschreibt die Tendenz, die eigene Kultur als Maßstab zu nehmen und Fremdes allein deshalb abzulehnen.
Was untersuchte die Studie zum "Autoritären Charakter"?
Das Institut für Sozialforschung untersuchte, welche Persönlichkeitsmerkmale Menschen anfällig für Vorurteile und totalitäre Propaganda machen, wobei Erziehungsmuster eine zentrale Rolle spielen.
Welche Rolle spielen Agitatoren bei der Verbreitung von Vorurteilen?
Agitatoren nutzen Klischees und die Aufteilung der Welt in "Gut" und "Böse", um irrationale Ängste zu schüren und Vorurteile für politische Zwecke zu instrumentalisieren.
Können Vorurteile durch Erziehung verhindert werden?
Eine kritische Überprüfung übernommener Werte bei zunehmender Reife ist entscheidend. Bildung und der Kontakt zu anderen Kulturen gelten als wichtige Gegenmaßnahmen.
- Citar trabajo
- Johannes Werner (Autor), 2009, 'Soziologische Exkurse'. Erkenntnisse über das Vorurteil, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130994