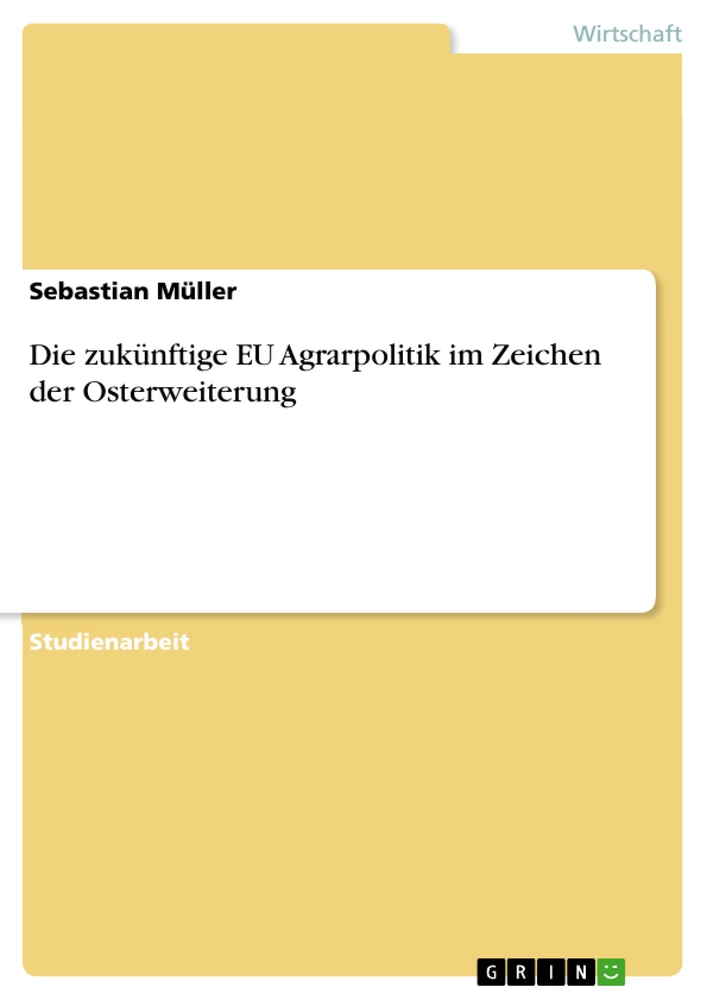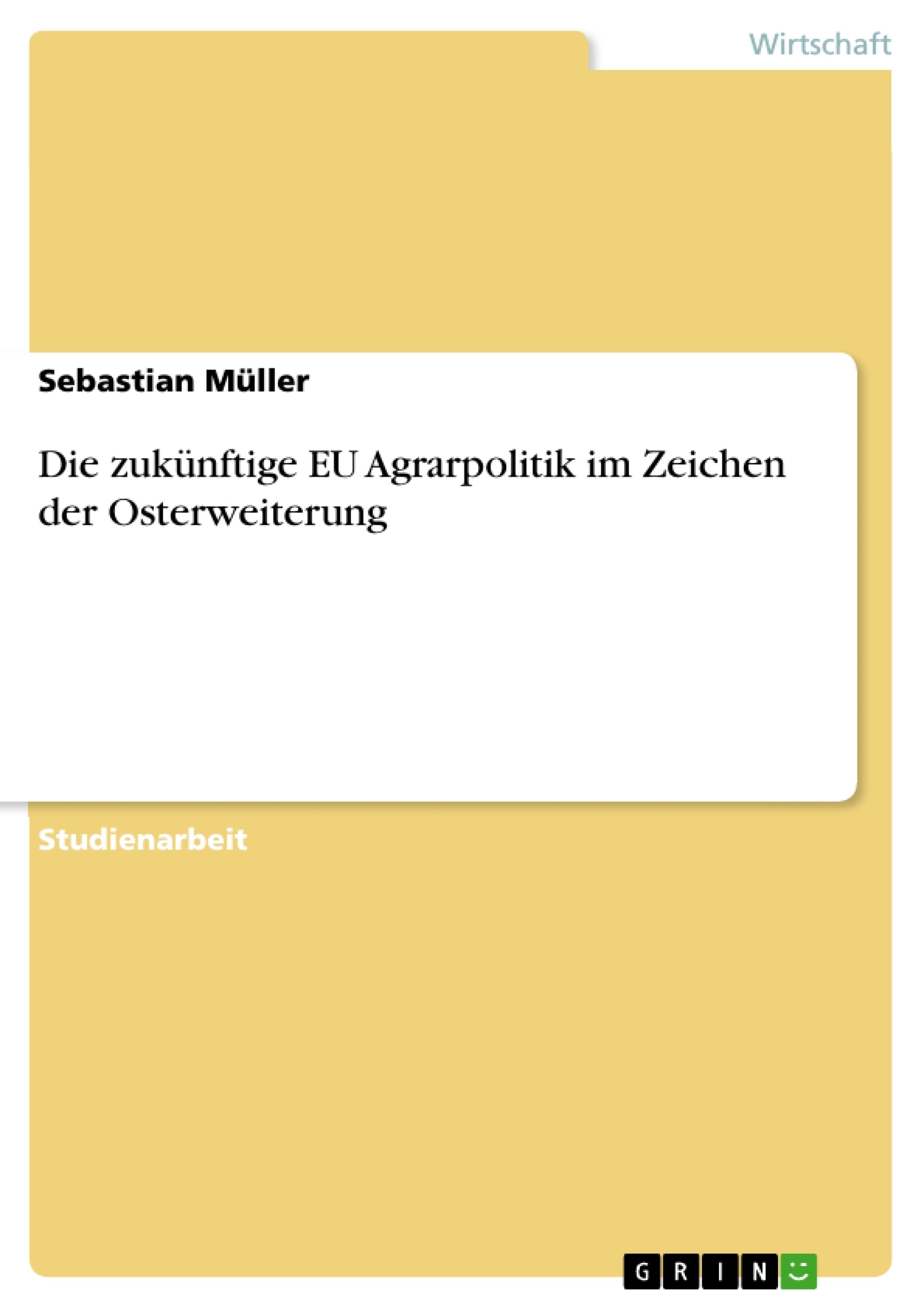Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) ist schon seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft Bestandteil der europäischen Verträge. Sie umfasst die Landwirtschaft und den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Wegen ihrer Spezifik und den divergierenden nationalen Interessen kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Mitgliedsstaaten. Zu Gunsten gemeinsamer einheitlicher Rahmenbedingungen verzichteten die EU Länder auf einen Teil ihrer Souveränität. Kehrseite war der teilweise Ersatz marktwirtschaftlicher Prinzipien durch Reglementierung und Bürokratie.
Dies führte zu Fehlallokationen landwirtschaftlicher Produktionsmittel und in der Folge zu Überproduktion und Kostenexplosion. Mit 50 Prozent des EU Haushaltes kommt der GAP eine besondere Bedeutung zu. Dagegen sind der Anteil der Landwirtschaft am BIP und der Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten recht gering.
Auf dem Weg zu einer erweiterten Union macht die Landwirtschaft einen der größten Problemkomplexe aus. Durch den weit höheren gesellschaftlichen und ökonomischen Stellenwert der Landwirtschaft in den Mittel- und Osteuropäischen Ländern (MOE-Länder) wird es große Auswirkungen auf die GAP geben und die Probleme werden weiter verschärft. Besonders für den Agrarhaushalt sind ohne durchgreifende Reformen sehr hohe Belastungen zu erwarten. Daher werden bei den Beitrittsverhandlungen mehrjährige Sonder- und Übergangsregelungen gefordert. Hinzu kommt die weitere Öffnung der EU Agrarmärkte für den Welthandel im Zuge der eingegangenen handelspolitischen Verpflichtungen in der WTO.
Verschiedene Reformen konnten die Fehlentwicklungen einschränken, jedoch wurde die notwendige Neuausrichtung der Agrarpolitik bis in die Endphase der Beitrittsverhandlungen hinausgeschoben. Um auch zukünftig die Ziele einer Gemeinsamen Agrarpolitik zu erreichen, wird die EU auf weitere grundlegende Reformen und einer damit verbundenen Liberalisierung der Agrarmärkte angewiesen sein.
In dieser Arbeit werden zunächst die Grundlagen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU darstellen, um im Anschluss Fehlentwicklungen und Reformen der Agrarpolitik mit dem Schwerpunkt der EU-Osterweiterung zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen der gemeinsamen Agrarpolitik der EU
- 2.1 Ziele und vertraglicher Rahmen
- 2.2 Grundprinzipien der Gemeinsamen Agrarpolitik
- 2.3 Instrumente der Gemeinsamen Agrarpolitik
- 2.3.1 Außenhandelsregelungen bei Einfuhr von Agrargütern
- 2.3.2 Außenhandelsregelungen bei Ausfuhr von Agrargütern
- 2.3.3 Binnenmarktregelungen
- 2.3.4 Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik
- 2.4 Die Akteure der Gemeinsamen Agrarpolitik
- 3. Die Entwicklung der Agrarpolitik und ihre Bewertung bis Mitte der 90-iger Jahre
- 3.1 Die Bewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik
- 3.2 Erste Reformen
- 4. Geänderte Rahmenbedingungen und die AGENDA 2000
- 4.1 Neue Anforderungen an die EU-Agrarpolitik
- 4.2 Landwirtschaft und WTO
- 4.3 Die Osterweiterung der Europäischen Union
- 4.4 Die AGENDA 2000
- 4.5 Halbzeitbewertung der Agenda 2000
- 5. Die Beitrittsverhandlungen
- 5.1 Standpunkte der EU und der Beitrittsländer
- 5.2 Die Folgen des Beitrittes für die MOE-Länder
- 5.3 Sind die Beitrittsländer gerüstet?
- 5.4 Aktuelle Entwicklungen bei den Beitrittsverhandlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die zukünftige EU-Agrarpolitik im Kontext der Osterweiterung. Sie beleuchtet die historischen Grundlagen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und analysiert deren Entwicklung im Hinblick auf die neuen Herausforderungen, die durch die Beitrittsländer aus Mittel- und Osteuropa (MOE-Länder) entstehen.
- Die Entwicklung und Bewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik
- Die Auswirkungen der Osterweiterung auf die EU-Agrarpolitik
- Die Rolle der WTO in der Gestaltung der Agrarpolitik
- Die Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik im Kontext der AGENDA 2000
- Die Herausforderungen und Chancen der Beitrittsverhandlungen für die Agrarpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der zukünftigen EU-Agrarpolitik im Zeichen der Osterweiterung ein und erläutert die Bedeutung der Landwirtschaft in der europäischen Wirtschaftspolitik.
- Kapitel 2: Grundlagen der gemeinsamen Agrarpolitik der EU: Dieses Kapitel analysiert die Ziele, Prinzipien und Instrumente der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), sowie deren rechtlichen Rahmen.
- Kapitel 3: Die Entwicklung der Agrarpolitik und ihre Bewertung bis Mitte der 90-iger Jahre: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der GAP bis Mitte der 1990er Jahre und bewertet deren Erfolge und Misserfolge.
- Kapitel 4: Geänderte Rahmenbedingungen und die AGENDA 2000: Dieses Kapitel diskutiert die veränderten Rahmenbedingungen für die EU-Agrarpolitik, insbesondere im Kontext der WTO-Verhandlungen und der Osterweiterung. Es beleuchtet die Inhalte und Ziele der AGENDA 2000, einer wichtigen Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik.
- Kapitel 5: Die Beitrittsverhandlungen: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen und Chancen der Beitrittsverhandlungen für die EU-Agrarpolitik, insbesondere im Hinblick auf die Positionen der EU und der Beitrittsländer.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der EU-Agrarpolitik, wie der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), der Osterweiterung, der WTO, der AGENDA 2000, den Beitrittsverhandlungen und den mittel- und osteuropäischen Ländern (MOE-Länder). Sie analysiert die Auswirkungen der Osterweiterung auf die GAP, die Reformen der Agrarpolitik, sowie die handelspolitischen Herausforderungen im internationalen Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)?
Die GAP zielt auf eine stabile Lebensmittelversorgung, angemessene Einkommen für Landwirte und die Stabilisierung der Agrarmärkte in der EU ab.
Welche Herausforderungen bringt die Osterweiterung für die GAP?
Durch den hohen Stellenwert der Landwirtschaft in den MOE-Ländern drohen Kostenexplosionen im EU-Haushalt und die Notwendigkeit tiefgreifender Reformen.
Was ist die AGENDA 2000?
Ein Reformpaket der EU, das die Landwirtschaft auf die Erweiterung vorbereiten sollte, unter anderem durch Preissenkungen und die Stärkung des ländlichen Raums.
Welche Rolle spielt die WTO in der Agrarpolitik?
Die Welthandelsorganisation (WTO) drängt auf eine Liberalisierung der Märkte und den Abbau von Exportsubventionen, was die EU zu Reformen zwingt.
Warum kam es in der Vergangenheit zu Überproduktionen?
Starre Preissysteme und Subventionen führten zu Fehlallokationen, da Landwirte unabhängig von der Marktnachfrage produzierten (Stichwort: "Butterberge").
- Arbeit zitieren
- Sebastian Müller (Autor:in), 2002, Die zukünftige EU Agrarpolitik im Zeichen der Osterweiterung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13100