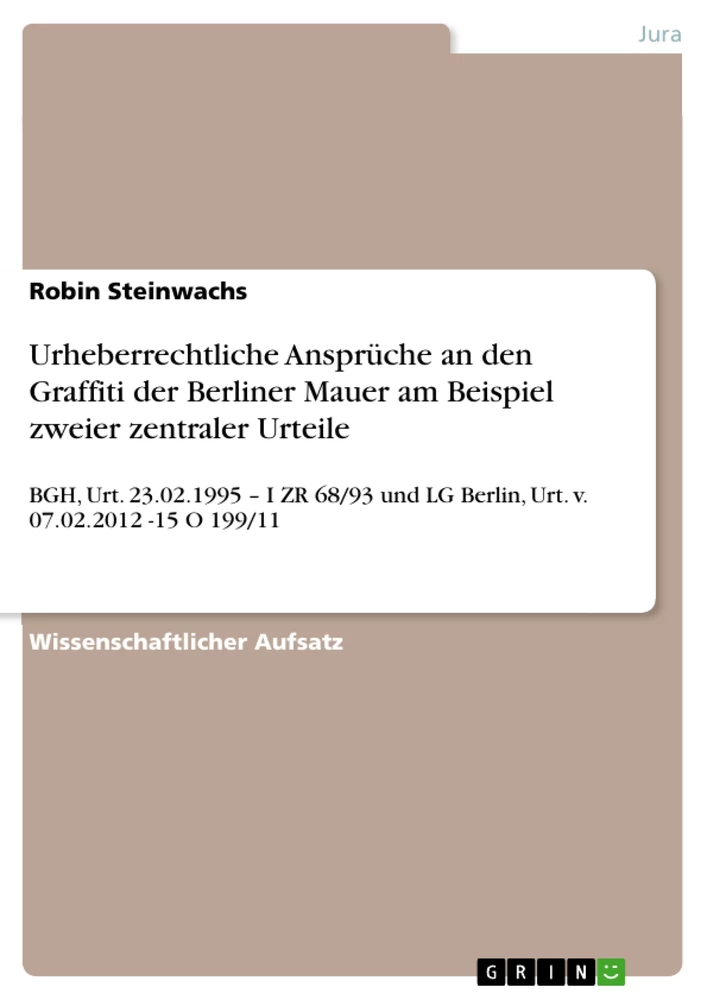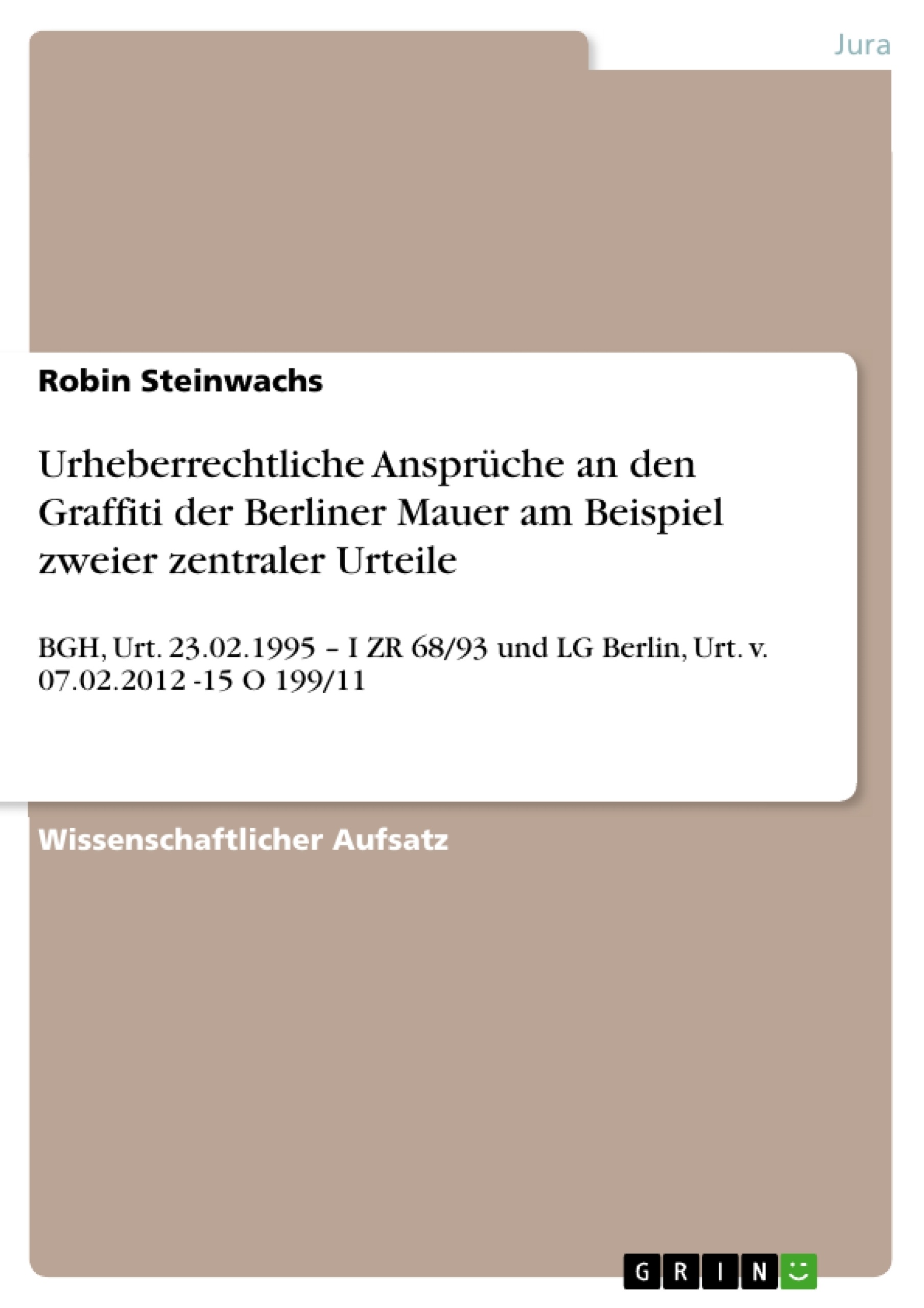Analyse zweier Urteile, ob die Graffiti Bilder auf der Berliner Mauer urheberrechtsschutzfähige Werke der bildenden Kunst i.S.d. § 2 I Nr. 4 UrhG sind, ob das Verbreitungsrecht i.S.d. §§ 15 I Nr. 2, 17 II UrhG erschöpft ist, über die Abgrenzungsfrage von schützenswerten Werken und nicht schützenswerten Erzeugnissen - die "kleine Münze", die rechtliche Problematik aufgedrängter Kunstwerke und die Kollision zwischen Urheberrecht vs. Eigentumsrecht.
Inhaltsverzeichnis
- I. BGH-Urteil
- 1. Rechtsproblem: Urheberrecht vs. Eigentumsrecht
- 2. Ist das Verbreitungsrecht jedoch schon erschöpft?
- 3. Kommentar
- 4. Folgen der Entscheidung und Auswirkungen auf die Praxis
- 5. Eigene Meinung
- II. LG Berlin
- 1. Es handelt sich bei dem Mauerbild um ein urheberrechtsschutzfähiges Werk der bildenden Kunst i.S.d. § 2 1 Nr. 4 UrhG.
- 2. Es ist keine zu einer Schadensersatzverpflichtung des Beklagten führende schwerwiegende Verletzung des Urheberpersönlichkeitsrechts (§ 11 UrhG) des Klägers festzustellen.
- III. Analyse
- IV. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den urheberrechtlichen Ansprüchen an Graffiti der Berliner Mauer am Beispiel zweier zentraler Gerichtsentscheidungen. Ziel ist es, die Rechtsproblematik des Urheberrechts im Spannungsfeld zum Eigentumsrecht am Werkoriginal zu beleuchten und die jeweiligen Argumente der Gerichte zu analysieren.
- Urheberrechtliche Schutzfähigkeit von Graffiti
- Verbreitungsrecht des Urhebers im Kontext von Graffiti
- Erschöpfungsgrundsatz und seine Anwendung auf Graffiti an der Berliner Mauer
- Interessensabwägung zwischen Urheberpersönlichkeitsrecht und Eigentumsrecht
- Relevanz der "Kleinen Münze" im Kontext der Graffiti-Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
I. BGH-Urteil
Das BGH-Urteil befasst sich mit der Frage, ob der Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrecht auf die Graffiti an der Berliner Mauer angewendet werden kann. Der BGH argumentiert, dass das Verbreitungsrecht der Künstler durch die öffentliche Zurschaustellung der Graffiti nicht erschöpft ist, da die Berliner Mauer zu DDR-Zeiten kein verkehrsfähiges Wirtschaftsgut war und die Künstler nicht mit einer wirtschaftlichen Verwertung hätten rechnen können. Der BGH bejaht einen Anspruch der Künstler auf Beteiligung am Erlös aus der Veräußerung der Mauersegmente mit den Graffiti.
II. LG Berlin
Das LG Berlin kommt in seinem Urteil zu dem Schluss, dass die Zerstörung des Graffiti auf der Berliner Mauer keine schwerwiegende Verletzung des Urheberpersönlichkeitsrechts darstellt. In einer Interessenabwägung zwischen dem Urheberpersönlichkeitsrecht des Künstlers und dem Eigentumsrecht des Besitzers der Mauersegmente räumt das Gericht dem Eigentumsrecht den Vorrang ein, da der Künstler das Graffiti bewusst auf fremdem Eigentum angebracht hat.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind Urheberrecht, Eigentumsrecht, Graffiti, Berliner Mauer, Erschöpfungsgrundsatz, Urheberpersönlichkeitsrecht, "Kleine Münze", Street Art, Kunstfreiheit, Eigentumsgarantie, Interessenabwägung.
- Quote paper
- Robin Steinwachs (Author), Urheberrechtliche Ansprüche an den Graffiti der Berliner Mauer am Beispiel zweier zentraler Urteile, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1310112