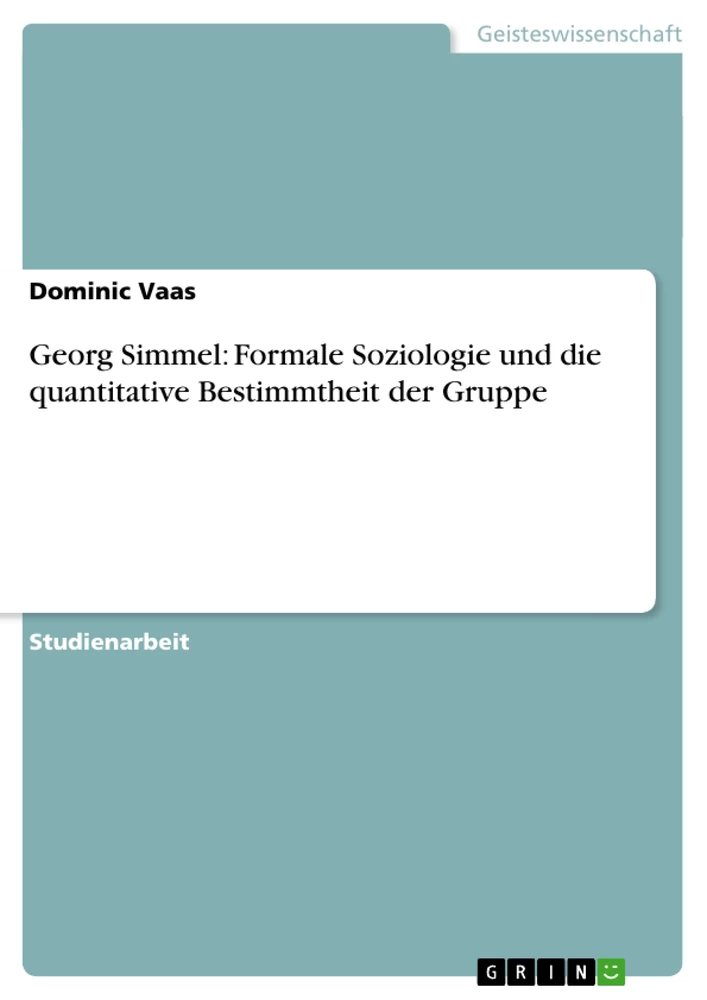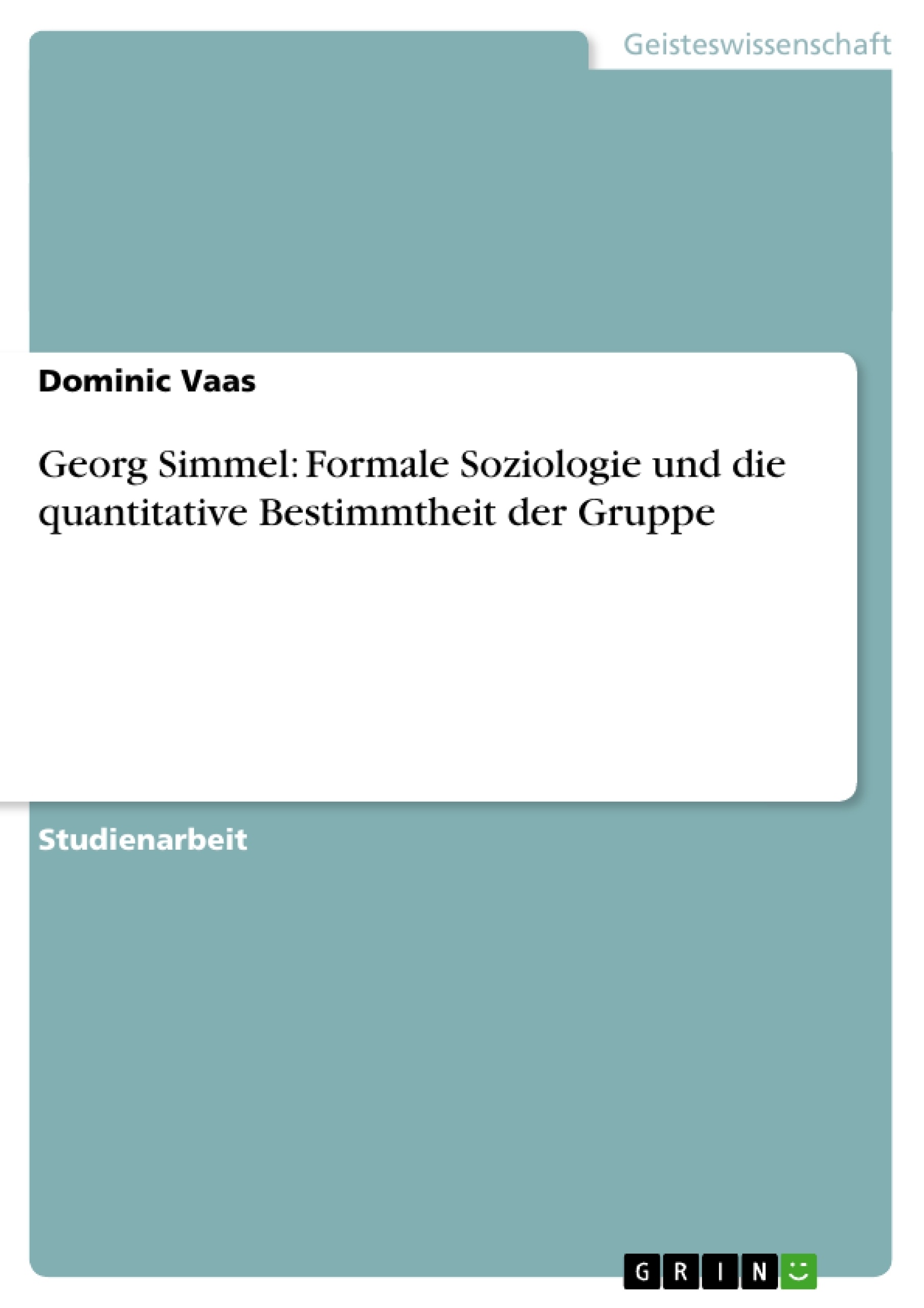Georg Simmel (1858-1918) war der deutsche Soziologe mit den meisten internationalen Beziehungen. Ein enger Freund und Förderer war Max Weber. Simmel setzte sich v.a. mit den Problemen der Konstitution der Einzelwissenschaft Soziologie, ihres Erkenntnisobjekts und ihrer Methode auseinander. Simmel gilt daher auch als einer der Begründer der Soziologie, die er als formale Soziologie definierte.
Simmel unterschied zwischen dem Verstehen des Sachgehalts als dem von Zeit und Raum unabhängigen Begreifen des Inhalts und dem historischen Verstehen, das eigentlich kein inhaltliches Verstehen ist, sondern die Einbettung von Ereignissen, Personen, Sachverhalten in dem aktiven Fluss des Lebens. Soziologie als eigenständige Wissenschaft hielt Simmel für möglich, wenn man die Formen des sozialen Lebens aus ihren inhaltlichen Bezügen herauslösen und diese Formen für sich untersuchen kann. Die „Formen der Vergesellschaftung“ – so der Untertitel von Simmels Buch „Soziologie“ (1908) – sind der eigentliche „Gegenstand“ dieser Wissenschaft. Er kann nicht als solcher aus der Wirklichkeit entnommen werden, sondern wird erst durch die Trennung von Form und Inhalt „erzeugt“. Unter dieser Voraussetzung kann die Soziologie aber eine eigene Wissenschaft sein, ja sogar eine exakte Wissenschaft.
Die „Formen“ der Vergesellschaftung lassen sich bestimmen als die Strukturen, die aufgrund der Wechselwirkungen zwischen Individuen und Gruppen entstehen. “Gesellschaft“ beruht auf Wechselwirkung, auf Beziehung; und die konkreten sozialen Wechselwirkungen weisen zwei Aspekte auf: Form und Inhalt. Die sozialen Inhalte begründen keine eigene, spezifisch-soziologische Interpretation, weil sie auch Gegenstand anderer Wissenschaften sind. Eine Wissenschaft „Soziologie“ muss sich daher mit den formalen Aspekten beschäftigen. Die Abstraktion vom Inhalt ermöglicht es, „die Tatsachen, die wir als die gesellschaftlich-historische Realität bezeichnen, wirklich auf die Ebene des bloß Gesellschaftlichen“ zu projizieren. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Simmel: Formale Soziologie
- Simmel: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung
- Simmel: Die quantitative Bestimmtheit der Gruppe
- Simmel: Intention, Systematik und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Georg Simmels Konzeption der formalen Soziologie und untersucht insbesondere die Bedeutung der quantitativen Bestimmtheit der Gruppe in seinem Werk. Die Arbeit analysiert Simmels Ansatz, die Formen der Vergesellschaftung von ihrem Inhalt zu trennen, um so die spezifischen Gesetze des sozialen Lebens zu erforschen.
- Formale Soziologie als Methode und Gegenstand
- Die Trennung von Form und Inhalt in der sozialen Wirklichkeit
- Die quantitative Bestimmtheit der Gruppe als zentrales Thema
- Simmels soziologische Apriori und ihre Bedeutung
- Die Bedeutung von Simmels Werk für die Entwicklung der Soziologie
Zusammenfassung der Kapitel
- Simmel: Formale Soziologie: Dieses Kapitel stellt Georg Simmel als den deutschen Soziologen mit den meisten internationalen Beziehungen vor und beleuchtet seine Auseinandersetzung mit der Konstitution der Soziologie als eigenständige Wissenschaft. Simmels Konzept der "formalen Soziologie" wird eingeführt, die die Formen des sozialen Lebens von ihren Inhalten trennt, um so die Strukturen der Vergesellschaftung zu untersuchen.
- Simmel: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung: Dieses Kapitel befasst sich mit Simmels Werk "Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung" (1908) und beschreibt seinen zentralen Gedanken, die "Formen" der Vergesellschaftung von den "Inhalten" zu unterscheiden. Die Arbeit hebt die Bedeutung dieser Unterscheidung für die Entwicklung der Soziologie hervor.
Schlüsselwörter
Formale Soziologie, Georg Simmel, Vergesellschaftung, quantitative Bestimmtheit der Gruppe, Formen und Inhalte, soziologische Apriori, methodologische Trennung, Soziologie als Wissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Georg Simmel unter "formaler Soziologie"?
Simmel definierte die Soziologie als eine Wissenschaft, die sich mit den "Formen der Vergesellschaftung" beschäftigt. Er trennte dabei die sozialen Formen (wie Hierarchie oder Wettbewerb) von ihren Inhalten (wirtschaftlich, religiös etc.), um allgemeine Gesetze des sozialen Lebens zu finden.
Was ist der Unterschied zwischen Form und Inhalt bei Simmel?
Inhalte sind die konkreten Zwecke und Antriebe des menschlichen Handelns. Die Formen sind die Strukturen und Arten der Wechselwirkung zwischen Individuen, die unabhängig vom spezifischen Inhalt untersucht werden können.
Was bedeutet die "quantitative Bestimmtheit der Gruppe"?
Dies bezieht sich auf Simmels Analyse, wie die schiere Anzahl der Mitglieder einer Gruppe (z. B. Zweierbeziehung vs. Dreiergruppe) die Art der sozialen Wechselwirkung und die Struktur der Vergesellschaftung grundlegend verändert.
Wann erschien Simmels Hauptwerk zur Soziologie?
Sein bedeutendes Werk "Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung" wurde im Jahr 1908 veröffentlicht.
Welche Rolle spielt die Wechselwirkung in Simmels Theorie?
Für Simmel beruht "Gesellschaft" auf Wechselwirkung. Er sieht die Soziologie als Wissenschaft von den Beziehungen und den daraus resultierenden Strukturen zwischen Individuen.
- Arbeit zitieren
- Mag. Dominic Vaas (Autor:in), 2002, Georg Simmel: Formale Soziologie und die quantitative Bestimmtheit der Gruppe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13105