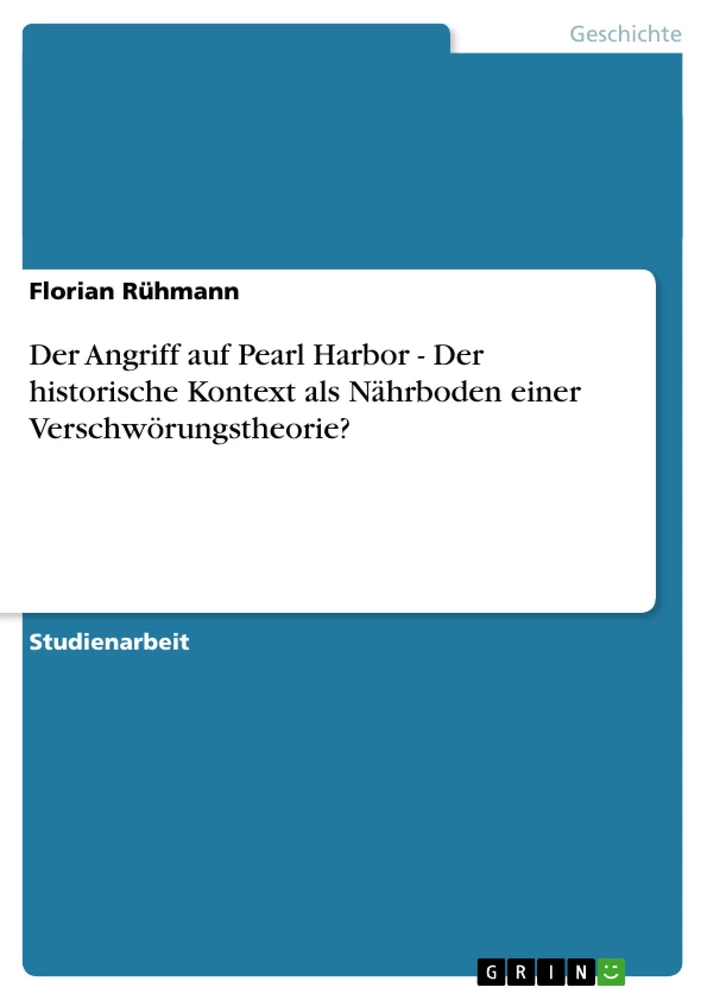Der japanische Luftangriff auf die in Pearl Harbor liegende Pazifikflotte der USA am 7. Dezember 1941 gilt als entscheidender Wendepunkt im 2. Weltkrieg – und liefert zugleich Stoff für eine der meistdiskutierten Verschwörungstheorien des 20. Jahrhunderts. Das japanische Flottengeschwader konnte sich bis auf etwa 440 km den hawaiianischen Inseln nähern und von dort aus seinen Überraschungsangriff starten. Da die US-Streitkräfte in Pearl Harbor nur in geringem Maße verteidigungsbereit waren, fiel die Bilanz des Luftschlags verheerend aus: Acht amerikanische Schlachtschiffe, drei Kreuzer und drei Zerstörer wurden versenkt oder schwer beschädigt, knapp 200 Kampfflugzeuge waren zerstört und 200 weitere beschädigt. Die amerikanische Seite hatte zudem über 2400 Tote zu beklagen und weitere 1100 Personen wurden während der Kampfhandlungen teilweise schwer verletzt. Ein Tag nach dem Angriff erfolgte die Kriegserklärung an Japan und damit ein aktives Eintreten in den 2. Weltkrieg seitens der USA. Daraufhin erklärten Italien und Deutschland am 11. Dezember 1941 ihrerseits den Vereinigten Staaten den Krieg. In der Rückschau betrachtet, verschob sich durch den Kriegseintritt der USA das Gewicht zugunsten der Alliierten und leitete damit langfristig die Niederlage der Achsenmächte ein.
Die vorliegende Arbeit soll aufzeigen, auf welchem Nährboden sich die Verschwörungstheorien bezüglich des japanischen Angriffs auf Pearl Harbor entwickeln konnten. Die Theorien selbst – deren Grundtenor zumeist lautet, die US-Regierung habe von dem bevorstehenden Angriff gewusst und diesen billigend in Kauf genommen, um in den 2. Weltkrieg eintreten zu können – sollen nicht Gegenstand der Betrachtung sein. Vielmehr gilt es, den historischen Kontext zu untersuchen und dabei auf die Kontroverse zwischen Isolationisten und Internationalisten innerhalb der amerikanischen Gesellschaft und Politik einzugehen, sowie die wichtigsten Konfliktlinien zwischen den USA und Japan nachzuzeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Isolationismus vs. Internationalismus am Vorabend des 2. Weltkriegs
- Die isolationistische Tradition der USA
- Franklin D. Roosevelt – Ein Internationalist allein auf weiter Flur
- Konflikt mit Japan - Der Verlauf einer Krise
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den historischen Kontext des japanischen Angriffs auf Pearl Harbor und analysiert die Rolle der Isolationisten und Internationalisten in der amerikanischen Gesellschaft und Politik vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklungen, die zum Kriegseintritt der USA führten, ohne sich direkt mit den Verschwörungstheorien um den Angriff zu befassen.
- Die isolationistische Tradition der USA und ihre historische Entwicklung.
- Die gegensätzliche Position des Internationalismus und Roosevelts Rolle.
- Die außenpolitischen Konflikte zwischen den USA und Japan.
- Der Einfluss der öffentlichen Meinung und der Neutralitätsgesetze auf die amerikanische Politik.
- Die wirtschaftlichen und ideologischen Faktoren, die zum Kriegseintritt beitrugen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den japanischen Angriff auf Pearl Harbor als entscheidenden Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs dar und führt in die Thematik der Arbeit ein. Sie betont den Fokus auf den historischen Kontext und die Auseinandersetzung zwischen Isolationismus und Internationalismus in den USA, ohne die Verschwörungstheorien um den Angriff selbst zu thematisieren. Die Arbeit kündigt die Analyse der wichtigsten Konfliktlinien zwischen den USA und Japan an und nennt relevante Forschungsliteratur.
Isolationismus vs. Internationalismus am Vorabend des 2. Weltkriegs: Dieses Kapitel beleuchtet die gegensätzlichen Positionen von Isolationisten und Internationalisten in den USA während der Zwischenkriegszeit. Es beschreibt die lange Tradition des amerikanischen Isolationismus, beginnend mit der Monroe-Doktrin, die eine Trennung der amerikanischen und europäischen Interessensphären postulierte. Der Höhepunkt der isolationistischen Strömung in den 1930er Jahren, gekennzeichnet durch die Konzentration auf die Überwindung der Weltwirtschaftskrise und die Ignoranz gegenüber den expansiven Politiken Japans und Deutschlands, wird ausführlich dargestellt. Die Verabschiedung von Neutralitätsgesetzen durch den Kongress, welche den Handlungsspielraum der Regierung Roosevelts einschränkten, und die zunehmende gesellschaftliche Unterstützung für den Isolationismus werden ebenfalls thematisiert.
Konflikt mit Japan - Der Verlauf einer Krise: (Anmerkung: Da der Text keine weiteren Informationen zu diesem Kapitel liefert, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Pearl Harbor, Isolationismus, Internationalismus, Franklin D. Roosevelt, USA, Japan, Zweiter Weltkrieg, Neutralitätsgesetze, Außenpolitik, Monroe-Doktrin, Weltwirtschaftskrise, Achsenmächte, Alliierte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des japanischen Angriffs auf Pearl Harbor
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den historischen Kontext des japanischen Angriffs auf Pearl Harbor und untersucht die Rolle des Isolationismus und Internationalismus in der amerikanischen Gesellschaft und Politik vor dem Zweiten Weltkrieg. Der Fokus liegt auf den Entwicklungen, die zum Kriegseintritt der USA führten, wobei Verschwörungstheorien um den Angriff selbst ausgeklammert werden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die isolationistische Tradition der USA, die gegensätzliche Position des Internationalismus und Roosevelts Rolle, die außenpolitischen Konflikte zwischen den USA und Japan, den Einfluss der öffentlichen Meinung und der Neutralitätsgesetze, sowie die wirtschaftlichen und ideologischen Faktoren, die zum Kriegseintritt beitrugen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Isolationismus vs. Internationalismus vor dem Zweiten Weltkrieg, ein Kapitel über den Konflikt mit Japan und eine Schlussbetrachtung. Die Einleitung stellt den historischen Kontext dar und führt in die Thematik ein. Das Kapitel über Isolationismus und Internationalismus beleuchtet die gegensätzlichen Positionen in den USA während der Zwischenkriegszeit. Das Kapitel zum Konflikt mit Japan beschreibt den Verlauf der Krise (jedoch sind im vorliegenden Text keine weiteren Details enthalten).
Was sind die wichtigsten Schlüsselbegriffe?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind Pearl Harbor, Isolationismus, Internationalismus, Franklin D. Roosevelt, USA, Japan, Zweiter Weltkrieg, Neutralitätsgesetze, Außenpolitik, Monroe-Doktrin, Weltwirtschaftskrise, Achsenmächte und Alliierte.
Wie wird der Isolationismus in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beschreibt die lange Tradition des amerikanischen Isolationismus, beginnend mit der Monroe-Doktrin. Sie analysiert den Höhepunkt der isolationistischen Strömung in den 1930er Jahren, die Verabschiedung von Neutralitätsgesetzen und die zunehmende gesellschaftliche Unterstützung für den Isolationismus.
Welche Rolle spielt Franklin D. Roosevelt in der Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet die gegensätzliche Position Roosevelts zum Isolationismus und seine Rolle als Internationalist in einer von Isolationisten geprägten Gesellschaft und Politik.
Wie wird der Konflikt zwischen den USA und Japan dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die außenpolitischen Konflikte zwischen den USA und Japan, die zu der Krise führten, die im Angriff auf Pearl Harbor gipfelte. Jedoch enthält der vorliegende Text nur eine knappe Zusammenfassung zu diesem Kapitel.
- Quote paper
- Florian Rühmann (Author), 2009, Der Angriff auf Pearl Harbor - Der historische Kontext als Nährboden einer Verschwörungstheorie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131105