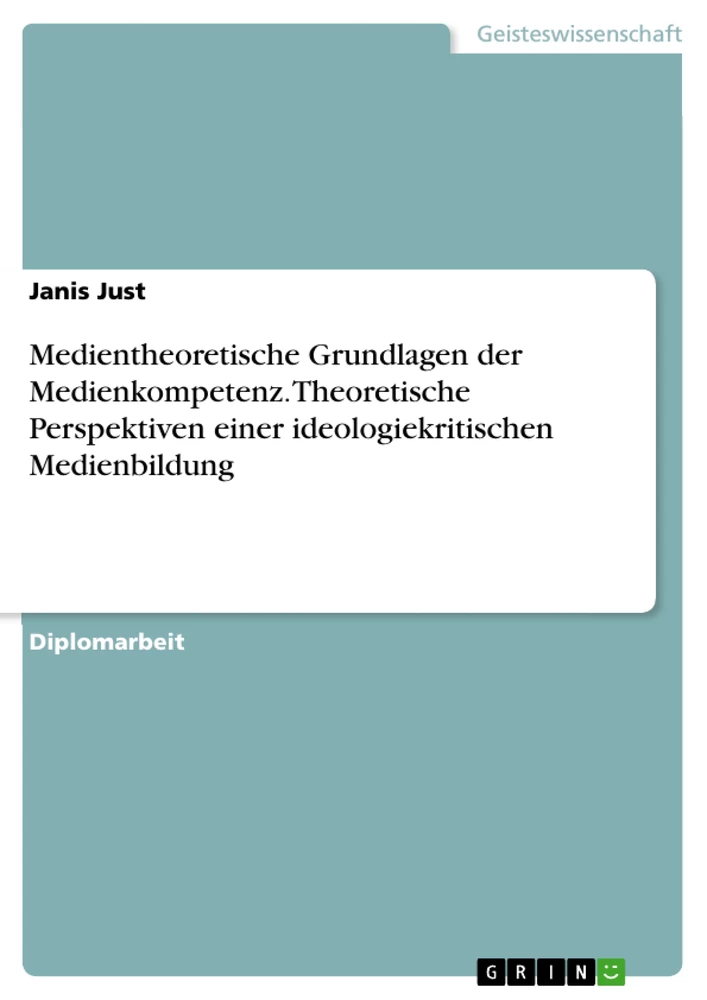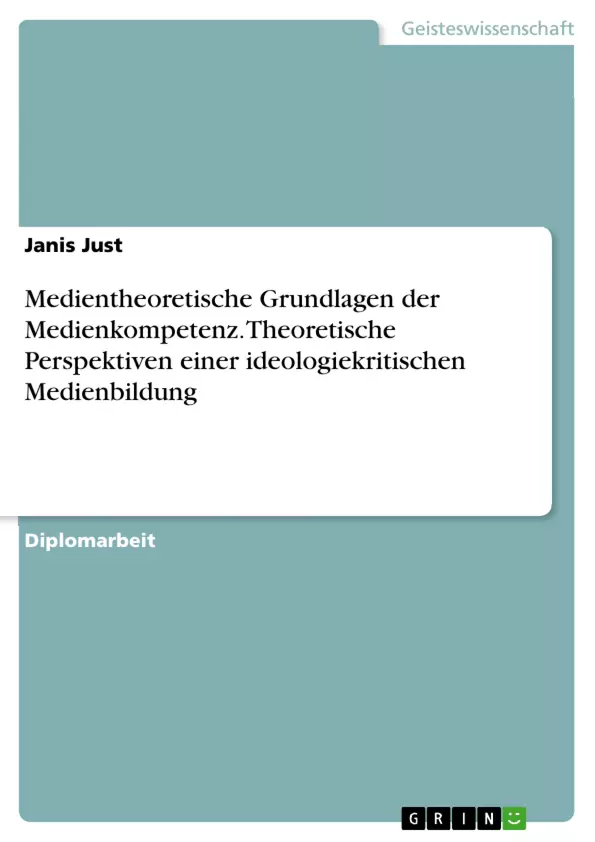Medial vermittelte Lernprozesse werden zunehmend Teil der Grundsozialisation eines jeden Menschen und es lassen sich Erziehungs- bzw. Sozialisationsprozesse immer weniger ohne Bezug zu Medien denken. Weniger soll es hier jedoch um die praktische Handlungsorientierung medienpädagogischer Arbeitsfelder gehen, sondern vielmehr um eine theoretische Reflexion oftmals unhinterfragter vermeintlicher Gewissheiten. Soziale Arbeit, verstanden als ausführender Arm staatlich gelenkter Interessensdurchsetzung, wird an der angestrebten Professionalisierung scheitern, wenn sie nicht durch Selbstbewusstsein zu sich findet und eigene Wege nicht nur erkennt und aufzeigt, sondern auch selbstreferentiell daran arbeitet und somit eigene Theoriebildung vorantreibt. Für den Bereich der Medienpädagogik oder der Medienbildung bedeutet dies, keinen Rückschritt hinter technische und zivilisatorische Errungenschaften durch Zensurversuche oder Bewahrpädagogik zu forcieren und auch nicht in der Regression von scheinbar harmonischer Natur und nachbarschaftlicher Gemeinschaft aufzugehen.
Mit der von mir intendierten Begriffswahl der „ideologiekritischen Medienbildung“ stellt sich die Frage nach dem Deutungskontext in Abgrenzung zur Medienkompetenz, der bereits weitgehend systematisch aufgearbeitet ist und in diesem Feld generelle Verwendung findet. Der von mir eingenommene Fokus auf die Bildung als informellem und selbstreflexivem Lernprozess von Mündigkeit und Autonomie verlangt eine Akzentuierung der Aneignungsprozesse, hier der einer „Bildung durch Medien“. Medienbildung bezeichnet daher nicht eine Form der Medienrezeption, sondern die Art und Weise, wie der Mensch mit dem medienvermittelten Gegenstand umgeht. Medienbildung geht also erweiternd und ergänzend über das „Bilden für Medien“, die Medienkompetenz, hinaus.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG.
- 2. DIE MEDIEN – EINE HINFÜHRUNG.
- 2.1 WALTER BENJAMIN UND BERTOLT BRECHT
- 2.2 HANS MAGNUS ENZENSBERGER
- 2.3 VILÉM FLUSSER
- 2.4 MARSHALL MCLUHAN.
- 2.5 PAUL VIRILIO UND NEIL POSTMAN
- 2.6 JEAN BAUDRILLARD.
- 2.7 DIE KRITISCHE THEORIE
- 2.7.1 Die Kulturindustriethese..
- 2.7.2 Kulturindustrie und Freizeit.
- 3. THESEN ZUR MEDIENZENSUR UND MEDIENMANIPULATION.
- 3.1 MEDIENVERDAMMUNG UND MEDIENKRITIK
- 3.2,,AMERIKANISIERUNG“ DER MEDIEN.
- 4. MEDIENPÄDAGOGIK UND DAS KONZEPT DER MEDIENKOMPETENZ.
- 4.1 MEDIENPÄDAGOGIK
- 4.2 MEDIENKOMPETENZ...
- 5. MEDIENBILDUNG...
- 5.1 AUFKLÄRUNG UND BILDUNG
- 5.2 EIN,,PROLOG ZUM FERNSEHEN“
- 5.3 ZUR,,THEORIE DER HALBBILDUNG“.
- 5.4 ZENTRALE BEGRIFFE DER PÄDAGOGIK: MÜNDIGKEIT UND ERFAHRUNGSFÄHIGKEIT
- 5.5 KRITISCHE BILDUNGSTHEORIE.
- 5.6 IDEOLOGIEKRITISCHE MEDIENBILDUNG.
- 6. EXKURS IN DIE PRAXIS.
- 6.1 MEDIENERZIEHUNG IM KINDERGARTEN UND IN DER SCHULE
- 6.2 DIE GESELLSCHAFT FÜR MEDIENPÄDAGOGIK UND KOMMUNIKATIONSKULTUR
- 7. MODERN TIMES - DAS WEB 2.0
- 7.1 MEINUNGSMARKT 2.0
- 7.2 DIE KULTUR DES AMATEURHAFTEN
- 8. RESUMÉE.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit den medientheoretischen Grundlagen der Medienkompetenz und beleuchtet theoretische Perspektiven einer ideologiekritischen Medienbildung. Ziel ist es, die Entwicklung einer reflexiv-kritischen Medienbildung als Grundlage sozialpädagogischen Handelns zu fördern.
- Die Kulturindustrie-These als zentraler Referenzpunkt in der Auseinandersetzung mit Medien im Spannungsfeld von Manipulation und Emanzipation.
- Die Bedeutung der Medien für die Wahrnehmung der Welt, die Entstehung von Weltbildern und die politische und kulturelle Praxis.
- Die Rolle der Medien in der Grundsozialisation und die Notwendigkeit einer theoretischen Reflexion vermeintlicher Gewissheiten.
- Die Bedeutung von Selbstbewusstsein und Theoriebildung in der Sozialen Arbeit.
- Die Notwendigkeit einer kritischen Medienbildung, die den Wandel lebensweltlicher Erfahrungen neu erfasst.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und führt in die Thematik der Medienkompetenz und Medienbildung ein. Sie beleuchtet die Bedeutung der Medien für die Wahrnehmung der Welt und die Notwendigkeit einer kritischen Medienbildung.
Das zweite Kapitel bietet eine Einführung in die Medientheorien und stellt verschiedene Denker und ihre Ansätze vor. Es werden die Theorien von Walter Benjamin und Bertolt Brecht, Hans Magnus Enzensberger, Vilém Flusser, Marshall McLuhan, Paul Virilio und Neil Postman sowie Jean Baudrillard beleuchtet.
Das dritte Kapitel befasst sich mit Thesen zur Medienzensur und Medienmanipulation. Es werden die Begriffe Medienverdammung und Medienkritik sowie die „Amerikanisierung“ der Medien diskutiert.
Das vierte Kapitel widmet sich der Medienpädagogik und dem Konzept der Medienkompetenz. Es werden die Aufgaben und Ziele der Medienpädagogik sowie die Bedeutung von Medienkompetenz für die heutige Gesellschaft erläutert.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Medienbildung und ihren zentralen Begriffen wie Aufklärung, Bildung, Mündigkeit und Erfahrungsfähigkeit. Es werden die Theorien der kritischen Bildungstheorie und der ideologiekritischen Medienbildung vorgestellt.
Das sechste Kapitel bietet einen Exkurs in die Praxis und beleuchtet die Medienbildung im Kindergarten und in der Schule sowie die Arbeit der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur.
Das siebte Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen der digitalen Medienlandschaft im Web 2.0. Es werden die Themen Meinungsmarkt 2.0 und die Kultur des Amateurhaften diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Medienkompetenz, die ideologiekritische Medienbildung, die Kulturindustrie-These, die Medienmanipulation, die Medienpädagogik, die kritische Bildungstheorie und die Bedeutung der Medien für die Grundsozialisation.
- Quote paper
- Janis Just (Author), 2009, Medientheoretische Grundlagen der Medienkompetenz. Theoretische Perspektiven einer ideologiekritischen Medienbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131136