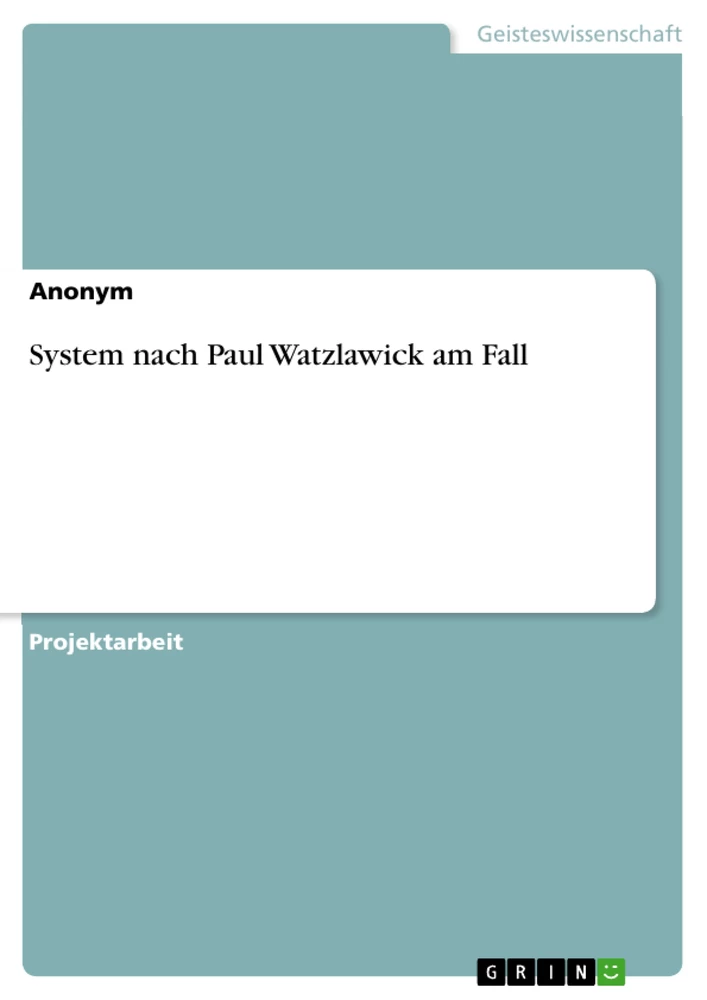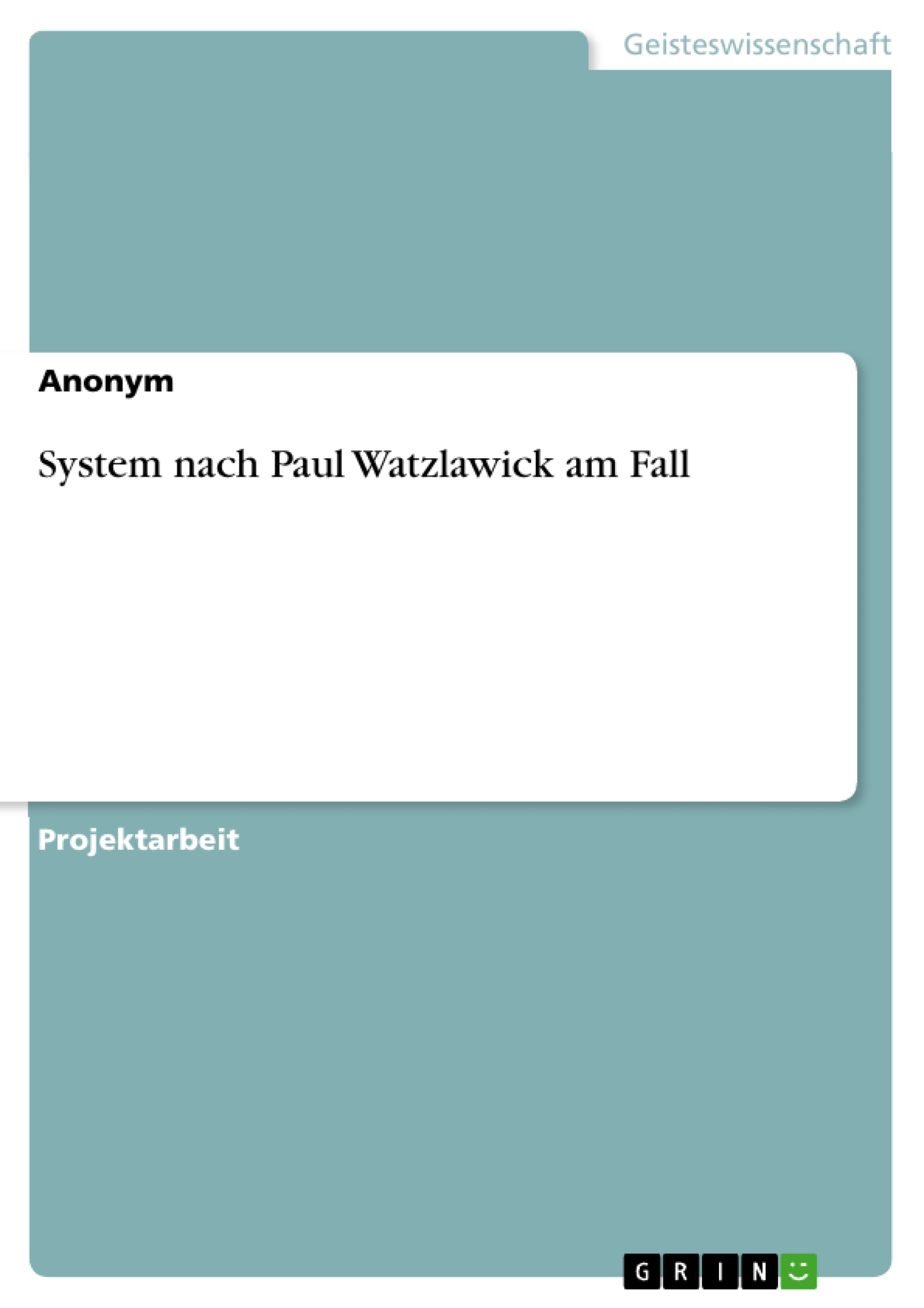Diese Ausarbeitung soll die Umsetzung des systemischen Ansatzes am Fallbeispiel der fiktiven Familie Schmidt veranschaulichen und seine Bedeutung in der systemischen Praxis Sozialer Arbeit verdeutlichen. Den Anfang bildet hierbei das zweite Kapitel, in welchem zunächst das Theoriegerüst des systemischen Ansatzes nach Watzlawick, sowie damit zusammenhängende Begrifflichkeiten umfassend erläutert werden. Das dritte Kapitel legt den Fall der Familie Schmidt dar, an dem diese Hausarbeit ausgerichtet ist. Innerhalb des vierten Kapitels werden zunächst die unbekannten Variablen beleuchtet, welche sich aus dem vorangegangenen Fallbeispiel ergeben. Im Anschluss wird der Fall anhand des systemischen Ansatzes nach Watzlawick analysiert und auf bestehende Systemdefizite überprüft, wobei diese systemischen Zusammenhänge und Wechselwirkungen zum besseren Verständnis des Lesers grafisch veranschaulicht werden. Das fünfte Kapitel greift die vorangegangene Fallanalyse auf und verknüpft diese mit der Hilfegestaltung, welche in kurz-, mittel- und langfristige Zielsetzungen unterteilt wird. Zudem wird in diesem Zusammenhang ebenfalls der Blick auf die mögliche Umsetzung dieser Zielvorstellungen gelegt, sowie der Einfluss dieser auf die Familiendynamik. Abschließend folgt im Kapitel sechs das Fazit, welches eine Zusammenfassung der gesammelten Theorie und Fallanalyse beinhaltet, sowie einen Ausblick auf den geplanten Hilfeverlauf der Familie Schmidt gibt und darauf bezogene Chancen und Risiken reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Modell nach Watzlawick
- Das „System“ nach Watzlawick
- System Dysfunktionalität & negative Systembeziehungen
- Fallbeispiel
- Familie Schmidt
- Von der Theorie zur Praxis
- Unbekannte Variablen im Kontext des Falls
- Fallanalyse anhand des Systems nach Watzlawick
- System-Dysfunktionalitäten und negative Systembeziehungen am Fallbeispiel
- Zielsetzung und Anwendung am Fall
- Kurzfristige Ziele und Umsetzung
- Mittelfristige Ziele und Umsetzung
- Langfristige Ziele und Umsetzung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit verfolgt das Ziel, die praktische Anwendung des systemischen Ansatzes nach Watzlawick im Kontext der Sozialen Arbeit zu verdeutlichen. Sie soll die Funktionsweise des Modells am Fallbeispiel einer fiktiven Familie, der Familie Schmidt, aufzeigen.
- Der systemische Ansatz nach Watzlawick als theoretisches Modell
- Analyse der Familiendynamik anhand des systemischen Ansatzes
- Identifikation von System-Dysfunktionalitäten und negativen Systembeziehungen
- Entwicklung von kurz-, mittel- und langfristigen Zielen zur Intervention
- Reflexion der Chancen und Risiken des systemischen Ansatzes in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der systemischen Theorie in der Sozialen Arbeit ein und stellt den systemischen Ansatz nach Watzlawick vor. Das zweite Kapitel erläutert das Modell von Watzlawick, das verschiedene Ebenen des Systems eines Individuums oder einer Gruppe, wie Familie, berücksichtigt. Es werden die Begriffe der System-Dysfunktionalität und negativer Systembeziehungen definiert. Das dritte Kapitel präsentiert die Familie Schmidt als Fallbeispiel. Das vierte Kapitel beleuchtet die unbekannten Variablen des Falls und analysiert diesen anhand des systemischen Ansatzes. Schließlich werden systemische Dysfunktionalitäten und negative Beziehungen innerhalb der Familie Schmidt aufgezeigt. Das fünfte Kapitel entwickelt kurz-, mittel- und langfristige Ziele für die Intervention, betrachtet die mögliche Umsetzung dieser Ziele und analysiert deren Einfluss auf die Familiendynamik.
Schlüsselwörter
Systemische Theorie, Watzlawick, Systemisches Modell, System-Dysfunktionalität, Negative Systembeziehungen, Fallbeispiel, Familie Schmidt, Intervention, Kurzfristige Ziele, Mittelfristige Ziele, Langfristige Ziele, Sozialen Arbeit
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, System nach Paul Watzlawick am Fall, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1311363