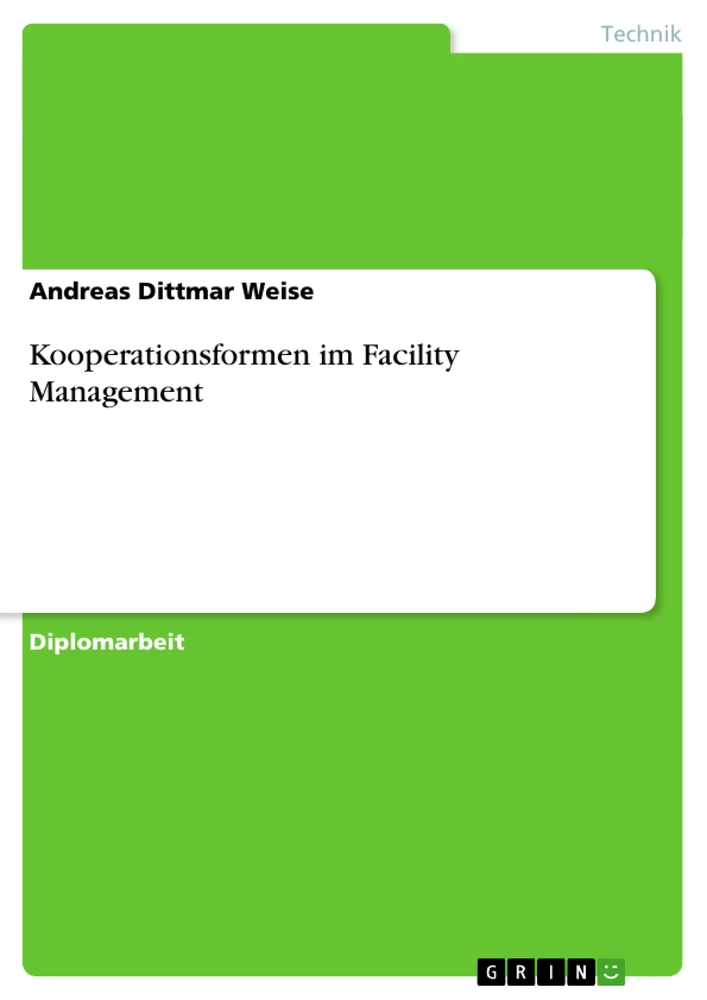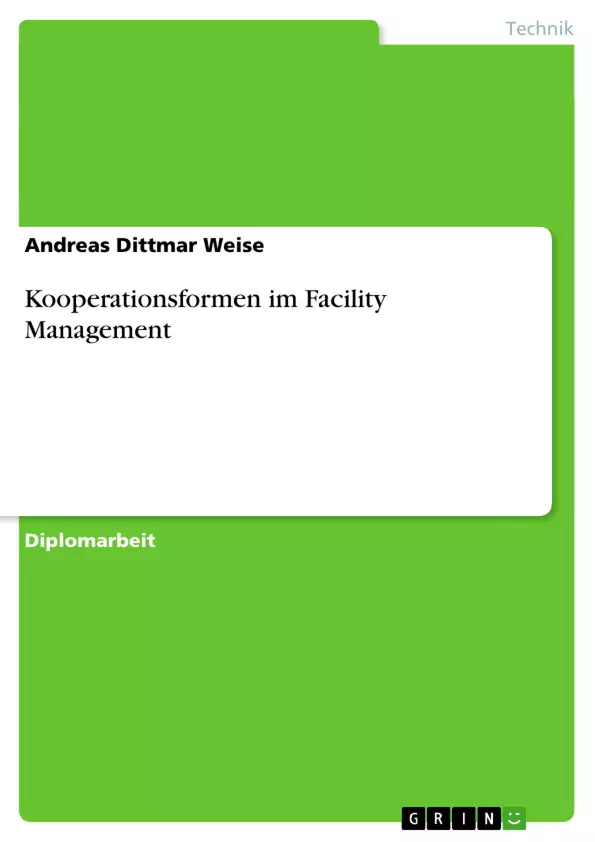Kooperationsformen, die besonders geeignet für das Facility Management sind, schaffen Freiräume für die zukünftige Entwicklung und federn Risiken ab. Weiterhin unterstützen diese ein Strategiemodell zur Beurteilung der ooperationsstrategiealternativen
und damit zur Wahl der „guten“ Kooperationspartner.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Zielsetzung
- 1.3. Gang der Untersuchung
- 2. Grundlagen des Facility Management
- 2.1. Historische Entwicklung und Definitionen
- 2.2. Dimensionen des Facility Management
- 2.2.1. Lebenszyklusbetrachtung
- 2.2.2. Transparenz
- 2.2.3. Ganzheitlichkeit
- 2.3. Ebenen des Facility Management
- 2.4. Der Facility Management Markt
- 2.5. Trends im Facility Management Markt
- 2.5.1. Immobilie als Kostenfaktor und wertvolle Ressource im Fokus
- 2.5.2. Prozessoptimierung bzw. Produktivitätssteigerung der Mitarbeiter
- 2.5.3. Konzentration auf das Kerngeschäft und Outsourcing von Sekundärfunktionen
- 2.5.3.1. Konzentration auf das Kerngeschäft
- 2.5.3.2. Outsourcing
- a. Fixkostenreduzierung
- b. Flexibilisierung
- c. Verschlankung der Unternehmensstruktur
- 2.5.4. Komplettangebote aus einer Hand
- 2.5.4.1. Komplettangebote aus Nachfragersicht
- 2.5.4.2. Komplettangebote aus Anbietersicht
- 2.5.4.3. Kritische Bewertung von Komplettangeboten
- 3. Kooperationsformen
- 3.1. Definition des Begriffes Kooperation
- 3.1.1. Bestehende Definitionen in der Literatur
- 3.1.1.1. Schwarz
- 3.1.1.2. Düttmann
- 3.1.1.3. Knoblich und Rotering
- 3.1.1.4. Spekman, Isabella und Mac Avoy
- 3.1.1.5. Bronder und Pritzl
- 3.1.1.6. Kanter
- 3.1.1.7. Bamford, Gomes-Casseres und Robinson
- 3.1.1.8. Sydow
- 3.1.1.9. Kurr
- 3.1.1.10. Perlitz
- 3.1.1.11. Hungenberg
- 3.1.2. Grundlagen einer eigenen Definition
- 3.1.2.1. Autonomes Verhalten und Freiwilligkeit
- 3.1.2.2. Selbständigkeit der Kooperationspartner
- a. Rechtliche Selbständigkeit
- b. Wirtschaftliche Selbständigkeit
- 3.1.2.3. Gegenseitige Interdependenz beim partiellen Zusammenwirken
- 3.1.2.4. Längerfristige und vertragliche Basis
- 3.1.2.5. Internationale Zusammenarbeit
- 3.1.3. Arbeitsdefinition
- 3.1.1. Bestehende Definitionen in der Literatur
- 3.2. Ursachen, Ziele und Erfolgsfaktoren von Kooperationen
- 3.2.1. Ursachen von Kooperationen
- 3.2.1.1. Entscheidungsrisiken
- 3.2.1.2. Innovation
- 3.2.1.3. Informations- und Kommunikationssysteme
- 3.2.1.4. Neue Märkte
- 3.2.1.5. Produktlebenszyklus
- 3.2.1.6. Selbständigkeit der Partner
- 3.2.1.7. Wissensintensität
- 3.2.2. Ziele von Kooperationen
- 3.2.2.1. Forschung und Entwicklung
- 3.2.2.2. Leistungserstellung
- 3.2.2.3. Risikominderung durch Risikoteilung
- 3.2.2.4. Vermarktung und Vertrieb
- 3.2.3. Erfolgsfaktoren von Kooperationen
- 3.2.3.1. Transaktionstheorie
- 3.2.3.2. Spieltheorie
- 3.2.3.3. Ressourcenabhängigkeits-Ansatz
- 3.2.1. Ursachen von Kooperationen
- 3.3. Kooperationen
- 3.3.1. Vertragslose Zusammenarbeit
- 3.3.2. Kooperations- und Lizenzverträge i.e.S.
- 3.3.2.1. Definition und Merkmale
- 3.3.2.2. Ziele von Lizenzverträgen
- a. Ziele des Lizenzgebers
- b. Ziele des Lizenznehmers
- 3.3.2.3. Vor- und Nachteile von Lizenzvereinbarungen
- 3.3.3. Franchising
- 3.3.3.1. Definition und Merkmale
- 3.3.3.2. Ziele
- a. Ziele des Franchise-Gebers
- b. Ziele des Franchise-Nehmers
- 3.3.3.3. Vor und Nachteile
- a. Vor- und Nachteile für den Franchise-Geber
- b. Vor und Nachteile für den Franchise-Nehmer
- 3.3.4. Gemeinschaftsunternehmen
- 3.3.4.1. Merkmale
- 3.3.4.2. Kapitalbeteiligung
- 3.3.5. Joint Venture
- 3.3.5.1. Merkmale und Begriffsbestimmung
- 3.3.5.2. Klassifikation Joint Venture-Typen
- 3.3.5.3. Ziele des Joint Venture
- a. Einflussnahme auf den Wettbewerb
- b. Risikoreduktion
- c. Synergien
- d. Zugang zu Märkten und Ressourcen
- 3.3.6. Virtuelle Organisation und Unternehmensnetzwerk
- 3.3.6.1. Definition von Unternehmensnetzwerken
- a. interne (intraorganisationale) Netzwerke
- b. externe (interorganisatorische) Netzwerke
- c. stabiles Netzwerk
- d. dynamisches Netzwerk
- 3.3.6.2. Definition von virtuellen Organisationen
- a. Virtualität
- b. Definitionsbestandteile von virtuellen Organisationen
- 3.3.6.1. Definition von Unternehmensnetzwerken
- 4. Kooperationsstrategien im Facility Management
- 4.1. Strategische Allianzen im Facility Management
- 4.2. Die FM-Alliance als Beispiel einer strategischen Allianz
- 4.2.1. Die FM-Alliance
- 4.2.2. Die Partner der FM-Alliance
- 4.2.3. Die Ziele der FM-Alliance
- 4.2.4. Die Struktur der FM-Alliance
- 4.2.5. Die Organisation der FM-Alliance
- 4.2.6. Die Leistungen der FM-Alliance
- 4.2.7. Die Erfahrungen der FM-Alliance
- 4.3. Erfolgsfaktoren für Kooperationsstrategien im Facility Management
- 4.4. Die Bedeutung von Vertrauen und Kommunikation in Kooperationen
- 4.5. Die Rolle der Führung in Kooperationen
- 4.6. Die Bedeutung von Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in Kooperationen
- 5. Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema der Kooperationsformen im Facility Management. Ziel ist es, die verschiedenen Kooperationsformen mit ihren Merkmalen, Vor- und Nachteilen darzustellen und die geeignetsten Formen für das Facility Management zu identifizieren. Darüber hinaus soll ein Modell für eine Kooperationsstrategie entwickelt werden, das am Beispiel der FM-Alliance geprüft wird.
- Kooperationsformen im Facility Management
- Merkmale, Vor- und Nachteile von Kooperationsformen
- Entwicklung eines Modells für eine Kooperationsstrategie
- Anwendung des Modells am Beispiel der FM-Alliance
- Erfolgsfaktoren für Kooperationsstrategien im Facility Management
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit dar. Sie erläutert den aktuellen Stand der Forschung und die Relevanz des Themas. Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen des Facility Management beleuchtet. Es werden die historische Entwicklung, Definitionen, Dimensionen und Ebenen des Facility Management sowie der Facility Management Markt und aktuelle Trends vorgestellt. Das dritte Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Kooperationsformen. Es werden die Definition des Begriffes Kooperation, die Ursachen, Ziele und Erfolgsfaktoren von Kooperationen sowie die einzelnen Kooperationsformen wie Vertragslose Zusammenarbeit, Kooperations- und Lizenzverträge, Franchising, Gemeinschaftsunternehmen, Joint Venture und virtuelle Organisationen und Unternehmensnetzwerke vorgestellt. Das vierte Kapitel widmet sich den Kooperationsstrategien im Facility Management. Es werden die strategischen Allianzen im Facility Management, die FM-Alliance als Beispiel einer strategischen Allianz, die Erfolgsfaktoren für Kooperationsstrategien im Facility Management sowie die Bedeutung von Vertrauen, Kommunikation, Führung, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in Kooperationen behandelt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Facility Management, Kooperationsformen, Strategische Allianzen, FM-Alliance, Erfolgsfaktoren, Vertrauen, Kommunikation, Führung, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Vorteile von Kooperationen im Facility Management?
Kooperationen schaffen Freiräume für Entwicklung, federn Risiken ab und ermöglichen die Nutzung von Synergien durch Spezialisierung.
Was ist die FM-Alliance?
Die FM-Alliance dient in der Arbeit als Praxisbeispiel für eine strategische Allianz, bei der verschiedene Partner ihre Leistungen bündeln.
Welche Rolle spielt Outsourcing im Facility Management?
Outsourcing ermöglicht die Konzentration auf das Kerngeschäft, reduziert Fixkosten und erhöht die Flexibilität des Unternehmens.
Was sind kritische Erfolgsfaktoren für FM-Kooperationen?
Zentrale Faktoren sind gegenseitiges Vertrauen, eine offene Kommunikation, klare Führung und die Fähigkeit zur Anpassung an Marktveränderungen.
Welche Kooperationsformen gibt es?
Die Arbeit unterscheidet unter anderem zwischen Lizenzverträgen, Franchising, Joint Ventures und virtuellen Organisationen.
- 3.1. Definition des Begriffes Kooperation
- Citar trabajo
- Dipl. Wirt.-Ing. Andreas Dittmar Weise (Autor), 2005, Kooperationsformen im Facility Management, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131148