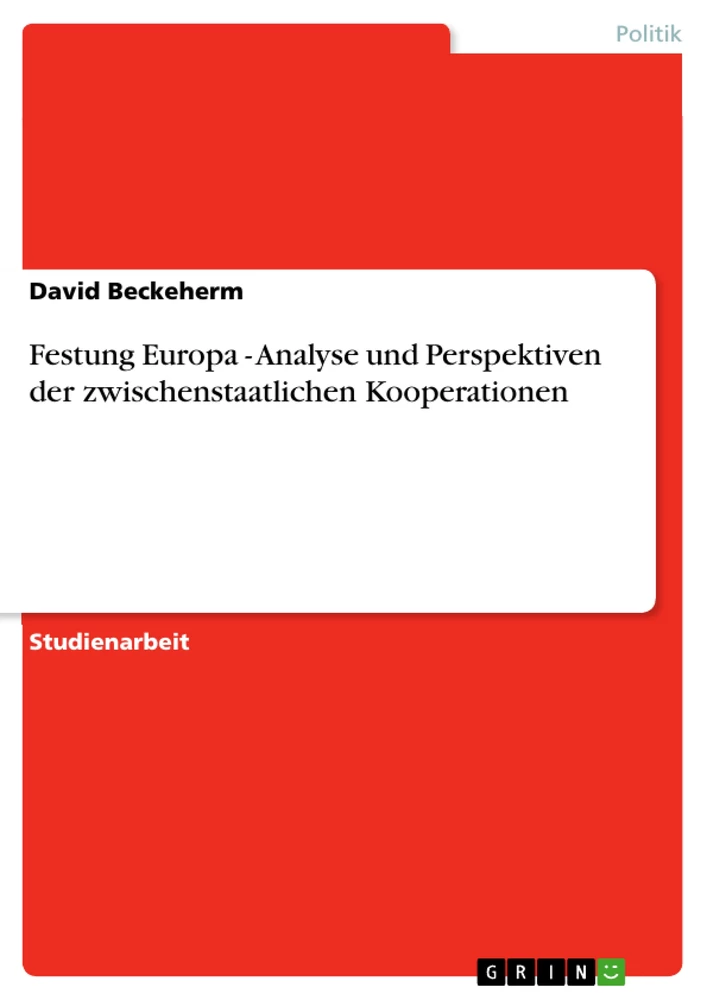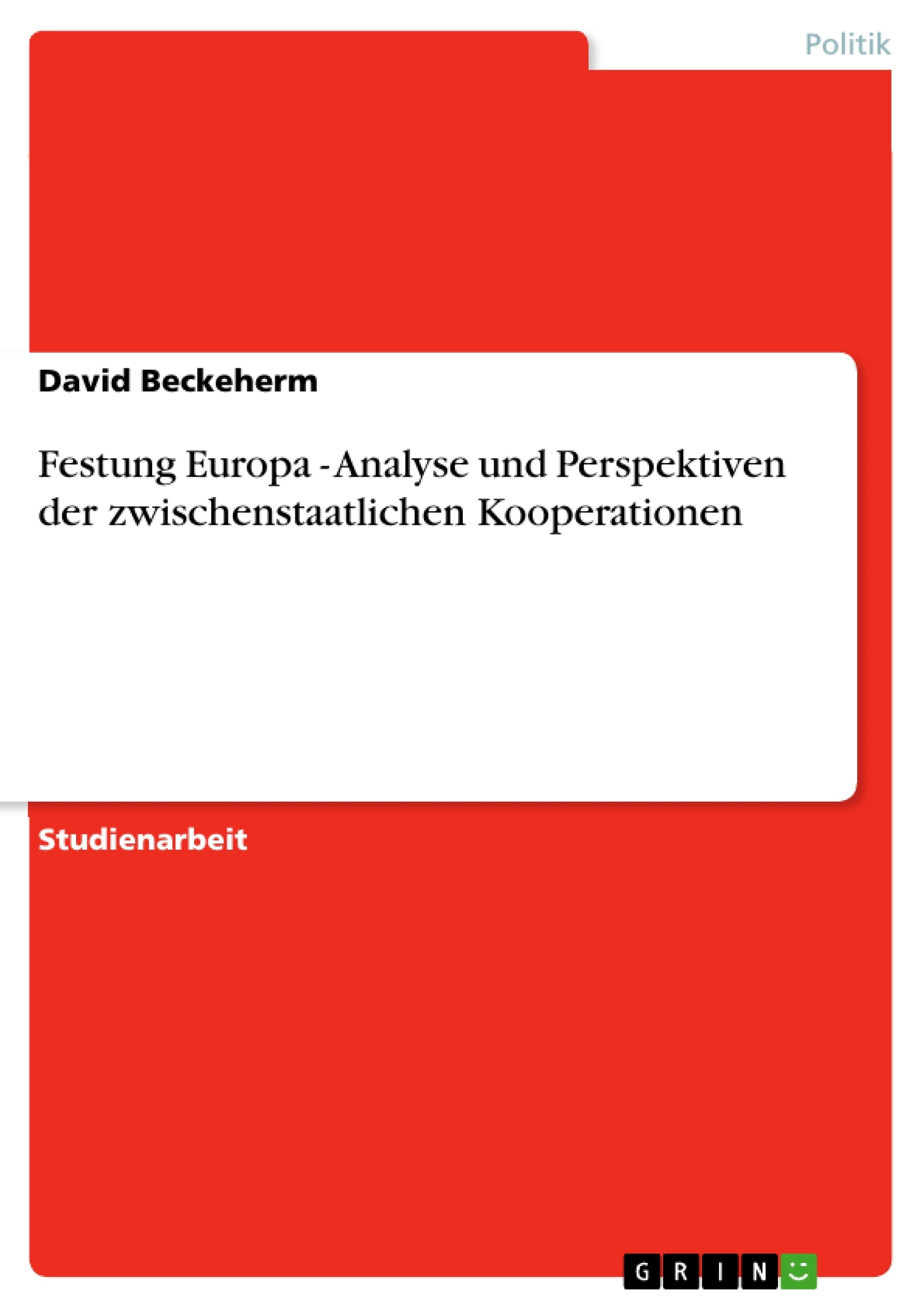Die hier vorliegende Arbeit wird sich mit der zwischenstaatlichen (Nicht-) Kooperation auf der Ebene der Migrationspolitik der Europäischen Union auseinandersetzen.
Das Stichwort der „Festung Europa“ ist momentan einer der Begriffe, der zum Schlagwort für Kritik an den bestehenden Zuständen geworden ist und für große Kontroversen sorgt.
Im ersten Teil meiner Arbeit lege ich die Grundlagen für das weitere Vorgehen. Der Status quo der zwischenstaatlichen Kooperation im ausgewählten Politikfeld wird beschrieben und theoretisch unterstützt.
In einem hochkomplexen System wie dem vorliegenden spielen natürlich immer die Interessen der einzelnen Nationalstaaten eine herausragende Rolle und sorgen für eine erhöhte Problematik bei der Entscheidungsfindung, da die Gesamtinteressen der EU gegenläufig zu denen des Nationalstaates sein können. Die Konsensfindung ist im Rahmen der Ausweitung der EU natürlich nicht einfacher geworden und ich werde versuchen, die verschiedenen Standpunkte der einzelnen Nationalstaaten innerhalb der EU deutlich zu machen. Da hier naturgemäß nicht auf jeden einzelnen Nationalstaat eingegangen werden kann, werde ich diese (soweit möglich) zu Gruppen zusammenfassen bzw. ausgewählte Vertreter dieser „Gruppen“ vorstellen und die Positionen vergleichen.
Im zweiten Teil gehe ich auf den Begriff der „Festung Europa“ ein und werde untersuchen, welche Entwicklungen zu dieser Begrifflichkeit führten und was die Ursachen für diese Entwicklungen sind.
Die Empirie und Praxisnähe wird durch die Betrachtung der Problematik der Migrationswilligen geleistet. Die Meldungen über missglückte Migrationsversuche sind nahezu täglich zu vernehmen, doch hinter jeder Meldung stecken individuelle Schicksale, auf die in dieser Arbeit jedoch nur streiflichtartig eingegangen werden kann.
Im dritten Teil meiner Arbeit werde ich Perspektiven für einen möglichen Wandel in der Migrationspolitik der EU darstellen. Die beiden unvereinbar scheinenden Pole der Abschottung und der Migration werden dabei einzeln betrachtet und gegenübergestellt.
Es wird zu überlegen sein, welchen Weg die EU einschlagen sollte bzw. könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aktuelle Formen der Migrationspolitik und der Zusammenarbeit in der EU
- Die EU im Kooperationsdilemma
- Von Melilla bis Lampedusa - Ausgewählte Beispiele
- „Festung Europa“
- Verschärfung der Einreise- und Migrationsbestimmungen
- Beispiele für die Problematik der Migrationswilligen
- Perspektiven des Wandels in der zwischenstaatlichen Migrationspolitik der EU
- Der Nationalstaat als Leitmaxime - Abschottung als Prinzip
- Migration als Chance – Integration und Ausgleich als Zielmarke
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die zwischenstaatliche Kooperation im Politikfeld der europäischen Migrationspolitik und untersucht die Entstehung des Begriffs „Festung Europa“. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Entscheidungsfindung in einem komplexen System, in dem die Interessen der einzelnen Nationalstaaten eine zentrale Rolle spielen. Die Arbeit setzt sich mit den verschiedenen Standpunkten der Nationalstaaten auseinander und untersucht die Ursachen für die Verschärfung der Einreise- und Migrationsbestimmungen.
- Analyse der zwischenstaatlichen Kooperation in der EU-Migrationspolitik
- Entstehung des Begriffs „Festung Europa“
- Herausforderungen der Entscheidungsfindung im Kontext nationaler Interessen
- Verschärfung der Einreise- und Migrationsbestimmungen
- Perspektiven für einen Wandel in der Migrationspolitik der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert den theoretischen Rahmen, der für die Analyse der zwischenstaatlichen Kooperation in der EU-Migrationspolitik verwendet wird. Der liberale Intergouvernementalismus von Andrew Moravcsik wird als theoretische Grundlage vorgestellt, wobei die drei Kernelemente des rationalen staatlichen Handelns, der liberalen Theorie der nationalen Präferenzbildung und der intergouvernementalistischen Analyse zwischenstaatlicher Verhandlungen erläutert werden.
Das Kapitel „Aktuelle Formen der Migrationspolitik und der Zusammenarbeit in der EU“ beleuchtet die Herausforderungen der Entscheidungsfindung in der EU-Migrationspolitik. Es wird gezeigt, wie die Interessen der einzelnen Nationalstaaten die Kooperation erschweren können und wie die Konsensfindung im Rahmen der EU-Erweiterung komplexer geworden ist. Die verschiedenen Standpunkte der Nationalstaaten werden vorgestellt und in Gruppen zusammengefasst.
Das Kapitel „Festung Europa“ untersucht die Entwicklungen, die zu diesem Begriff geführt haben. Die Ursachen für die Verschärfung der Einreise- und Migrationsbestimmungen werden analysiert und die Problematik der Migrationswilligen wird anhand von Beispielen beleuchtet.
Das Kapitel „Perspektiven des Wandels in der zwischenstaatlichen Migrationspolitik der EU“ stellt zwei gegensätzliche Perspektiven für die Zukunft der EU-Migrationspolitik vor: die Abschottung und die Migration als Chance. Die Vor- und Nachteile beider Ansätze werden diskutiert und es wird überlegt, welchen Weg die EU einschlagen sollte.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die zwischenstaatliche Kooperation, die Migrationspolitik der Europäischen Union, „Festung Europa“, die Interessen der Nationalstaaten, die Herausforderungen der Entscheidungsfindung, die Verschärfung der Einreise- und Migrationsbestimmungen, die Problematik der Migrationswilligen, die Perspektiven des Wandels in der Migrationspolitik der EU, die Abschottung und die Migration als Chance.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Festung Europa“?
Der Begriff ist ein Schlagwort für die Kritik an der restriktiven Migrationspolitik der EU, die auf Abschottung und Verschärfung der Einreisebestimmungen setzt.
Warum fällt es der EU schwer, eine gemeinsame Migrationspolitik zu finden?
Die Interessen der Nationalstaaten sind oft gegenläufig zu den Gesamtinteressen der EU. Nationale Souveränität und Sicherheitsbedenken erschweren die Konsensfindung massiv.
Was ist der liberale Intergouvernementalismus?
Es ist eine Theorie von Andrew Moravcsik, die besagt, dass EU-Entscheidungen das Ergebnis rationaler Verhandlungen zwischen Nationalstaaten sind, die ihre eigenen Präferenzen verfolgen.
Welche Rolle spielen Orte wie Lampedusa oder Melilla?
Diese Orte dienen als Beispiele für das „Kooperationsdilemma“ der EU und verdeutlichen die menschliche Problematik und die Schicksale der Migrationswilligen an den Außengrenzen.
Welche Perspektiven gibt es für einen Wandel in der Politik?
Die Arbeit stellt zwei Pole gegenüber: Die Fortführung der Abschottung (Nationalstaat als Maxime) versus Migration als Chance (Integration und Ausgleich).
- Arbeit zitieren
- David Beckeherm (Autor:in), 2007, Festung Europa - Analyse und Perspektiven der zwischenstaatlichen Kooperationen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131228