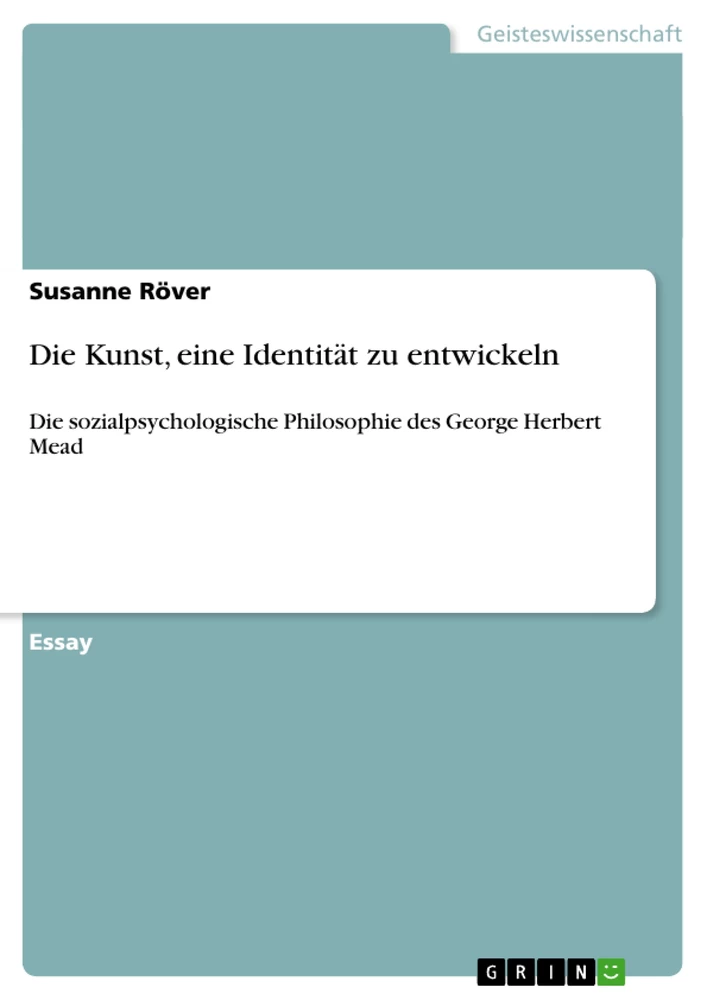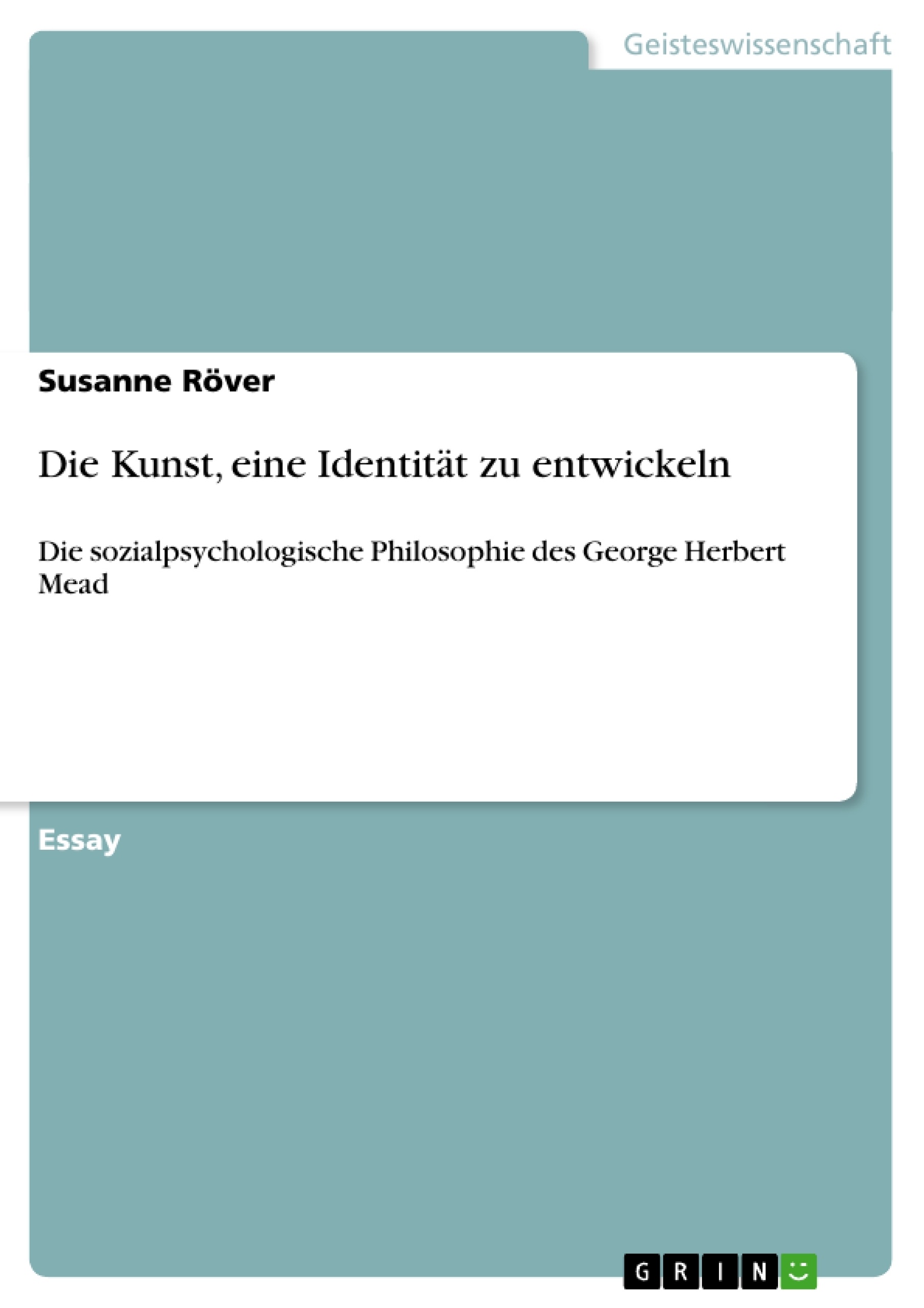Meads Versuch, den komplizierten Prozess der Identitätsbildung zu beschreiben und diesen auf die dringenden sozialwissenschaftliche Fragen hin anwendbar zu machen, stellt eine beispiellose Leistung dar.
Ihm gelang damit nicht nur die Verknüpfung von individuellem und sozialem Handeln, sondern auch die Bewusstmachung der Qualitätsstufen dieses Prozesses. Das Individuum steht der Gesellschaft gegenüber wie der Mikro- dem Makrokosmos. Beide sind voneinander abhängig und lassen demzufolge Rückschlüsse aufeinander zu. Indem Mead nun den biologischen Entwicklungsprozess mit dem gesellschaftlichen vergleicht und ersteren damit ergänzt bzw. erweitert, können nun auch allgemeine menschliche individuelle Bedürfnisse und Handlungsmuster mit den gesellschaftlichen verglichen und in Beziehung gesetzt werden. Das qualitative Verständnis gegenüber gesellschaftlichen Prozessen, die durch das Individuum erzeugt werden, aber auch auf selbiges einwirken können, kann so besser vermittelt werden. Wenn es also darum geht, Lösungen für gesellschaftliche Konflikte zu finden, sind genau diese Rückschlüsse wichtig. Denn der Mensch ist aufgrund seiner Intelligenz in der Lage, sein Verhalten nach objektiven und auch subjektiven Gesichtspunkten zu erkennen, zu unterscheiden und schließlich zu reflektieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Meads sozialwissenschaftliche Einordnung
- Biographie
- Meads Sozialpsychologie und Zeitphilosophie
- Bedeutung von Meads Arbeit
- Meads Identitätsbegriff
- Erfahrung
- Sprache Kommunikation - Kultur
- I-me-Dialektik
- Phasen der Identitätsbildung: Spiel und Wettkampf
- Identität. Ein Spiegel der Gesellschaft?
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der sozialpsychologischen Philosophie von George Herbert Mead und untersucht, wie er den Prozess der Identitätsbildung aus sozialwissenschaftlicher Perspektive betrachtet. Die Arbeit analysiert Meads Ansatz im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen des frühen 20. Jahrhunderts und beleuchtet, wie er die Verknüpfung von christlichen Wertvorstellungen und sozialpsychologischen Fakten in den Vordergrund stellt.
- Meads sozialwissenschaftliche Einordnung und seine Biographie
- Meads Identitätsbegriff und seine zentralen Elemente
- Die Rolle von Sprache, Kommunikation und Kultur in der Identitätsbildung
- Die Phasen der Identitätsbildung: Spiel und Wettkampf
- Die Beziehung zwischen Identität und Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext von Meads Arbeit vor und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der fortschreitenden Individualisierung und den gesellschaftlichen Veränderungen des frühen 20. Jahrhunderts ergaben. Sie zeigt, wie Meads Ansatz versucht, die Verknüpfung von christlichen Wertvorstellungen und sozialpsychologischen Fakten zu ermöglichen.
Der zweite Abschnitt befasst sich mit Meads sozialwissenschaftlicher Einordnung. Er beleuchtet seine Biographie, seine wichtigsten Einflüsse und seine Rolle als Vertreter des amerikanischen Pragmatismus und der Chicagoer Schule. Dieser Abschnitt zeigt, wie Meads Arbeit die Entwicklung des Identitätsbegriffs in der Soziologie beeinflusst hat.
Der dritte Abschnitt widmet sich Meads Identitätsbegriff. Er analysiert die zentralen Elemente von Meads Theorie, wie Erfahrung, Sprache, Kommunikation und Kultur, und erläutert die I-me-Dialektik. Dieser Abschnitt beleuchtet auch die Phasen der Identitätsbildung: Spiel und Wettkampf, und untersucht die Beziehung zwischen Identität und Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die sozialpsychologische Philosophie, George Herbert Mead, Identitätsbildung, Sozialisation, Sprache, Kommunikation, Kultur, I-me-Dialektik, Spiel, Wettkampf, Gesellschaft, christliche Wertvorstellungen, amerikanischer Pragmatismus, Chicagoer Schule.
Häufig gestellte Fragen zur Identitätstheorie nach Mead
Was ist George Herbert Meads Identitätsbegriff?
Mead beschreibt Identität als einen sozialen Prozess, der durch Interaktion, Sprache und die Übernahme der Perspektive anderer entsteht.
Was bedeutet die „I-me-Dialektik“?
Das „I“ (Ich) steht für die impulsive, subjektive Seite, während das „me“ (Mich) das soziale Bild darstellt, das andere von uns haben. Identität entsteht im Dialog dieser beiden Seiten.
Was sind die Phasen „Spiel“ (Play) und „Wettkampf“ (Game)?
Im „Play“ lernt das Kind, einzelne Rollen nachzuahmen. Im „Game“ lernt es, die Regeln und Perspektiven der gesamten Gruppe (den „verallgemeinerten Anderen“) zu verstehen.
Welche Rolle spielt die Sprache bei der Identitätsbildung?
Sprache ermöglicht signifikante Symbole, durch die wir unser eigenes Verhalten reflektieren und uns selbst zum Objekt unserer Erfahrung machen können.
Ist die Identität laut Mead ein Spiegel der Gesellschaft?
Ja, für Mead sind Individuum und Gesellschaft untrennbar miteinander verbunden; das Individuum reflektiert gesellschaftliche Prozesse und wirkt gleichzeitig auf sie ein.
- Quote paper
- Susanne Röver (Author), 2008, Die Kunst, eine Identität zu entwickeln , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131245