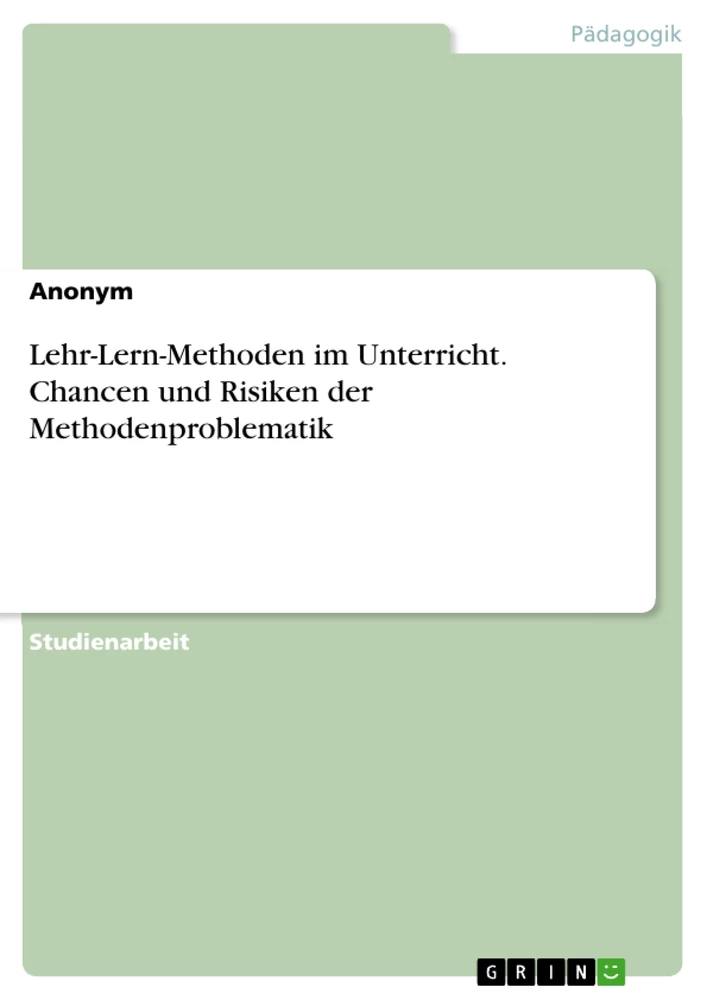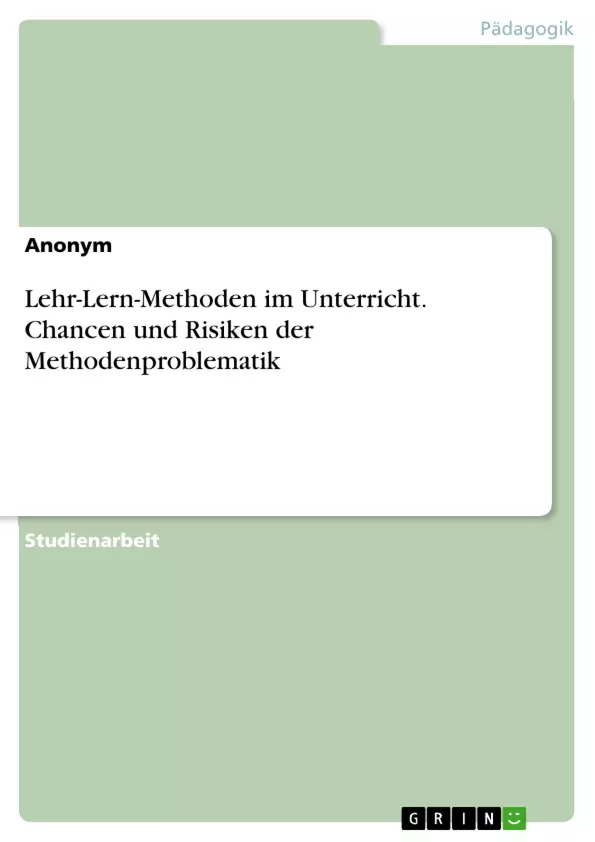Die Hausarbeit erarbeitet eine Systematisierung von Lehr-Lern-Methoden. Es wird zunächst eine kurze Begriffsklärung der verschiedenen systematischen Dimensionen vorgenommen, bei der sowohl der Begriff Methode als auch die der Zielerreichung, der Sachbegegnung und der Lernhilfe definiert werden. Mit diesen Definitionen wird eine gute Basis geschaffen, um näher in die Thematik eintauchen zu können.
Anschließend wird es um die konkrete Umsetzung der verschiedenen Dimensionen gehen. Es wird mit der Zielerreichung durch Methode begonnen, wobei gezielt die Voraussetzungen und Folgen des Ziel-/Mittel-Denkens in der Didaktik sowie der Beitrag von Methoden zur Erreichung von Lernzielen thematisiert wird.
Es folgt die Sachbegegnung mit Methode, bei der die thematische Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Inhalt und Methode sowie den Lernmethoden als Lernhilfen im Vordergrund stehen. Der thematische Hauptteil endet mit der Lernhilfe als Methode, bei der es darum geht, wie Lehren sich am Lernen orientieren kann und welche Folgen dies hat. Dazu werden die Begriffe Lehren und Lernen näher erläutert und sowohl der Erfolgsbegriff als auch der Absichtsbegriff zur Erklärung hinzugezogen.
Im nächsten Abschnitt wird es um eine kritische Auseinandersetzung mit den verschiedenen systematischen Dimensionen gehen. Hier werden neben den positiven Chancen und Möglichkeiten dieser Methoden, auch die Risiken und Problematiken der Lehr- und Lernmethoden dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Systematische Dimensionen
- Begriffsklärung
- Methode
- Dimension Zielerreichung
- Dimension Sachbegegnung
- Dimension Lernhilfe
- Zielerreichung durch Methode
- Sachbegegnung mit Methode
- Lernhilfe mit Methode
- Begriffsklärung
- Chancen und Risiken der systematischen Dimensionen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der systematischen Dimension der Methodenproblematik im Kontext von Lehr- und Lernmethoden. Sie zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die verschiedenen Dimensionen zu entwickeln und die Chancen sowie Risiken dieser Perspektiven zu analysieren.
- Definition und Abgrenzung verschiedener systematischer Dimensionen
- Analyse der Rolle von Methoden bei der Erreichung von Lernzielen
- Untersuchung des Verhältnisses von Inhalt und Methode im Hinblick auf die Sachbegegnung
- Betrachtung der Methode als Lernhilfe und deren Einfluss auf das Lernen der Schüler*innen
- Bewertung der Chancen und Risiken der systematischen Dimensionen im schulischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Relevanz der systematischen Dimension der Methodenproblematik für die Ausbildung von Lehrkräften heraus und formuliert die Leitfrage der Arbeit.
- Systematische Dimensionen: Dieses Kapitel definiert die verschiedenen Dimensionen der Methodenproblematik, einschließlich Methode, Zielerreichung, Sachbegegnung und Lernhilfe.
- Chancen und Risiken der systematischen Dimensionen: Dieser Abschnitt analysiert die positiven Aspekte und Herausforderungen, die mit der systematischen Dimension von Lehr- und Lernmethoden verbunden sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die systematische Dimension der Methodenproblematik in Bezug auf Lehr- und Lernmethoden. Sie behandelt Themen wie Zielerreichung, Sachbegegnung, Lernhilfe, methodische Organisation von Lehren und Lernen, Chancen und Risiken der methodischen Gestaltung von Unterricht.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Lehr-Lern-Methoden im Unterricht. Chancen und Risiken der Methodenproblematik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1312602