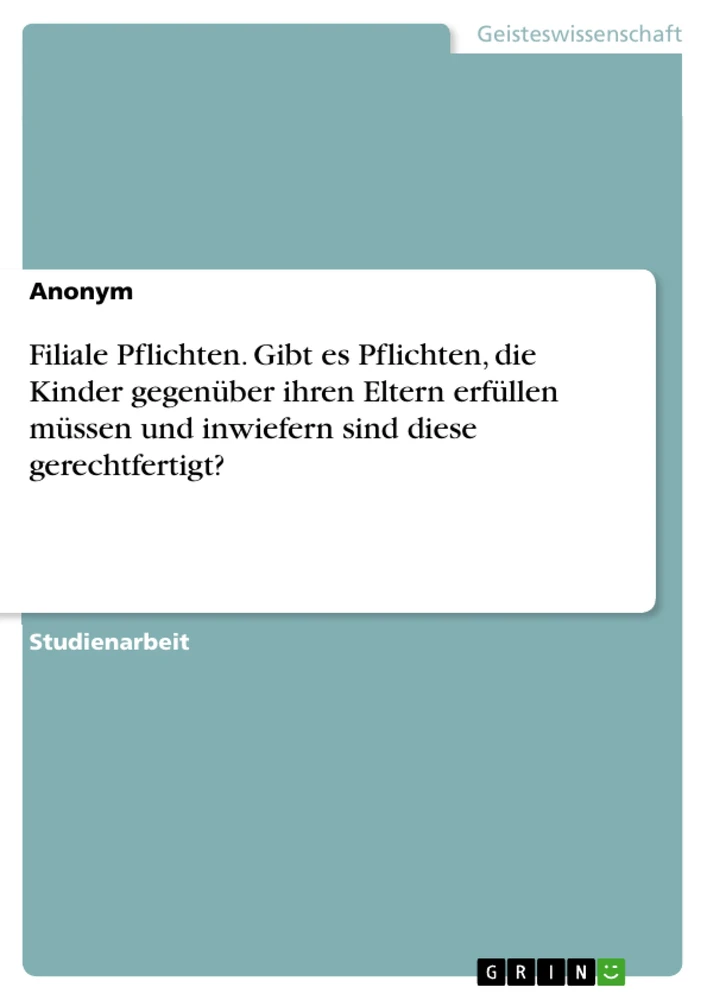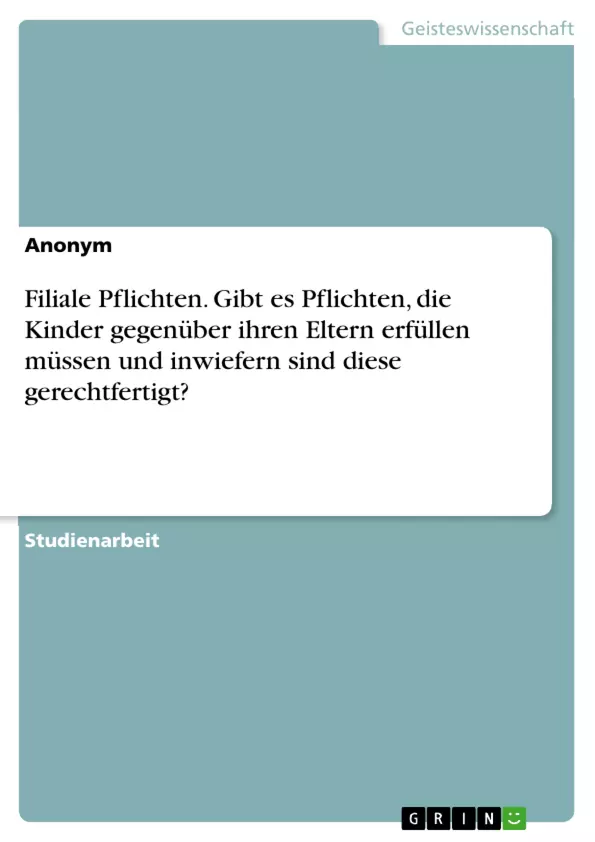In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob es Pflichten gibt, die Kinder gegenüber ihren Eltern zu erfüllen haben und inwiefern diese gerechtfertigt sind. Dabei ist von Bedeutung, inwiefern sie sich von generellen, moralischen Pflichten unterscheiden, ob Parteilichkeit zu tolerieren ist und ob sie den speziellen Attributen der Eltern-Kind-Beziehung (Liebe, Unfreiwilligkeit, Abhängigkeit) gerecht werden.
Zunächst werden drei Theorien skizziert, die einen generellen Überblick über die dominierenden moralischen Denkweisen geben sollen. Dabei werden zu Beginn eine kurze Definition der jeweiligen Theorie formuliert und im nächsten Schritt Alternationen gewisser Vertreter vorgestellt.
Die Schuldentheorie ist der älteste der drei Ansätze, sie wurde bereits von Aristoteles vertreten, findet jedoch noch heute Anklang, wie beispielsweise bei Narveson. Die Dankbarkeitstheorie ist derzeit die populärste Theorie, doch gilt es, zu untersuchen, inwiefern sie Ähnlichkeit mit einem reziproken Modell hat. Jane English entwarf die Freundschaftstheorie als eine mögliche Alternative zu den beiden oben genannten Theorien.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung.
- 2 Drei zentrale Theorien und ihre Schwächen
- 2.1 Die Schuldentheorie.
- 2.2 Die Dankbarkeitstheorie..
- 2.3 Die Freundschaftstheorie.......
- 3 Analyse..
- 3.1 Kritik
- 3.2 Ein Vorschlag.
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Kinder gegenüber ihren Eltern moralische Pflichten zu erfüllen haben und inwiefern diese gerechtfertigt sind. Dabei steht insbesondere im Vordergrund, wie sich diese Pflichten von allgemeinen moralischen Verpflichtungen unterscheiden, ob Parteilichkeit gegenüber den Eltern gerechtfertigt ist und ob sie den besonderen Merkmalen der Eltern-Kind-Beziehung (Liebe, Unfreiwilligkeit, Abhängigkeit) gerecht werden.
- Definition und Abgrenzung von filialen Pflichten
- Analyse und Kritik gängiger Theorien zur Begründung von filialen Pflichten
- Entwicklung eines alternativen Ansatzes zur Rechtfertigung von filialen Pflichten
- Bewertung der Rolle von Parteilichkeit und Abhängigkeit in der Eltern-Kind-Beziehung
- Bedeutung des demografischen Wandels und der gesellschaftlichen Erwartungen im Kontext von filialen Pflichten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und erläutert die Problematik von filialen Pflichten im Kontext des demografischen Wandels und der sich verändernden Familienstrukturen. Sie führt in die Forschungsfrage ein und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit.
- Drei zentrale Theorien und ihre Schwächen: Dieses Kapitel präsentiert drei gängige Theorien zur Begründung von filialen Pflichten: die Schuldentheorie, die Dankbarkeitstheorie und die Freundschaftstheorie. Es wird jeweils eine kurze Definition der Theorie gegeben und verschiedene Vertreter vorgestellt.
- Analyse: Das Kapitel „Analyse“ befasst sich kritisch mit den drei zuvor vorgestellten Theorien. Es werden die Schwächen der Theorien herausgearbeitet und ihre Stichhaltigkeit im Hinblick auf die Rechtfertigung von filialen Pflichten überprüft.
Schlüsselwörter
Filiale Pflichten, Eltern-Kind-Beziehung, Schuldentheorie, Dankbarkeitstheorie, Freundschaftstheorie, Parteilichkeit, Abhängigkeit, demografischer Wandel, gesellschaftliche Erwartungen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Filiale Pflichten. Gibt es Pflichten, die Kinder gegenüber ihren Eltern erfüllen müssen und inwiefern sind diese gerechtfertigt?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1312835