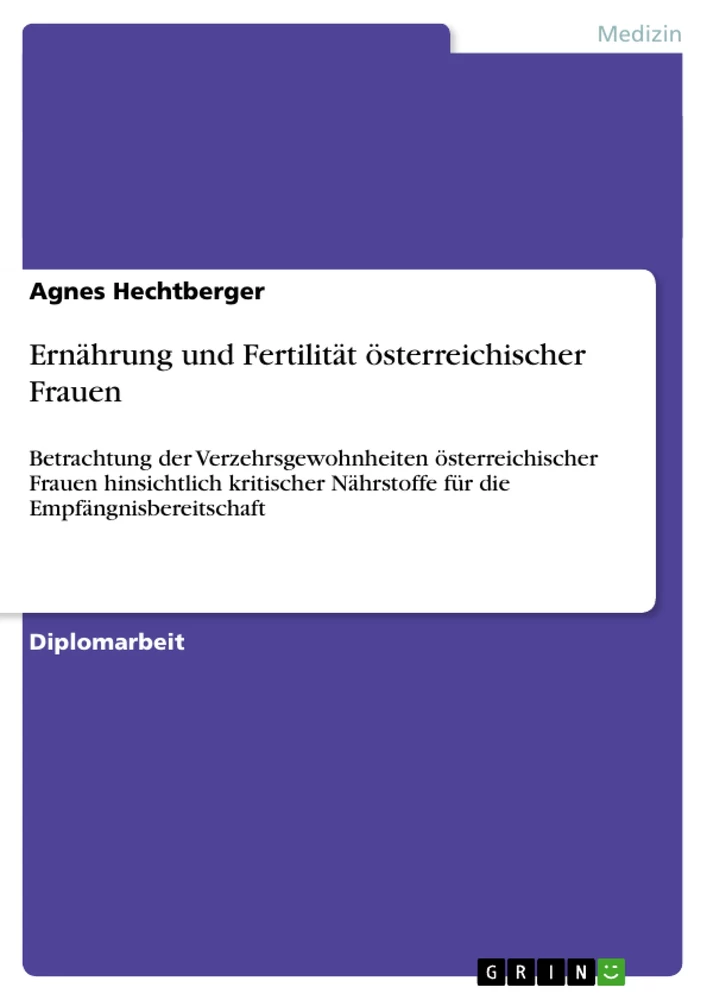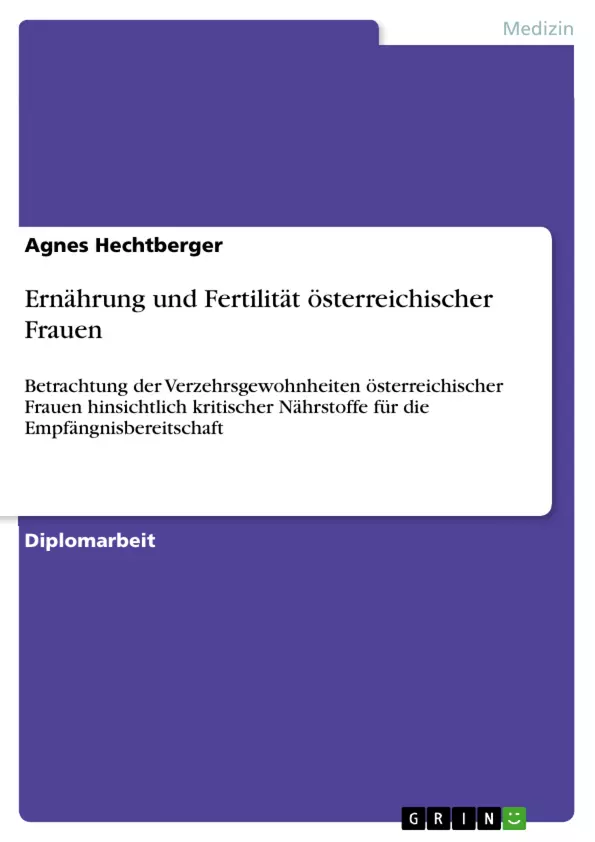Immer mehr Paare im reproduktionsfähigen Alter leiden unter ungewollter
Kinderlosigkeit. Da der Wunsch nach eigenen Kindern immer öfter erst in einem höheren
Lebensalter auftritt, ist diese Tendenz steigend. Es gibt eine Vielzahl an
Behandlungsmöglichkeiten für Personen, bei denen trotz Kinderwunsch eine Schwangerschaft
ausbleibt. Bei einer solchen Therapie wird jedoch nicht immer auch die Ursache der Sterilität
behandelt. Oft bleibt diese sogar unklar. Obwohl die gynäkologischen Behandlungsmethoden
eines unerfüllten Kinderwunsches oft sehr aufwändig und kostspielig sind, ist der Erfolg nicht
garantiert. Die Erfolgsquote der verschiedenen In vitro-Fertilisations-Zentren liegt zwischen
32 und 36 Prozent, wobei die gewünschte Schwangerschaft teils erst nach zwei, drei oder
mehr Versuchen vorliegt. Dies ist zwar eine große Errungenschaft der medizinischen
Wissenschaft und Forschung, für die restlichen zwei Drittel der behandelten Paare allerdings
wenig zufrieden stellend. (Kern 2008, S.2ff)
Es stellt sich daher die Frage, ob es andere Behandlungsmethoden gibt, die alleine oder
in Kombination mit medizinischen Verfahren die Reproduktionsfähigkeit verbessern können.
Hier ist besonders die Änderung von Umwelt- und Lebensstilfaktoren von Interesse, also auch
eine Optimierung der Ernährung. Viele Studien belegen, dass nicht nur ein idealer
Gewichtsstatus und die optimale Körperzusammensetzung, sondern auch die Wahl der
Energielieferanten, die Versorgung mit bestimmten Mikronährstoffen und Antioxidantien,
sowie ein eingeschränkter Konsum von Koffein und Alkohol für die Fruchtbarkeit von
Bedeutung sind. Obwohl auch die Ernährung des Mannes Einfluss auf die Fertilität hat, spielt
dieser Faktor bei Frauen eine viel wichtigere Rolle, da sie auch körperlich dazu fähig sein
müssen, ein Kind neun Monate auszutragen. Wie meine Recherche im Vorfeld dieser Arbeit
ergab, wird in Österreich bei der Behandlung von Frauen mit Kinderwunsch oft nicht auf den
Ernährungsstatus geachtet. In anderen Ländern – besonders den USA – findet sich
dahingehend viel mehr Literatur. Auch in China, wo es großteils nur ein Kind pro Familie
gibt, wird sehr auf die Ernährung und einen gesunden Lebensstil geachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Fertilität, Subfertilität, Sterilität und Infertilität
- Epidemiologie
- Die Physiologie der weiblichen Fertilität
- Ursachen der Unfruchtbarkeit
- Anatomische Anomalitäten
- Hormonelle Störungen
- Sonstige Ursachen
- Behandlungsmethoden
- Operative Eingriffe
- Ovulationsinduktion
- Intrauterine Insemination
- In vitro-Fertilisation
- Energieversorgung
- Einfluss des Ernährungszustands auf die Reproduktionsfähigkeit
- Leptin
- Insulin
- Steroide
- Ghrelin
- Neuropeptid Y
- Untergewicht
- Übergewicht
- Einfluss des Ernährungszustands auf die Reproduktionsfähigkeit
- Makronährstoffe
- Eiweiß
- Fett
- Fettsäurezusammensetzung
- Kohlenhydrate
- Zucker
- Flüssigkeitszufuhr
- Koffein
- Alkohol
- Mikronährstoffe
- Vitamine
- Vitamin A Retinol
- Folsäure
- Vitamin D
- Vitamin E - Tocopherol
- Mineralstoffe
- Calcium
- Eisen
- Jod
- Magnesium
- Vitamine
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Ernährung und Fertilität bei österreichischen Frauen. Ziel ist es, die Verzehrsgewohnheiten hinsichtlich kritischer Nährstoffe für die Empfängnisbereitschaft zu betrachten und deren Einfluss auf die Fruchtbarkeit zu analysieren.
- Einfluss des Ernährungszustands (Gewicht, Körperzusammensetzung) auf die Reproduktionsfähigkeit
- Bedeutung von Makronährstoffen (Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate) für die Fertilität
- Rolle von Mikronährstoffen (Vitamine, Mineralstoffe) und deren Einfluss auf die Empfängnisbereitschaft
- Auswirkungen von Koffein- und Alkoholkonsum auf die Fruchtbarkeit
- Vergleich der Ernährungsgewohnheiten österreichischer Frauen mit denen anderer Länder
Zusammenfassung der Kapitel
Fertilität, Subfertilität, Sterilität und Infertilität: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in die Konzepte der Fertilität, Subfertilität, Sterilität und Infertilität. Es beleuchtet die epidemiologischen Aspekte, die Physiologie der weiblichen Fertilität und die verschiedenen Ursachen von Unfruchtbarkeit, darunter anatomische Anomalitäten, hormonelle Störungen und andere Faktoren. Darüber hinaus werden verschiedene Behandlungsmethoden wie operative Eingriffe, Ovulationsinduktion, intrauterine Insemination und In-vitro-Fertilisation detailliert beschrieben, inklusive ihrer Erfolgsquoten und Grenzen. Die Darstellung der verschiedenen Ursachen und Behandlungsmethoden unterstreicht die Komplexität des Themas und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes bei der Behandlung von Kinderwunschproblemen.
Energieversorgung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Einfluss des Ernährungszustands auf die Reproduktionsfähigkeit. Es untersucht detailliert die Rolle von Hormonen wie Leptin, Insulin, Steroiden, Ghrelin und Neuropeptid Y und deren Interaktion mit dem Energiehaushalt und der Fruchtbarkeit. Der Einfluss von Unter- und Übergewicht auf die Fertilität wird umfassend behandelt, wobei die komplexen Zusammenhänge zwischen Energiebilanz, Hormonhaushalt und Reproduktion hervorgehoben werden. Die Diskussion der verschiedenen hormonellen Faktoren und ihrer Auswirkungen auf den Körper liefert ein tiefgreifendes Verständnis der physiologischen Prozesse, die die Fruchtbarkeit beeinflussen.
Makronährstoffe: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung von Makronährstoffen – Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten – für die weibliche Fertilität. Es analysiert die Rolle der einzelnen Makronährstoffgruppen und deren Einfluss auf den Hormonhaushalt und den Stoffwechsel. Die Bedeutung der Fettsäurezusammensetzung in der Ernährung und der Einfluss von Zuckerkonsum auf die Fruchtbarkeit werden ausführlich diskutiert. Die Ausführungen betonen die Notwendigkeit einer ausgewogenen Ernährung mit der richtigen Zusammensetzung an Makronährstoffen für eine optimale Reproduktionsfähigkeit. Die Kapitelteile arbeiten die komplexen Beziehungen zwischen Ernährung und physiologischen Prozessen heraus, die die Fruchtbarkeit beeinflussen.
Flüssigkeitszufuhr: Das Kapitel untersucht den Einfluss von Flüssigkeitszufuhr, insbesondere den Konsum von Koffein und Alkohol, auf die Fertilität. Es werden die negativen Auswirkungen eines übermäßigen Konsums beider Substanzen auf die Fruchtbarkeit detailliert beschrieben und wissenschaftliche Belege dafür angeführt. Die Diskussion umfasst die Mechanismen, durch die Koffein und Alkohol die Reproduktionsfähigkeit beeinträchtigen können, und betont die Wichtigkeit eines moderaten Konsums oder gar des Verzichts während des Kinderwunsches. Die Einbeziehung von konkreten Beispielen und Daten verdeutlicht die Relevanz dieser Faktoren für die Behandlung der Kinderlosigkeit.
Mikronährstoffe: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle von Mikronährstoffen, darunter Vitamine (Vitamin A, Folsäure, Vitamin D, Vitamin E) und Mineralstoffe (Calcium, Eisen, Jod, Magnesium), für die weibliche Fertilität. Es analysiert die essentiellen Funktionen dieser Mikronährstoffe im Körper und deren Einfluss auf die Reproduktionsfähigkeit. Mängel an bestimmten Mikronährstoffen und deren Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit werden detailliert untersucht, und die Bedeutung einer ausreichenden Versorgung mit diesen Nährstoffen wird hervorgehoben. Die Ausführungen liefern eine umfassende Übersicht über die komplexe Interaktion von Mikronährstoffen und ihrer Bedeutung für den Fortpflanzungsprozess.
Schlüsselwörter
Fertilität, Unfruchtbarkeit, Ernährung, Reproduktionsfähigkeit, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, Koffein, Alkohol, Gewichtsstatus, Hormonhaushalt, Österreichische Frauen, In-vitro-Fertilisation, Ovulationsinduktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Ernährung und Fertilität bei österreichischen Frauen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Ernährung und Fertilität bei österreichischen Frauen. Sie analysiert den Einfluss von Ernährungsgewohnheiten und Nährstoffzufuhr auf die Fruchtbarkeit.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den Einfluss des Ernährungszustands (Gewicht, Körperzusammensetzung), die Bedeutung von Makronährstoffen (Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate), die Rolle von Mikronährstoffen (Vitamine, Mineralstoffe), die Auswirkungen von Koffein- und Alkoholkonsum, und einen Vergleich der Ernährungsgewohnheiten österreichischer Frauen mit denen anderer Länder. Zusätzlich werden Fertilität, Subfertilität, Sterilität und Infertilität, inklusive verschiedener Behandlungsmethoden, umfassend erläutert.
Welche Aspekte der Fertilität werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Aspekte der Fertilität, darunter die Epidemiologie von Fruchtbarkeitsproblemen, die Physiologie der weiblichen Fertilität, Ursachen der Unfruchtbarkeit (anatomische Anomalitäten, hormonelle Störungen etc.) und verschiedene Behandlungsmethoden wie operative Eingriffe, Ovulationsinduktion und In-vitro-Fertilisation.
Welche Rolle spielen Makronährstoffe für die Fertilität?
Die Arbeit analysiert die Bedeutung von Eiweiß, Fett (inkl. Fettsäurezusammensetzung) und Kohlenhydraten für die weibliche Fertilität und deren Einfluss auf den Hormonhaushalt und den Stoffwechsel. Der Einfluss von Zuckerkonsum wird ebenfalls diskutiert.
Welche Mikronährstoffe sind wichtig für die Fruchtbarkeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Vitaminen (A, Folsäure, D, E) und Mineralstoffen (Calcium, Eisen, Jod, Magnesium) für die weibliche Fertilität. Es werden die essentiellen Funktionen dieser Mikronährstoffe und deren Auswirkungen auf die Reproduktionsfähigkeit detailliert beschrieben.
Welchen Einfluss haben Koffein und Alkohol auf die Fertilität?
Die Arbeit beschreibt die negativen Auswirkungen eines übermäßigen Konsums von Koffein und Alkohol auf die Fruchtbarkeit und erläutert die zugrundeliegenden Mechanismen.
Wie wird der Ernährungszustand in Bezug zur Fertilität gesetzt?
Die Arbeit untersucht detailliert den Einfluss von Unter- und Übergewicht auf die Fertilität, inklusive der Rolle von Hormonen wie Leptin, Insulin, Steroiden, Ghrelin und Neuropeptid Y.
Gibt es einen Vergleich mit anderen Ländern?
Ja, die Arbeit vergleicht die Ernährungsgewohnheiten österreichischer Frauen mit denen anderer Länder.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fertilität, Unfruchtbarkeit, Ernährung, Reproduktionsfähigkeit, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, Koffein, Alkohol, Gewichtsstatus, Hormonhaushalt, Österreichische Frauen, In-vitro-Fertilisation, Ovulationsinduktion.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Arbeit enthält Kapitelzusammenfassungen, die einen detaillierten Überblick über die einzelnen Themenbereiche bieten (siehe Inhaltsverzeichnis).
- Quote paper
- Agnes Hechtberger (Author), 2009, Ernährung und Fertilität österreichischer Frauen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131387