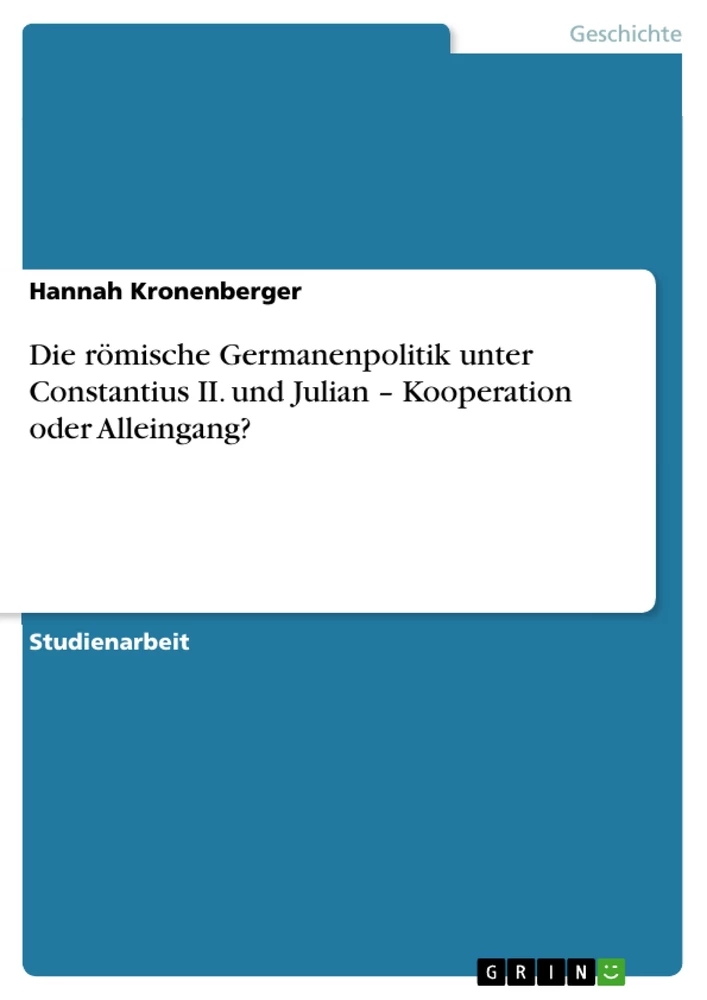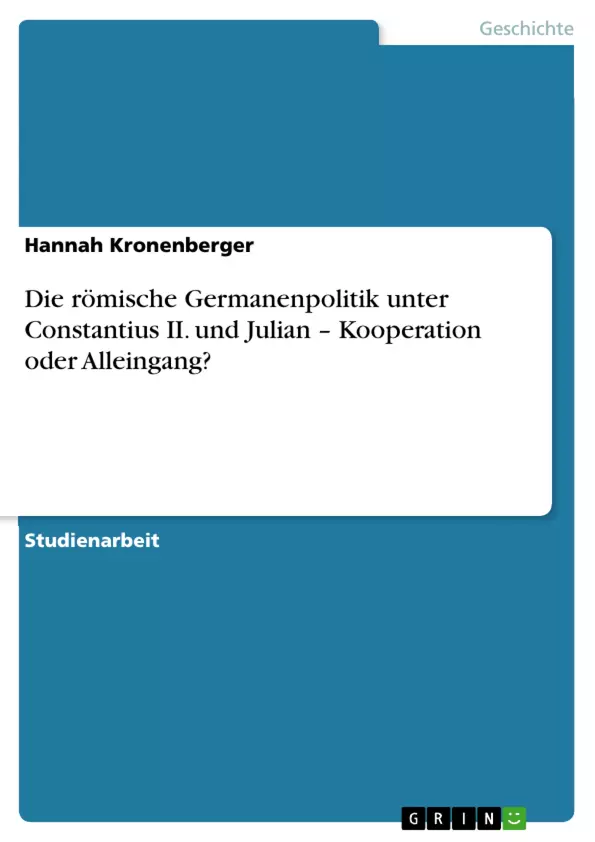Wenn man sich etwas ausführlicher mit den Geschehnissen des 4. Jahrhunderts in Gallien beschäftigt, kommt man nicht umhin zu bemerken, dass Constantius II. in sämtlichen Quellenbeschreibungen relativ schlecht, der vielgepriesene „Philosophenkaiser“ Julian jedoch ausgesprochen gut wegkommt. Schaut man sich die Ereignisgeschichte an, ist diese Darstellung der Quellen allerdings nicht so ohne weiteres zu verstehen. Warum beispielsweise wird Julian, obwohl der doch trotz anfänglicher Erfolge in Gallien einen Großteil der römischen Armee in Persien in den Untergang geführt hat, als fähiger Feldherr dargestellt? Und warum wird im Gegensatz hierzu dem Constantius trotz seiner Siege über Schapur II. in der gängigen Sekundärliteratur unterstellt, er habe aus Furcht vor einer eventuellen Niederlage und deren Verantwortung seine Feldherrren vorgeschickt? Entsprechen die in den Quellen öfters erhobenen Vorwürfe, Constantius II. habe Julian aus unlauteren Motiven heraus zum Caesaren ernannt der Wahrheit? Und ging die Erhebung des Julian zum Augustus – ein Ereignis, dass nach allen damals gängigen Definitionen nur als Usurpation angesehen werden kann – in der Tat allein und ohne Einverständnis seiner selbst von den Soldaten aus? Diese Fragen und die allgemeine Quellenlage lassen auf vielfältige Konflikte zwischen Julian und Constantius II. schließen.
Die Fragen, die in dieser Arbeit diskutiert wird, lauten: Inwieweit wirkten sich diese Konflikte nun auf die gallisch-römische “Germanen-Politik“ des 4. Jahrhunderts aus? Waren die Ansätze im Vorgehen gegen die Germanen von Julian und Constantius II. von Grund auf verschieden oder verfolgten sie eine gleiche Linie? In welchen Punkten spielten die beiden Mächtigen ein gemeinsames Spiel gegen den äußeren Feind? Oder gab es Situationen in denen der innere Zwist so überhand nahm, dass sie sich in ihrem Vorgehen gegen „den gemeinsamen Feind“ eher behinderten?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellenlage
- Zeitzeugen
- Julian
- Ammianus Marcellinus
- Libanios
- Spätere Geschichtsschreibung
- Zosimos
- Sokrates
- Zeitzeugen
- II. Die römische Germanenpolitik unter Constantius II. und Julian – Kooperation oder Alleingang?
- Constantius II. und seine Gallienpolitik hinsichtlich Germaniens vor Julian
- Die Niederschlagung der Usurpationen des Magnentius und des Silvanus - sinnvoll oder egoistisch?
- Der Friedensschluss des Constantius II. mit Gundomadus und Vadomarius 354
- Reaktion auf Gallus oder „Abschreckungstaktik“?
- Verrat oder Vermittlung?
- Julian in Gallien - Kommandeur oder Marionette?
- Constantius II. 3. Feldzug gegen die Alamannen 356 – „Ergänzung“ zu Julians militärischen Operationen oder Kontrollgang?
- Die Gallienpolitik hinsichtlich der Germanen unter Julian - Der Alamannenfeldzug 356/7
- Schlusswort
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der römischen Germanenpolitik unter Constantius II. und Julian im 4. Jahrhundert in Gallien. Sie untersucht, ob die beiden Kaiser in ihrer Vorgehensweise gegen die Germanen kooperierten oder eher eigene Wege gingen. Die Arbeit analysiert die Quellenlage und die jeweiligen Strategien der beiden Kaiser, um die Frage zu beantworten, ob es gemeinsame Ziele oder eher Konflikte gab, die sich auf die Germanenpolitik auswirkten.
- Die Rolle von Constantius II. und Julian in der römischen Germanenpolitik
- Die Quellenlage und ihre Interpretation
- Die Strategien von Constantius II. und Julian im Umgang mit den Germanen
- Die Auswirkungen innerer Konflikte auf die römische Germanenpolitik
- Die Frage nach Kooperation oder Alleingang in der römischen Germanenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Relevanz des Themas dar. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Darstellungen von Constantius II. und Julian in den Quellen und stellt die Notwendigkeit einer umfassenden Untersuchung der römischen Germanenpolitik unter beiden Kaisern heraus.
Das Kapitel "Quellenlage" analysiert die verfügbaren Quellen, insbesondere die Zeitzeugenberichte von Ammianus Marcellinus, Libanios und Julian selbst, sowie die späteren Geschichtsschreiber Zosimos und Sokrates. Die Glaubwürdigkeit der Quellen wird kritisch hinterfragt und die einseitige Perspektive der römischen Quellen wird hervorgehoben.
Das Kapitel "II. Die römische Germanenpolitik unter Constantius II. und Julian – Kooperation oder Alleingang?" untersucht die jeweiligen Strategien der beiden Kaiser im Umgang mit den Germanen. Es werden die politischen und militärischen Entscheidungen von Constantius II. und Julian analysiert, um die Frage nach Kooperation oder Alleingang zu beantworten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die römische Germanenpolitik, Constantius II., Julian, Gallien, 4. Jahrhundert, Kooperation, Alleingang, Quellenkritik, Strategien, Konflikte, Usurpationen, Friedensschluss, Feldzüge, Alamannen.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterschied sich die Germanenpolitik von Constantius II. und Julian?
Die Arbeit untersucht, ob die beiden Herrscher kooperierten oder gegensätzliche Strategien (z.B. Abschreckung vs. Integration) gegenüber den Alamannen verfolgten.
Warum wird Julian in den Quellen oft besser dargestellt als Constantius II.?
Zeitzeugen wie Ammianus Marcellinus und Libanios waren Julian wohlgesonnen, während Constantius II. oft als misstrauischer und weniger fähiger Feldherr porträtiert wurde.
War Julians Erhebung zum Augustus eine Usurpation?
Nach damaliger Definition ja, da sie ohne Einverständnis des amtierenden Augustus Constantius II. durch die Soldaten in Paris erfolgte.
Welche Bedeutung hatte der Friedensschluss mit Gundomadus?
Dieser Vertrag von 354 diente der Stabilisierung der Rheingrenze, wurde aber von Kritikern oft als Zeichen von Schwäche oder Verrat ausgelegt.
Behinderten sich die beiden Kaiser gegenseitig im Kampf gegen die Germanen?
Die Arbeit analysiert Situationen, in denen innerer Zwist und Misstrauen die militärische Effektivität gegen den „gemeinsamen Feind“ schwächten.
- Quote paper
- M.A. Hannah Kronenberger (Author), 2008, Die römische Germanenpolitik unter Constantius II. und Julian – Kooperation oder Alleingang?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131403