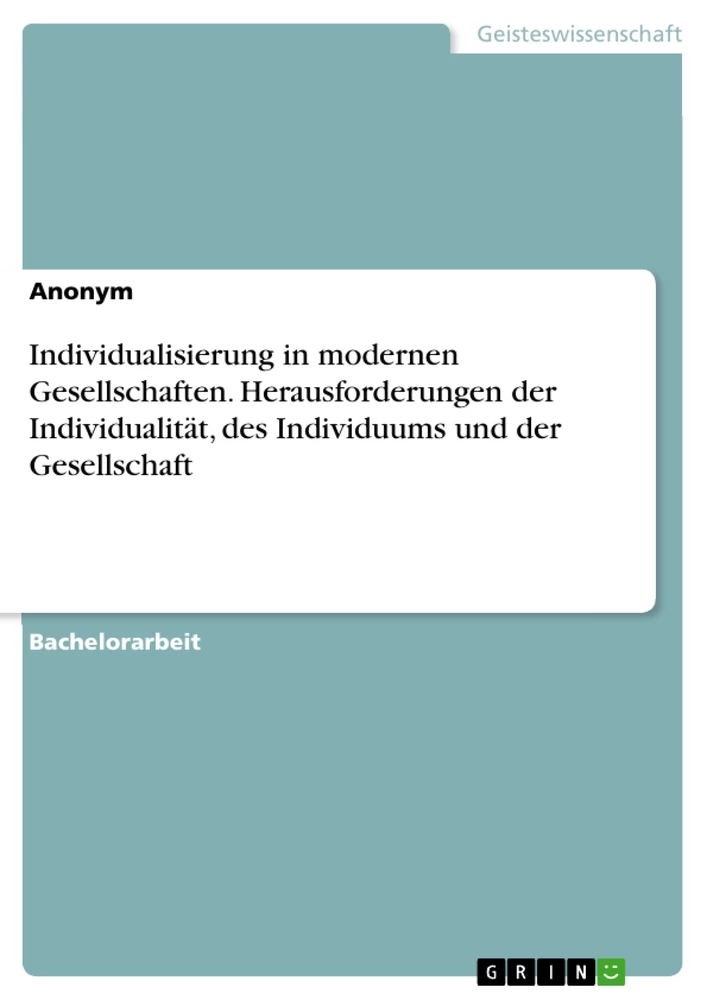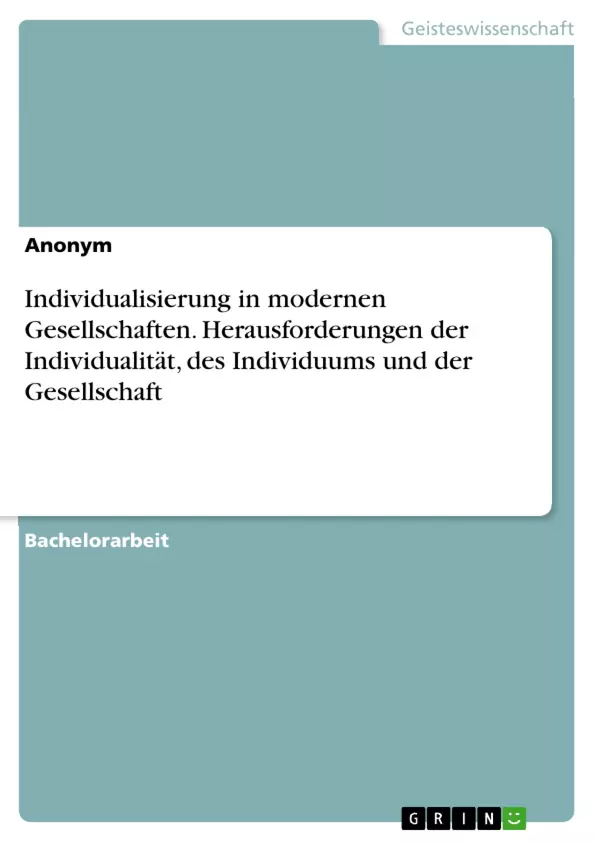Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die Herausforderungen der Individualisierung in modernen Gesellschaften, anhand von vier Hypothesen herauszuarbeiten. Die Schwerpunkte beziehen sich auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wachsende Vielfalt des sozialen Lebens, steigende Überforderung der Individuen in modernen Gesellschaften und Gefährdung der persönlichen Stabilität.
Dabei ist die vorliegende Arbeit wie folgt aufgebaut: Zunächst sollen Begrifflichkeiten der Individualität, des Individuums, der Gemeinschaft, der Gesellschaft und des gesellschaftlichen Zusammenhalts geklärt werden. Hierbei wurde bewusst die Individualisierung nicht mit aufgenommen, da es in der Literatur als auch in der Wissenschaft nicht trennscharf definiert ist und im Laufe der Arbeit immer wieder neue Definitionsweisen und Theorien herangezogen werden und erst bei der Zusammenführung ein einheitliches Bild in Hinblick auf die oben genannten Hypothesen erstellt wird.
Danach folgt der Bezug auf die Individualisierung der Lebensverhältnisse in Hinblick auf die geschichtliche Entwicklung und die Unterteilung in soziostrukturelle und kulturelle Individualisierung. Daraufhin folgt eine Selektion an praktischen Beispielen der individualistischen Einflüsse bestimmter Lebensverhältnisse, bezogen auf die Entwicklung der Lebensverläufe der Individuen, der Wandel der Akzeptanz bestimmter Beziehungsformen besonders anhand der LGBTQ+ Community und Pluralisierung der Familienformen.
Nach der Klärung dieser genannten Punkte folgt der Bezug auf die modernen Gesellschaften und dessen Wandel und Einflüsse die Individualisierung darauf hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motivation und Problemstellung
- Schwerpunkt und Aufbau der Bachelorarbeit
- Begriffsdefinitionen
- Individualität
- Individuum
- Gemeinschaft
- Gesellschaft
- Gesellschaftlicher Zusammenhalt
- Individualismus vs. Kollektivismus
- Individualismus
- Kollektivismus
- Individualisierung der Lebensverhältnisse
- Geschichtlicher Einblick
- Sozialstrukturelle und Kulturelle Individualisierung
- Praktische Anwendungsbeispiele
- Individualisierung der modernen Gesellschaft
- Solidarität und gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland
- Betrachtungsweisen der Individualisierung in modernen Gesellschaften
- Negative Individualisierung
- Positive Individualisierung
- Ambivalente Individualisierung
- Zusammenführung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit den Herausforderungen der Individualisierung in modernen Gesellschaften. Sie analysiert den Einfluss dieses Prozesses auf die Lebensverhältnisse von Individuen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Arbeit strebt danach, die komplexen Zusammenhänge zwischen Individualisierung und gesellschaftlichen Entwicklungen aufzuzeigen, ohne definitive Lösungen zu präsentieren.
- Der Einfluss der Individualisierung auf das Bedürfnis nach Abgrenzung und Differenzierung.
- Die Auswirkungen der Individualisierung auf die Vielfalt des sozialen Lebens.
- Die Überforderung des Individuums in einer individualisierten Gesellschaft.
- Die Gefährdung der persönlichen Stabilität durch die zunehmende Auswahl an Gruppen und Positionen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Motivation und Problemstellung der Arbeit vor und beschreibt den Schwerpunkt und Aufbau der Bachelorarbeit. Kapitel 2 definiert wichtige Begrifflichkeiten wie Individualität, Individuum, Gemeinschaft, Gesellschaft und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Kapitel 3 behandelt die Konzepte von Individualismus und Kollektivismus, die für das Verständnis der Individualisierung relevant sind. Kapitel 4 befasst sich mit der Individualisierung der Lebensverhältnisse, indem es einen geschichtlichen Überblick bietet, die soziostrukturelle und kulturelle Individualisierung untersucht und praktische Beispiele dafür aufzeigt.
Kapitel 5 fokussiert auf die Individualisierung der modernen Gesellschaft, insbesondere auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Es werden Studien der Bertelsmann Stiftung analysiert und die verschiedenen Betrachtungsweisen der Individualisierung von Markus Schroer dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen Individualisierung, Gesellschaft, Individuum, Gemeinschaft, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Individualismus, Kollektivismus, Lebensverhältnisse, soziale Veränderungen, moderne Gesellschaften, Studien zur sozialen Entwicklung, Deutschland und Studien der Bertelsmann Stiftung. Sie untersucht die Auswirkungen der Individualisierung auf verschiedene Aspekte des modernen Lebens.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2022, Individualisierung in modernen Gesellschaften. Herausforderungen der Individualität, des Individuums und der Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1314037