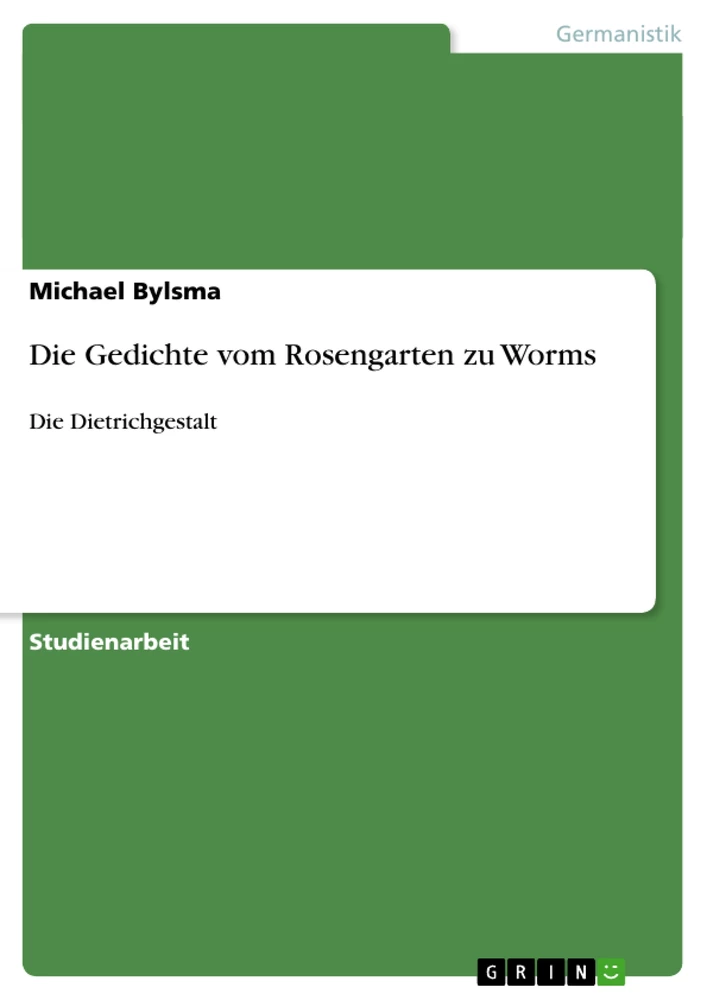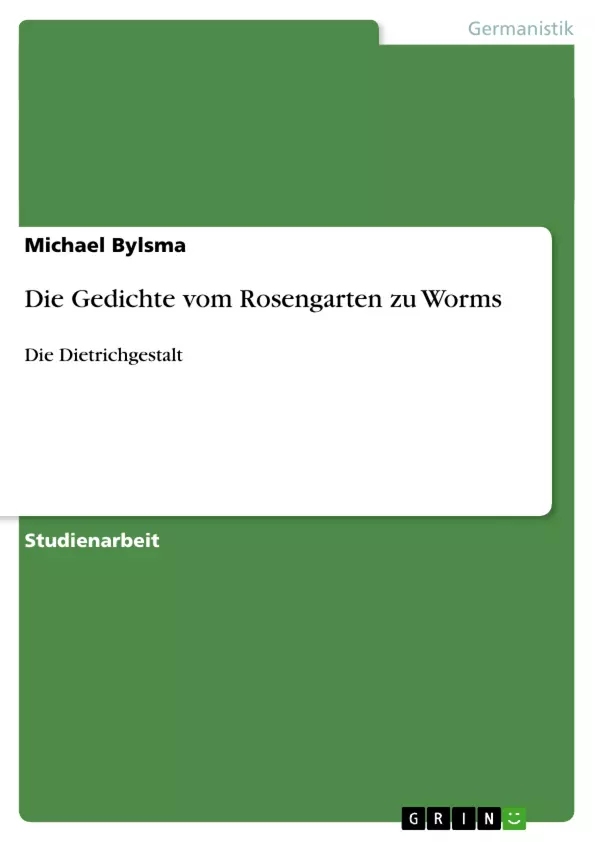Die im Folgenden behandelte Fassung A der Gedichte des Rosengartens zu Worms ist ungefähr 50 Jahre jünger als das Nibelungenlied.
Im Gedicht findet ein Vergleich zwischen Helden statt, bei dem im Verlauf der Arbeit insbesondere der Kampf zwischen Siegfried und Dietrich im Blickpunkt stehen wird.
Die einzelnen Kapitel befassen sich mit der genauen Beschreibung Dietrichs von Bern, zu dessen Epen der Rosengarten zählt.
Hier gilt zu beachten, dass die gewählten Begriffe, die die Dietrichgestalt beschreiben, mit Vorsicht auf ihren mittelalterliche Kontext zu verwenden sind.
Dietrichs Ruf bezieht sich sowohl auf sein Ehrverhalten, als auch auf die untersuchten Attribute seiner Figur im Epos, die im Zusammenhang mit ihm auftauchen.
Man spricht demnach zufolge von Merkmalen, die bei der Beschreibung verwendet werden und zur Funktion der Gestalt führen sollen.
Um dies zu erreichen ist es nötig, die wichtigsten Figurenkonstellationen zu Dietrich zu untersuchen, was im Folgenden die zwischen Hildebrand-, bzw. Kriemhilt und Dietrich sein müssen.
In der Bearbeitung verwende ich die Begriffe `Rolle der Dietrichgestalt´, bzw. `- der Person Dietrichs´, ebenso wie `Rolle´ in Bezug auf die Beschreibung der Attribute, um den Ruf, bzw. das Ehrverhalten zu erklären.
Hierbei steht die Entwicklung in der Kampfszene, in welcher Siegfried gegen Dietrich kämpft im Mittelpunkt.
Die Arbeit soll einen Umriss der Dietrichgestalt ergeben, wobei der neuzeitliche Begriff der Charakterisierung nicht verwendet wird. Wie auch im Beispiel Nibelungenlied sind die psychologischen Begriffe eher mit Verhalten zu tauschen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Die Beschreibung der Dietrichgestalt
- Dietrichs Ruf
- Dietrichs Attribute
- Im Vordergrund stehende Figurenkonstellationen
- Die Beziehung zwischen Dietrich und Hildebrand
- Dietrichs Beziehung zu Kriemhilt
- Die Rollenfunktion Dietrichs
- Die Entwicklung während der Kampfszenen
- Die Kampfszene zwischen Dietrich und Siegfried
- Die Beschreibung der Dietrichgestalt
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Darstellung der Dietrichgestalt in der Fassung A der Gedichte des Rosengartens zu Worms. Ziel ist es, Dietrichs Ruf, seine Attribute und seine Rollenfunktion im Kontext des Epos zu untersuchen. Dabei wird der Fokus insbesondere auf die Beziehung Dietrichs zu anderen wichtigen Figuren und die Entwicklung seiner Rolle während der Kampfszenen gelegt.
- Beschreibung und Analyse der Dietrichgestalt
- Untersuchung der wichtigsten Figurenkonstellationen um Dietrich
- Analyse von Dietrichs Ruf und seinen Attributen im Gedicht
- Die Rolle Dietrichs im Kontext der Kampfszenen
- Vergleich der Darstellung Dietrichs mit anderen Darstellungen in der mittelalterlichen Literatur.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert den Kontext der Arbeit. Sie beschreibt die Fassung A der Gedichte des Rosengartens zu Worms und ihren Vergleich zu dem Nibelungenlied. Es wird die Methodik der Arbeit skizziert und die Bedeutung des mittelalterlichen Kontextes bei der Interpretation der Dietrichgestalt hervorgehoben. Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Darstellung und Funktion der Dietrichgestalt im Rosengarten dar.
Die Beschreibung der Dietrichgestalt: Dieses Kapitel beschreibt Dietrich von Bern anhand von Zitaten aus dem Rosengarten. Es wird auf seinen vorauseilenden Ruf eingegangen, der bereits vor seinem tatsächlichen Auftreten im Gedicht etabliert ist. Seine Bekanntheit und seine Heldentaten werden als bekannt vorausgesetzt, was den Fokus auf die Darstellung im Gedicht lenkt. Das Kapitel analysiert die Attribute, die mit Dietrich assoziiert werden, und wie diese seine Rolle im Epos prägen.
Im Vordergrund stehende Figurenkonstellationen: Dieser Abschnitt befasst sich mit den wichtigsten Beziehungen Dietrichs zu anderen Figuren, vor allem zu Hildebrand und Kriemhilt. Es wird untersucht, wie diese Beziehungen seine Rolle und seine Handlungen im Gedicht beeinflussen. Die Analyse der Interaktionen liefert wichtige Einblicke in Dietrichs Charakter und seine Position innerhalb des Handlungsgeschehens.
Die Rollenfunktion Dietrichs: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Dietrichgestalt im Verlauf der Kampfszenen. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der Rolle Dietrichs im Kampf gegen Siegfried und wie diese Rolle durch seine Attribute und Beziehungen zu anderen Figuren geprägt wird. Es wird die Frage aufgeworfen, inwieweit die Darstellung Dietrichs im Rosengarten mit anderen mittelalterlichen Darstellungen übereinstimmt.
Schlüsselwörter
Dietrich von Bern, Rosengarten zu Worms, Nibelungenlied, Heldendarstellung, Figurenkonstellation, Attribute, Rollenfunktion, Kampfszenen, mittelalterliche Literatur, Epos.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Rosengarten zu Worms (Fassung A): Dietrich-Darstellung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung der Figur Dietrich von Bern in Fassung A der Gedichte des Rosengartens zu Worms. Der Fokus liegt auf Dietrichs Ruf, seinen Attributen, seiner Rollenfunktion im Epos und seinen Beziehungen zu anderen wichtigen Figuren, insbesondere Hildebrand und Kriemhilt.
Welche Aspekte der Dietrichgestalt werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Beschreibung und Analyse der Dietrichgestalt selbst, die Untersuchung der wichtigsten Beziehungen Dietrichs zu anderen Figuren, die Analyse seines Rufs und seiner Attribute im Gedicht sowie die Untersuchung seiner Rolle im Kontext der Kampfszenen, insbesondere im Kampf gegen Siegfried. Ein Vergleich mit anderen Darstellungen in der mittelalterlichen Literatur wird ebenfalls angestellt.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle ist Fassung A der Gedichte des Rosengartens zu Worms. Die Arbeit bezieht sich auch auf das Nibelungenlied im Kontext des Vergleichs und der Einordnung der Dietrich-Darstellung.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche Methode, die auf der Analyse von Zitaten aus dem Rosengarten beruht, um Dietrichs Charakter, seine Beziehungen und seine Rolle im Handlungsverlauf zu untersuchen. Der mittelalterliche Kontext wird bei der Interpretation berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit Unterkapiteln zur Beschreibung der Dietrichgestalt, den wichtigsten Figurenkonstellationen um Dietrich und seiner Rollenfunktion, sowie einen Schluss. Der Hauptteil untersucht Dietrichs Ruf, seine Attribute, seine Beziehungen zu Hildebrand und Kriemhilt und seine Rolle in den Kampfszenen.
Welche zentralen Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, wie die Dietrichgestalt im Rosengarten dargestellt wird und welche Funktion sie im Gedicht einnimmt. Weitere Fragen betreffen Dietrichs Ruf, seine Attribute, seine Beziehungen zu anderen Figuren und die Entwicklung seiner Rolle während der Kampfszenen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Dietrich von Bern, Rosengarten zu Worms, Nibelungenlied, Heldendarstellung, Figurenkonstellation, Attribute, Rollenfunktion, Kampfszenen, mittelalterliche Literatur, Epos.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, die den Kontext und die Methodik beschreibt, ein Kapitel zur Beschreibung der Dietrichgestalt anhand von Zitaten und Attributen, ein Kapitel zu den wichtigsten Beziehungen Dietrichs (Hildebrand, Kriemhilt), ein Kapitel zu Dietrichs Rollenfunktion in den Kampfszenen, insbesondere dem Kampf gegen Siegfried, und einen Schluss.
Wie wird Dietrich im Rosengarten dargestellt?
Die Arbeit beschreibt Dietrich anhand von Zitaten aus dem Rosengarten, analysiert seine Attribute und untersucht, wie sein vorauseilender Ruf und seine Beziehungen zu anderen Figuren seine Rolle im Epos prägen. Die Analyse konzentriert sich auf seine Entwicklung während der Kampfszenen und vergleicht die Darstellung mit anderen mittelalterlichen Versionen.
- Citar trabajo
- Michael Bylsma (Autor), 2004, Die Gedichte vom Rosengarten zu Worms, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131456