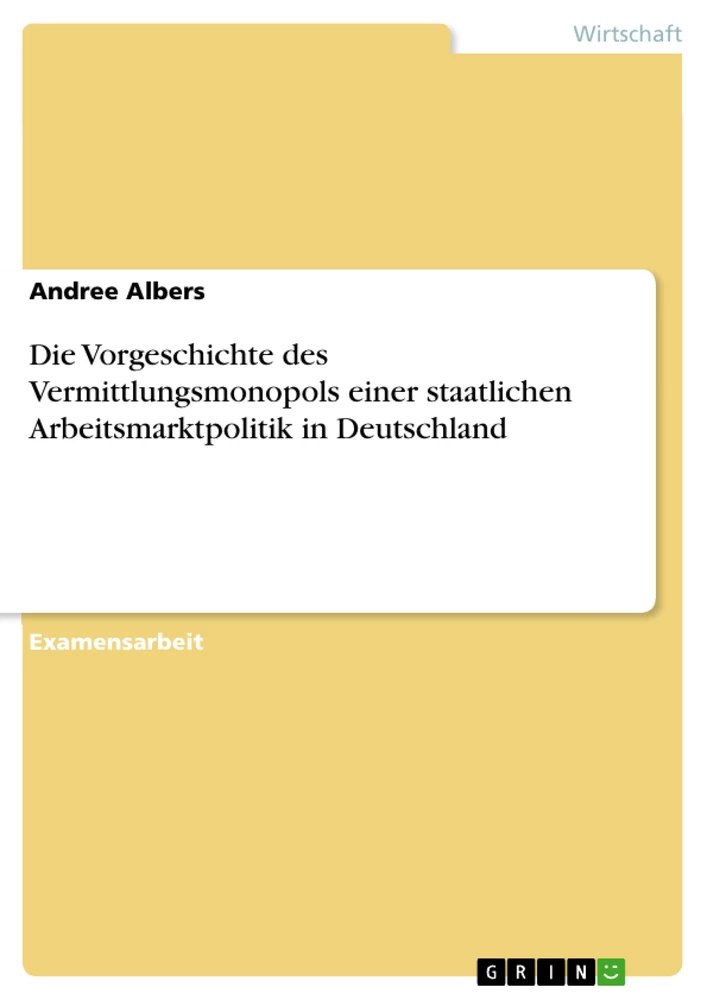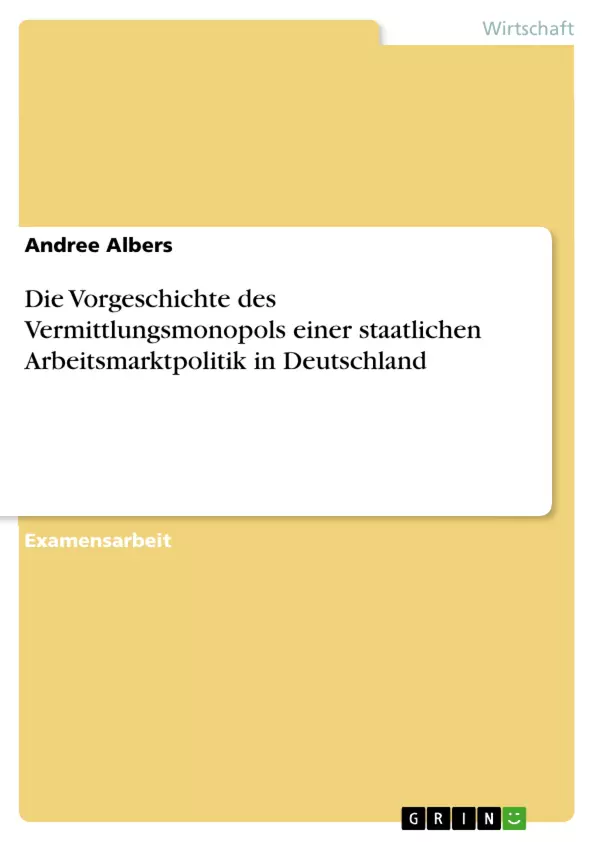Die Diskussion um die Auflockerung des im Jahre 1935 gesetzlich verankerten Arbeitsvermittlungsmonopols der staatlichen Arbeitsmarktverwaltung in Deutschland, die auch mit historischen Argumenten geführt wird, gab den Anstoß zu dieser Arbeit. Anhand vorliegender Literatur, insbesondere zeitgenössischer Art, wird die Vorgeschichte der Arbeitsmarkverwaltung in den etwa vier Jahrzehnten bis zur Errichtung der Reichsanstalt im Jahre 1927 nachgezeichnet.
In knapper Weise wird zunächst das Entstehen und die Entwicklung sowie die Leistungsfähigkeit und Probleme nicht-öffentlicher, einseitiger und beschränkter lokaler Vermittlungsformen Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts vorgestellt. Die ob ihrer Missstände schon früh kritisierte, aber noch bis 1931 geduldete gewerbsmäßige Vermittlung, die zeitweilig sehr effektiven Arbeitsnachweise der industriellen Arbeitgeber, die gewerkschaftlichen Nachweise, die paritätischen Facharbeitsnachweise und die karitative Arbeitsvermittlung für verelendete oder besonders schutzbedürftige Arbeitssuchende. Allgemeine lokale Arbeitsnachweise auf gemeinnütziger Vereinsbasis bilden konzeptionell, funktional und historisch den Übergang zu den kommunalen Arbeitsnachweisen, die seit den 90er Jahren immer stärkere Bedeutung auf den lokalen Arbeitsmärkten gewinnen und die direkten Vorläufer der dann 1927 gesetzlich installierten Arbeitsmarktverwaltung werden.
Im zweiten Hauptteil wird in straffer Form die Entstehungsprozesse, die fördernden, beeinflussenden und hemmenden Faktoren und die Entwicklung der kommunalen Arbeitsnachweise und ihrer regionalen Verbände vor und nach dem 1. Weltkrieg herausgearbeitet.
In guter sprachlicher Formulierung und sinnvoller thematischer Gliederung, dabei stets auf das Wesentliche achtend und die erforderlichen Informationen und Daten der vorhandenen älteren Literatur entnehmend, gelingt es eine ausgezeichnete Skizze dieser bedeutsamen historischen Phase im Vorfeld der Entwicklung der staatlichen Arbeitsmarktverwaltung in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die nicht von öffentlicher Seite betriebenen Arbeitsvermittlungsformen
- 2.1 Von den Zünften zum industriellen Arbeitsmarkt
- 2.2 Die Umschau und das Inserat
- 2.3 Die gewerbsmäßige Arbeitsvermittlung
- 2.4 Arbeitsnachweise der Arbeitgeber
- 2.4.1 Vorbemerkungen
- 2.4.2 Innungsarbeitsnachweise
- 2.4.3 Arbeitsnachweise in der Landwirtschaft
- 2.4.4 Arbeitsnachweise in der Industrie
- 2.5 Arbeitsnachweise der Arbeitnehmer
- 2.6 Paritätische Facharbeitsnachweise
- 2.7 Karitative Arbeitsvermittlung
- 2.8 Allgemeine Arbeitsnachweise auf Vereinsbasis
- 3. Aufbau und Entwicklung der öffentlichen Arbeitsvermittlung bis 1927
- 3.1 Vorbemerkungen
- 3.2 Entstehung öffentlicher Arbeitsnachweise und Arbeitsnachweisverbände
- 3.2.1 Anfänge
- 3.2.2 Ausbreitungswelle in den 90er Jahren
- 3.2.3 Staatliche Fördermaßnahmen und Arbeitsnachweisverbände
- 3.3 Widerstände gegen die öffentlichen Arbeitsnachweise und Diskussionen um eine reichsgesetzliche Regelung
- 3.4 Das Stellenvermittlergesetz von 1910
- 3.5 Zentralisierung während des 1. Weltkriegs
- 3.6 Das Arbeitsnachweisgesetz (ANG) von 1922
- 3.7 Das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (AVAVG) von 1927
- 4. Schlußbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Vorgeschichte des staatlichen Arbeitsvermittlungsmonopols in Deutschland. Das Hauptziel ist es, die Entstehung und Entwicklung der öffentlichen Arbeitsvermittlung vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Inkrafttreten des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (AVAVG) im Jahre 1927 zu untersuchen.
- Die Entwicklung verschiedener nicht-staatlicher Formen der Arbeitsvermittlung vor dem Hintergrund des Industrialisierungsprozesses
- Die Entstehung und Ausbreitung öffentlicher Arbeitsnachweise im Deutschen Reich
- Die Diskussionen um die Notwendigkeit einer reichsgesetzlichen Regelung der Arbeitsvermittlung
- Die Herausbildung des staatlichen Arbeitsvermittlungsmonopols durch das AVAVG von 1927
- Die Bedeutung der historischen Entwicklung für das Verständnis der aktuellen Debatte um die Liberalisierung des Arbeitsmarktes
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einleitung und führt in die Thematik des Arbeitsmarktes und der staatlichen Arbeitsmarktpolitik in Deutschland ein. Es stellt die historische Entwicklung des Vermittlungsmonopols der Bundesanstalt für Arbeit in den Kontext der heutigen Diskussion um die Liberalisierung des Arbeitsmarktes.
Kapitel 2 beleuchtet verschiedene nicht-staatliche Arbeitsvermittlungsformen im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Es werden die verschiedenen Formen der Arbeitsvermittlung durch Zünfte, Inserate, gewerbsmäßige Vermittler, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie karitative Einrichtungen beschrieben.
Kapitel 3 beschreibt die Entstehung und Entwicklung der öffentlichen Arbeitsvermittlung im Deutschen Reich bis 1927. Es behandelt die Anfänge der öffentlichen Arbeitsnachweise, ihre Ausbreitung in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts und die Diskussionen um eine reichsgesetzliche Regelung. Das Kapitel beschreibt außerdem das Stellenvermittlergesetz von 1910, die Zentralisierung während des Ersten Weltkriegs und das Arbeitsnachweisgesetz (ANG) von 1922.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der deutschen Arbeitsmarktgeschichte wie der Entstehung des Vermittlungsmonopols, der Entwicklung öffentlicher Arbeitsnachweise und Arbeitsnachweisverbände, der Diskussion um eine reichsgesetzliche Regelung der Arbeitsvermittlung sowie der historischen Entwicklung des Arbeitsvermittlungswesens.
Häufig gestellte Fragen
Wann entstand das staatliche Arbeitsvermittlungsmonopol in Deutschland?
Es wurde gesetzlich im Jahr 1927 mit der Errichtung der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung verankert.
Welche Vermittlungsformen gab es vor 1927?
Es gab gewerbsmäßige Vermittler, Arbeitsnachweise von Arbeitgebern und Gewerkschaften sowie karitative und kommunale Vermittlungsstellen.
Warum wurde die gewerbsmäßige Vermittlung kritisiert?
Oft kam es zu Missständen und Ausbeutung der Arbeitssuchenden, was letztlich zu ihrer schrittweisen Einschränkung und Abschaffung führte.
Was waren die Vorläufer der staatlichen Arbeitsverwaltung?
Die kommunalen Arbeitsnachweise, die ab den 1890er Jahren an Bedeutung gewannen, bildeten die direkte konzeptionelle Grundlage.
Welche Rolle spielte der Erste Weltkrieg für die Arbeitsvermittlung?
Der Krieg erzwang eine Zentralisierung und staatliche Steuerung der Arbeitskräfte, was die Entwicklung hin zu einer nationalen Behörde beschleunigte.
- Arbeit zitieren
- Andree Albers (Autor:in), 1995, Die Vorgeschichte des Vermittlungsmonopols einer staatlichen Arbeitsmarktpolitik in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1314886