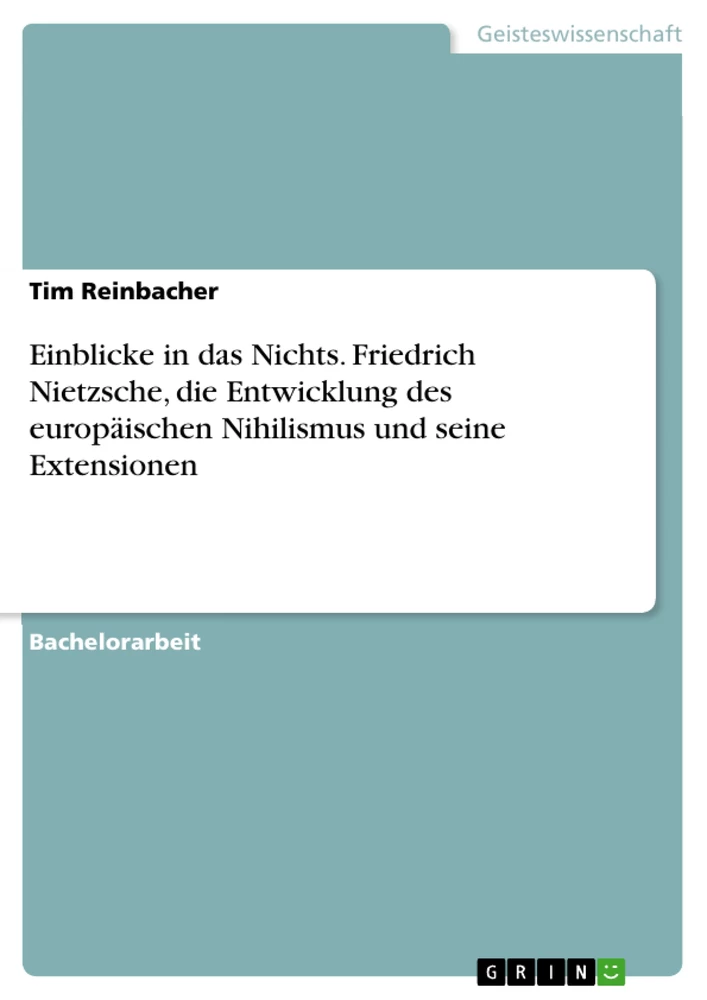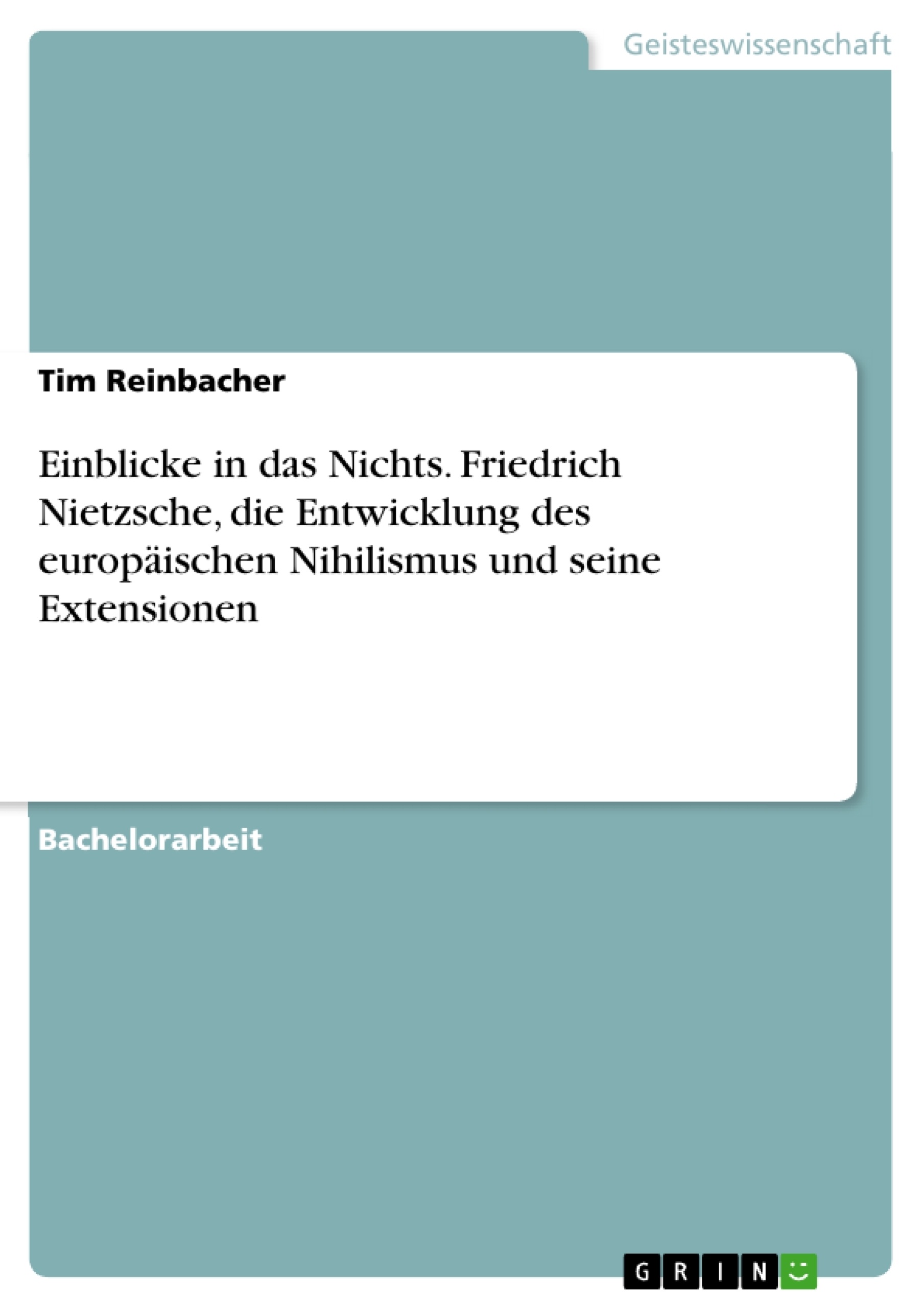In dieser Arbeit wird der Nihilismus-Begriff, seine Entstehung und die Frage untersucht, ob die Gefahr des Nihilismus eine ernstzunehmende Bedrohung in der Gegenwart des 21. Jahrhunderts darstellt. Es wird zwischen verschiedenen Unterarten des Nihilismus unterschieden und insbesondere der Einfluss Friedrich Nietzsches auf das Verständnis des Nihilismus beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Dichotomie zwischen der Notwendigkeit einer begrifflichen Definition des Nihilismus und dessen Unbestimmbarkeit
- 2.1 Versuch einer Definition des Nihilismus oder die Genealogie des Nihilismus
- 3. Der ontologische Nihilismus
- 3.1 Platon und die zwei Arten des Seienden
- 3.2 Jacobi, Fichte und die Geburt des ontologischen Nihilismus
- 3.3 Schopenhauer, Nietzsche und das Leben als Leiden
- 4. Der epistemologische Nihilismus oder die Verwerfung der Metaphysik bei Nietzsche
- 5. Freie Geister und die Moral bei Nietzsche
- 5.1 Herrenmoral, Sklavenmoral und der Wille zum Nichts
- 5.1.1 Herrenmoral und Sprache als Machtäußerung
- 5.1.2 Sklavenmoral und die Bedeutung des Ressentiments
- 6. Heidegger, der Wille zur Macht und der aktive Nihilist der Tat
- 7. Der Tod Gottes
- 8. Nihilismus in der Gegenwart
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des europäischen Nihilismus und seiner Extensionen, mit besonderem Fokus auf die Philosophie Friedrich Nietzsches. Das Ziel ist es, den Nihilismus als philosophischen Begriff zu definieren, seine verschiedenen Unterarten zu unterscheiden und seinen Einfluss auf die Philosophie des 20. und 21. Jahrhunderts zu analysieren.
- Der Nihilismus als philosophisches Konzept und seine Definitionsprobleme
- Die unterschiedlichen Arten des Nihilismus, z.B. ontologischer und epistemologischer Nihilismus
- Der Einfluss Nietzsches auf die Philosophie des 20. und 21. Jahrhunderts, insbesondere auf den Existenzialismus
- Die Rolle des Nihilismus in der Gegenwart und seine möglichen Ausprägungen
- Die Beziehung zwischen Nihilismus und Moral, sowie die Konzepte von Herrenmoral und Sklavenmoral
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Bedeutung des Nihilismus als philosophischen Begriff dar. Im zweiten Kapitel werden die Schwierigkeiten einer begrifflichen Definition des Nihilismus beleuchtet und die Problematik zwischen der Notwendigkeit einer Definition und dessen Unbestimmbarkeit herausgestellt.
Das dritte Kapitel behandelt den ontologischen Nihilismus und analysiert die philosophischen Positionen von Platon, Jacobi, Fichte und Schopenhauer. Im vierten Kapitel wird der epistemologische Nihilismus bei Nietzsche untersucht und die Verwerfung der Metaphysik durch Nietzsche erörtert.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit den Konzepten der Herrenmoral und Sklavenmoral bei Nietzsche, und erklärt, wie der Nihilismus in diesen Kontext eingebettet ist.
Das sechste Kapitel analysiert die Philosophie Martin Heideggers im Hinblick auf den Nihilismus und untersucht dessen Einfluss auf den Willen zur Macht.
Das siebte Kapitel beschäftigt sich mit dem Tod Gottes und seinem Einfluss auf die Entwicklung des Nihilismus. Im achten Kapitel wird die Frage aufgeworfen, inwieweit der europäische Nihilismus im 21. Jahrhundert relevant ist und in welchen Erscheinungsformen er sich heute zeigt.
Schlüsselwörter
Nihilismus, Nietzsche, Philosophie, Ontologie, Epistemologie, Moral, Herrenmoral, Sklavenmoral, Tod Gottes, Existenzialismus, Heidegger, Wille zur Macht, Bedeutung, Sinn, Werte, Gesellschaft, Gegenwart.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Definition von Nihilismus?
Nihilismus bezeichnet die philosophische Anschauung von der Sinnlosigkeit alles Bestehenden und der Ablehnung jeglicher objektiver Werte und Wahrheiten.
Wie unterscheidet Nietzsche zwischen Herren- und Sklavenmoral?
Herrenmoral entspringt dem Selbstbewusstsein der Starken, während Sklavenmoral aus dem Ressentiment der Schwachen entsteht und Werte wie Mitleid und Demut betont.
Was bedeutet "Gott ist tot" bei Friedrich Nietzsche?
Es ist die Feststellung, dass der Glaube an eine göttliche Weltordnung in der Moderne verloren gegangen ist, was den Menschen vor die Herausforderung stellt, eigene Werte zu schaffen.
Was ist ontologischer Nihilismus?
Diese Form des Nihilismus bestreitet die Existenz einer objektiven Wirklichkeit oder eines tieferen Seinsgrundes der Welt.
Welche Rolle spielt Martin Heidegger in der Nihilismus-Debatte?
Heidegger analysiert den Nihilismus als die Geschichte des Vergessens des Seins und setzt sich kritisch mit Nietzsches "Wille zur Macht" auseinander.
Ist Nihilismus eine Gefahr für das 21. Jahrhundert?
Die Arbeit untersucht, ob die Abwesenheit verbindlicher Werte in der heutigen Gesellschaft zu einer neuen Form des Nihilismus führt, der als ernstzunehmende Bedrohung gilt.
- Quote paper
- Tim Reinbacher (Author), 2022, Einblicke in das Nichts. Friedrich Nietzsche, die Entwicklung des europäischen Nihilismus und seine Extensionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1315328