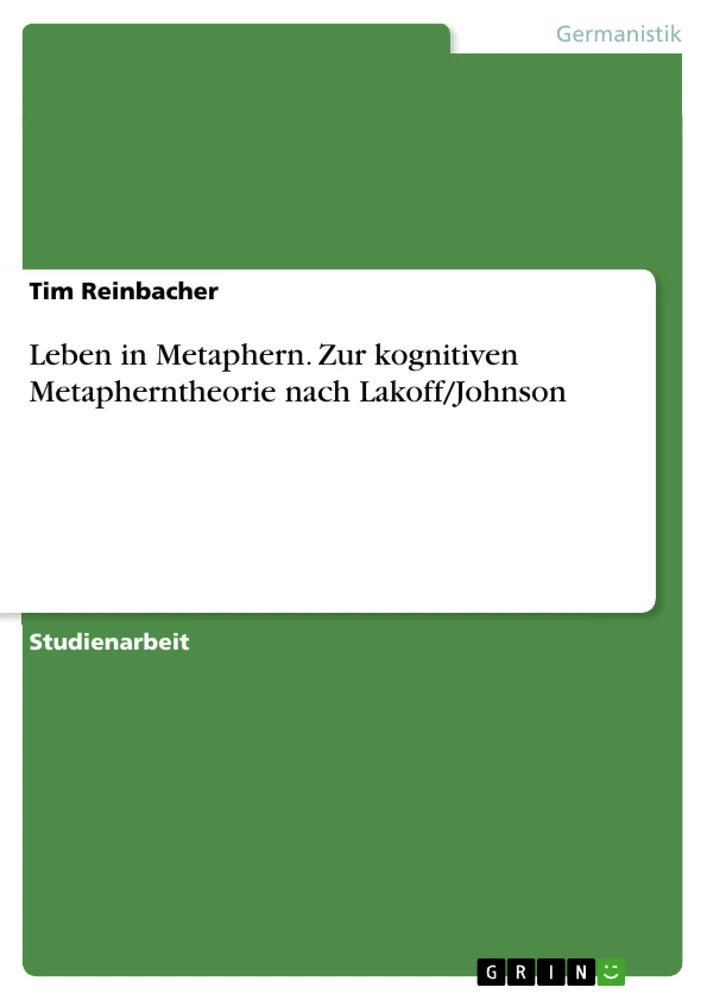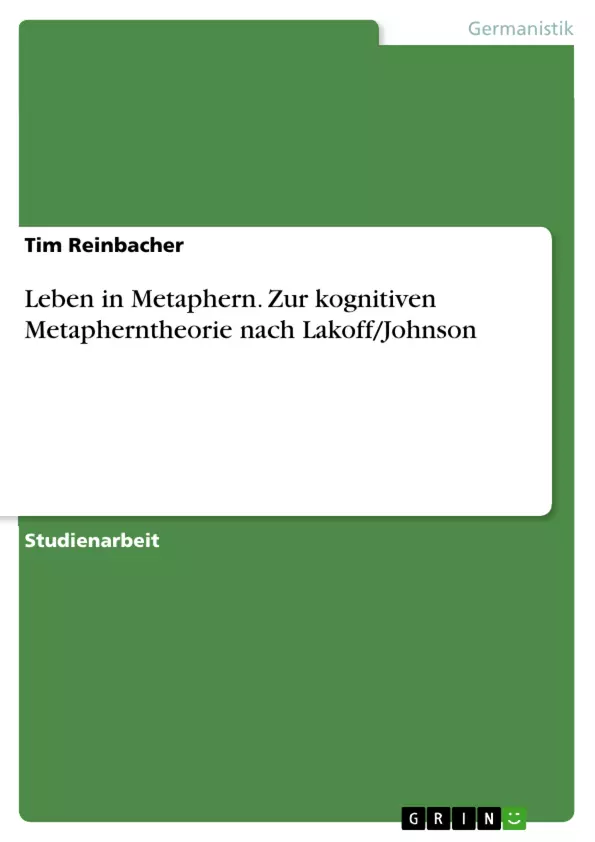In der vorliegenden Arbeit wird daher die Frage behandelt, wie sich die Konzeption der Metapher seit der Etablierung der Kognitiven Linguistik verändert hat und welche Rolle die Alltagsmetapher im Vergleich zur Metapher als reinem rhetorischen Mittel spielt. Ein Schwerpunkt wird darauf gesetzt, die Ursprünge der Metapherntheorie nach Lakoff und Johnson zu erläutern und die Relation zwischen Metaphern, menschlichem Handeln und von der Sprache abgegrenzten Denkprozessen darzulegen.
Zu Beginn der Arbeit werden die Grundzüge der Metapherntheorie aufgezeigt und es wird darauf eingegangen, auf welche Weise sich dieser Ansatz von vorherigen Definitionen und Bewertungen von Metaphern unterscheidet. Daraufhin wird der Ansatz von Lakoff und Johnson anhand der Bezeichnung "Metapher als Alltagsphänomen" erläutert. Anschließend werden die Klassifikationen der Alltagsmetapher dargelegt und anhand von Beispielen verdeutlicht. Abschließend werden Kritikpunkte gegenüber der Metapherntheorie sowie anderen Ansätzen genannt und die Frage beantwortet, welche Wirkung und Relevanz der
Metapherntheorie zugeschrieben werden können. Letztlich folgt das Fazit dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Metapher aus historischer Sicht
- 2.1. Klassische Definition der Metapher nach Aristoteles
- 2.2. Unterschiede zum Metaphernverständnis in der Kognitiven Linguistik
- 3. Metapherntheorie von Lakoff und Johnson
- 3.1. Grundannahmen
- 3.2. Metaphernarten
- 3.2.1. Orientierungsmetaphern
- 3.2.2. Ontologische Metaphern
- 3.2.3. Strukturmetaphern
- 3.3. Sonderfälle
- 3.3.1. Personifikation
- 3.3.2. Metonymie
- 4. Kritik
- 4.1. Kritik an den traditionellen Theorien
- 4.2. Kritik an der Theorie nach Lakoff und Johnson
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie sich die Konzeption der Metapher seit der Etablierung der Kognitiven Linguistik verändert hat und welche Rolle die Alltagsmetapher im Vergleich zur Metapher als reinem, rhetorischen Mittel spielt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Erläuterung der Ursprünge der Metapherntheorie nach Lakoff und Johnson und der Darstellung der Relation zwischen Metaphern, menschlichem Handeln und, von der Sprache abgegrenzten, Denkprozessen.
- Die Entwicklung des Metaphernbegriffs von der klassischen Definition bis zur Kognitiven Linguistik
- Die Rolle der Metapher als alltagssprachliches Phänomen
- Die Theorie von Lakoff und Johnson und ihre zentralen Annahmen
- Die Klassifizierung von Metaphernarten
- Die Kritik an der Metapherntheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die Metapher als ein grundlegendes Element menschlicher Kommunikation, Denken und Handeln. Sie stellt die unterschiedlichen Perspektiven auf die Metapher, insbesondere die klassische Definition nach Aristoteles und die kognitiv-linguistische Sichtweise, einander gegenüber.
Das zweite Kapitel beleuchtet die klassische Definition der Metapher nach Aristoteles und erläutert, wie sich dieses Verständnis von der Sichtweise der Kognitiven Linguistik unterscheidet.
Das dritte Kapitel widmet sich der Metapherntheorie von Lakoff und Johnson, deren zentrale Annahmen, Metaphernarten und Sonderfälle vorgestellt werden.
Schlüsselwörter
Kognitive Linguistik, Metapher, Metapherntheorie, Lakoff/Johnson, Alltagsmetapher, Rhetorik, Aristoteles, Orientierungsmetaphern, Ontologische Metaphern, Strukturmetaphern, Personifikation, Metonymie, Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der kognitiven Metapherntheorie nach Lakoff und Johnson?
Die Theorie besagt, dass Metaphern nicht nur rhetorische Schmuckmittel der Sprache sind, sondern grundlegende Strukturen unseres Denkens und Handelns darstellen. Unser Alltag ist demnach tiefgreifend von metaphorischen Konzepten geprägt.
Wie unterscheidet sich der kognitive Ansatz von der klassischen Definition nach Aristoteles?
Während Aristoteles die Metapher primär als ein poetisches und rhetorisches Mittel zur Verschönerung der Sprache sah, betrachtet die Kognitive Linguistik sie als ein allgegenwärtiges Phänomen im Alltag, das unsere Wahrnehmung der Welt strukturiert.
Welche Arten von Alltagsmetaphern werden unterschieden?
Lakoff und Johnson klassifizieren Metaphern in drei Hauptgruppen: Orientierungsmetaphern (räumliche Beziehungen), ontologische Metaphern (Ereignisse als Substanzen/Gegenstände) und Strukturmetaphern (ein Konzept wird durch ein anderes strukturiert).
Was versteht man unter Orientierungsmetaphern?
Orientierungsmetaphern geben einem Konzept eine räumliche Orientierung, wie zum Beispiel "Oben" für positive Zustände (Glück, Gesundheit) und "Unten" für negative Zustände (Traurigkeit, Krankheit).
Welche Rolle spielen Personifikation und Metonymie in dieser Theorie?
Beide werden als Sonderfälle kognitiver Prozesse betrachtet. Die Personifikation erlaubt es, nicht-menschliche Dinge als menschliche Wesen zu begreifen, während die Metonymie eine Entität nutzt, um auf eine andere, damit verbundene Entität zu verweisen.
Gibt es Kritik an der Metapherntheorie von Lakoff und Johnson?
Ja, die Arbeit setzt sich sowohl mit der Kritik an traditionellen Theorien als auch mit den spezifischen Kritikpunkten gegenüber dem Ansatz von Lakoff und Johnson auseinander, um deren Relevanz kritisch zu hinterfragen.
- Arbeit zitieren
- Tim Reinbacher (Autor:in), 2019, Leben in Metaphern. Zur kognitiven Metapherntheorie nach Lakoff/Johnson, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1315333