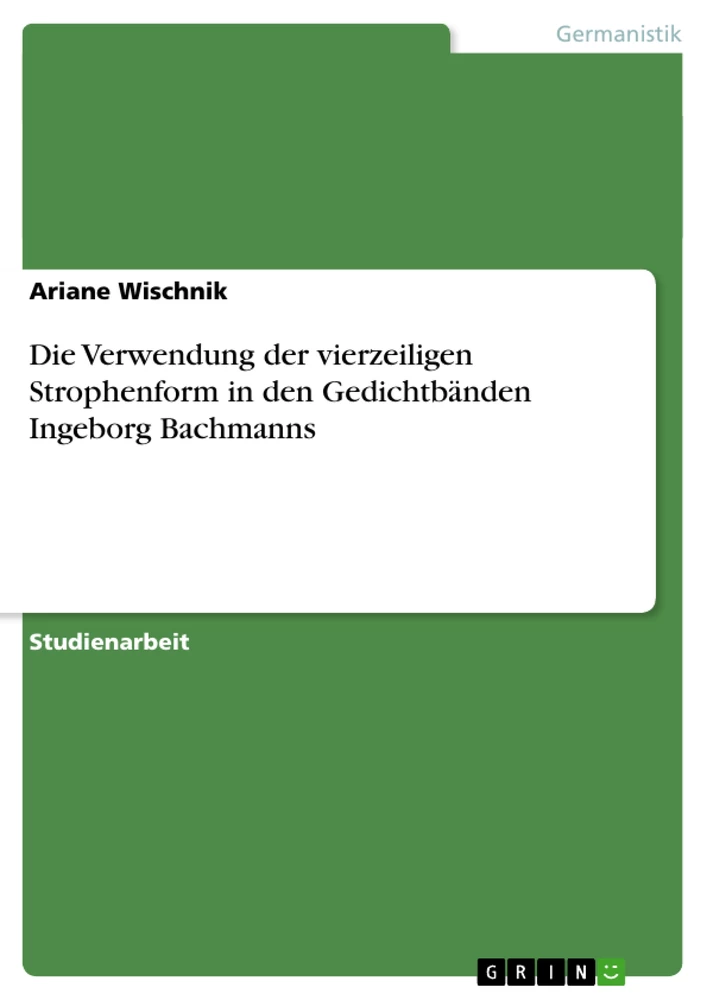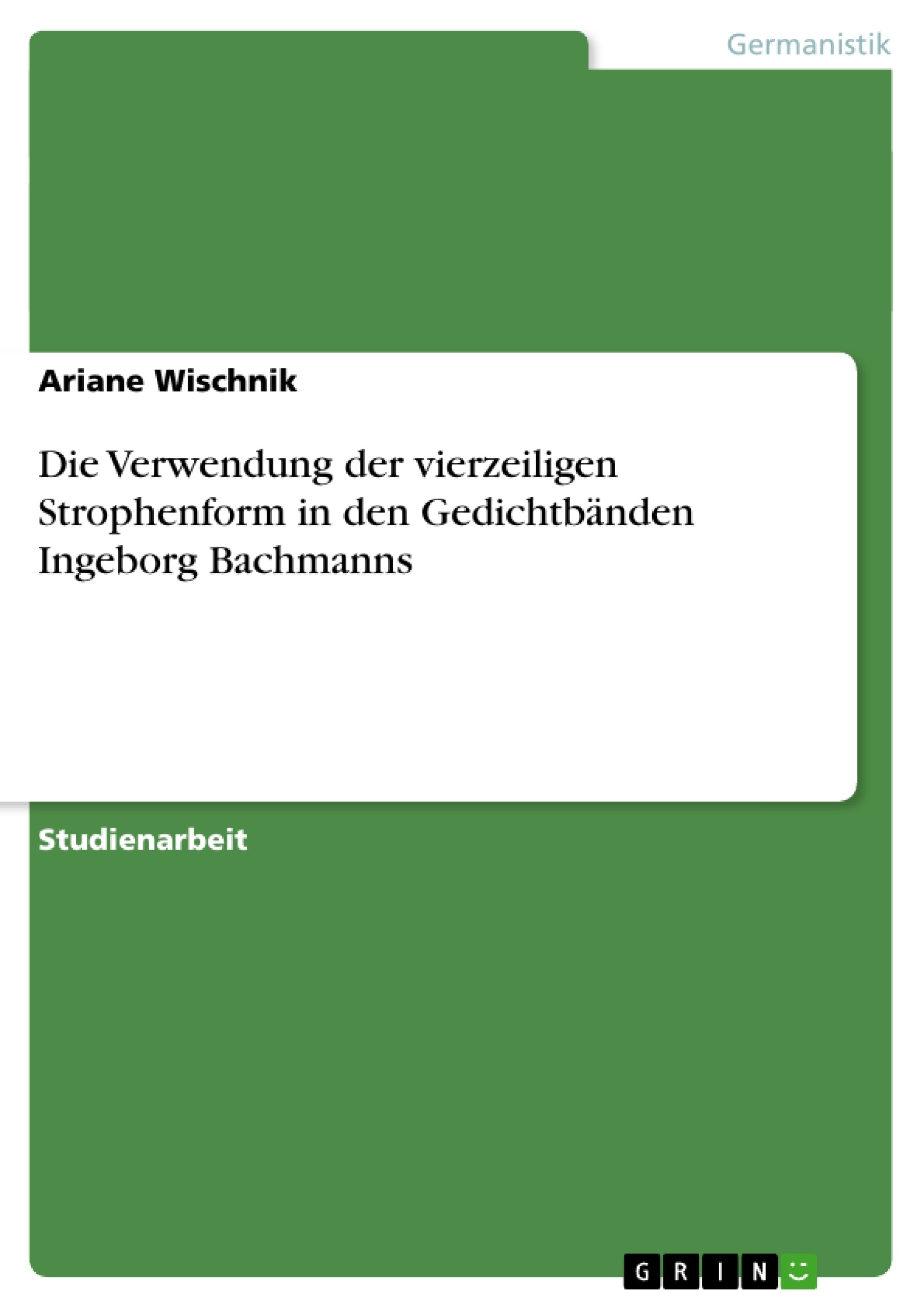In der heutigen Literaturkritik gilt Ingeborg Bachmann als eine der bedeutendsten Repräsentanten der deutschen Nachkriegsliteratur. Auch in der zeitgenössischen Rezeption wurde das lyrische Frühwerk der Dichterin, mehr noch als ihre späteren Prosaschriften, als bedeutsamer Beitrag zur Moderne aufgefasst. Besondere Anerkennung wurde dabei der Eigenständigkeit und Souveränität ihrer dichterischen Leistung gezollt, mit der sie, als junge, bis dahin unbekannte Dichterin, mit anerkannten Vertretern der Nachkriegslyrik mindestens gleichziehen konnte.
Gleichzeitig wurde Ingeborg Bachmann bereits in der frühen Aufnahme ihres Werks mit den Klassikern der deutschen Literatur in eine Linie gestellt und als ,,...Fortsetzerin bester deutscher Literaturtradition..."1 dargestellt. Diese Sichtweise der Dichterin als moderne Klassikerin mag zum Teil der Absicht der Zeitkritik entsprechen, die den Erfolg Ingeborg Bachmanns nicht allein mit ihrem Werk zu legitimieren vermochte. Im Mittelpunkt der positiven Aufnahme stand zu Beginn ihrer Karriere oftmals die Person Ingeborg Bachmanns, mehr noch als ihr Werk2.
Der Rückgriff auf traditionelle Formen der Lyrik ist in den beiden Gedichtbänden der Dichterin deutlich zu verfolgen. In einer großen Anzahl ihrer Gedichte nutzte Ingeborg Bachmann die vierzeilige Strophenform, deren Verwendung in der Tradition nicht nur der deutschen Literatur verfolgt werden kann. Ingeborg Bachmann lehnte sich unter anderem an die Formen und Motive der romantischen Liedform beziehungsweise des europäischen Symbolismus an, und vereinigte sie mit der ihr eigenen Form lyrischen Sprechens. Dadurch konnte die Dichterin sowohl ihre starke Affinität zur Musikalität in der Dichtung, als auch ihre ausdrucksstarke Verwendung von Metaphern in ihre Dichtkunst integrieren.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Überblick über die in Vierzeilern abgefassten Gedichte Ingeborg Bachmanns zu geben. Die verwendeten Formen, Themen und Motive sollen dargestellt und dem literaturgeschichtlichen Kontext gegenübergestellt werden. Dabei soll verdeutlicht werden, inwieweit sich Ingeborg Bachmann an die traditionellen, klassischen Formen der Lyrik anlehnt, aber auch, wo und inwiefern sich die Dichterin davon distanziert.
Inhaltsverzeichnis
- Rückgriff trotz Moderne
- Die Verwendung der vierzeiligen Strophenform
- Formale Merkmale
- Reim und Strophenbau
- Stil und Sprache
- Inhaltliche Aspekte
- Motive
- Themen
- Literaturgeschichtliche Parallelen
- Romantik
- Symbolismus
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Verwendung der vierzeiligen Strophenform in Ingeborg Bachmanns Gedichtbänden „Die gestundete Zeit“ und „Anrufung des großen Bären“ zu untersuchen. Dabei werden sowohl formale als auch inhaltliche Aspekte beleuchtet, sowie die literaturgeschichtlichen Wurzeln dieser Form in Bachmanns Werk analysiert.
- Die Verwendung der vierzeiligen Strophenform in Bachmanns Lyrik
- Formale Merkmale der vierzeiligen Strophenform (Reim, Strophenbau, Stil, Sprache)
- Inhaltliche Aspekte der vierzeiligen Strophenform (Motive, Themen)
- Literaturgeschichtliche Parallelen zur romantischen und symbolistischen Lyrik
- Der Einfluss traditioneller Formen auf Bachmanns moderne Lyrik
Zusammenfassung der Kapitel
Rückgriff trotz Moderne
Dieses Kapitel beleuchtet Ingeborg Bachmanns Position in der deutschen Nachkriegsliteratur und stellt fest, dass ihr Frühwerk als ein bedeutender Beitrag zur Moderne angesehen wurde. Es wird auf die eigenständige und souveräne dichterische Leistung Bachmanns hingewiesen und gleichzeitig die Einordnung ihrer Werke in die Tradition der deutschen Klassik thematisiert. Der Fokus liegt auf dem Rückgriff auf traditionelle Formen der Lyrik, insbesondere auf die vierzeilige Strophenform, die in beiden Gedichtbänden von Bachmann prominent verwendet wird.
Die Verwendung der vierzeiligen Strophenform
Dieses Kapitel analysiert die Verwendung der vierzeiligen Strophenform in den Gedichtbänden „Die gestundete Zeit“ und „Anrufung des großen Bären“. Es wird festgestellt, dass diese Form in einer signifikanten Anzahl von Gedichten auftaucht, obwohl sie nicht die dominierende Form in Bachmanns Werk darstellt. Es werden Unterschiede in der Häufigkeit der Verwendung der vierzeiligen Strophenform in den beiden Gedichtbänden aufgezeigt, wobei die „Anrufung des großen Bären“ einen höheren Anteil an Gedichten in dieser Form aufweist. Die Länge der Gedichte, die in vierzeiligen Strophen abgefasst sind, variiert dabei deutlich. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Verwendung der vierzeiligen Strophenform im Kontext des Gesamtwerks von Ingeborg Bachmann.
Formale Merkmale
Dieses Kapitel befasst sich mit den formalen Merkmalen der vierzeiligen Strophenform in Bachmanns Lyrik. Es wird das Reimschema sowie der Strophenbau analysiert. Dabei wird festgestellt, dass der Vierzeiler als Strophenform keine festen Anforderungen an das Reimschema stellt und verschiedene Reimschemata, darunter xaxa, Kreuzreim und Paarreim, verwendet werden können.
Inhaltliche Aspekte
Dieses Kapitel beleuchtet die inhaltlichen Aspekte der vierzeiligen Strophenform in Bachmanns Gedichten. Der Fokus liegt auf der Analyse der Motive und Themen, die in den Gedichten, die in dieser Form abgefasst sind, vorkommen.
Schlüsselwörter
Ingeborg Bachmann, deutsche Nachkriegsliteratur, Moderne, Lyrik, Gedichtbände, „Die gestundete Zeit“, „Anrufung des großen Bären“, vierzeilige Strophenform, Formale Merkmale, Inhaltliche Aspekte, Reim, Strophenbau, Motive, Themen, Literaturgeschichte, Romantik, Symbolismus.
- Quote paper
- Ariane Wischnik (Author), 2003, Die Verwendung der vierzeiligen Strophenform in den Gedichtbänden Ingeborg Bachmanns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13155