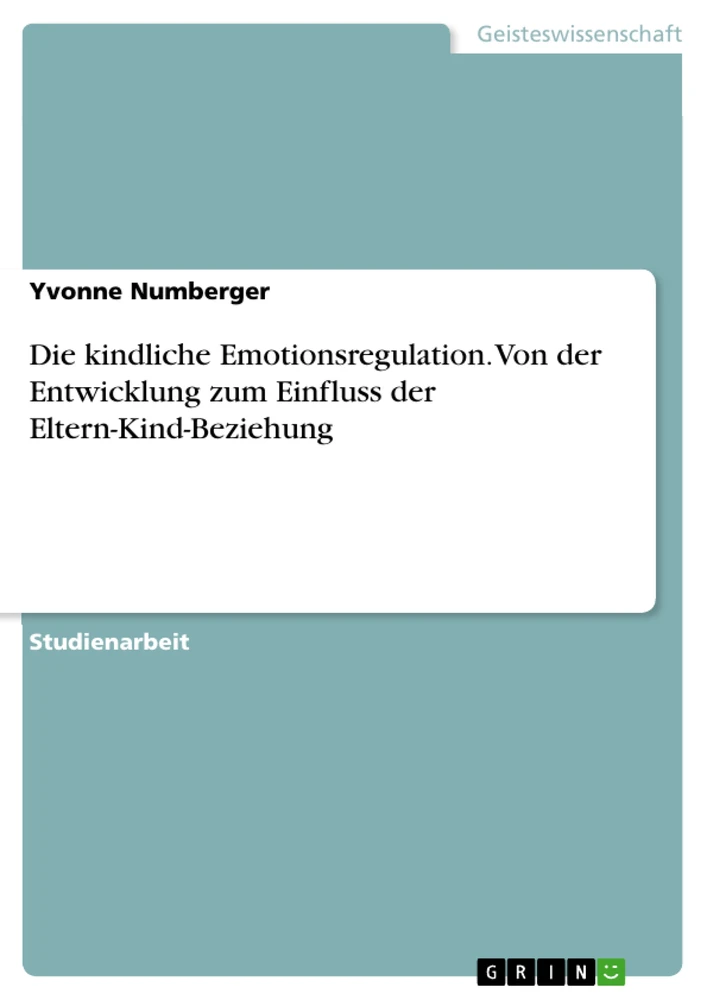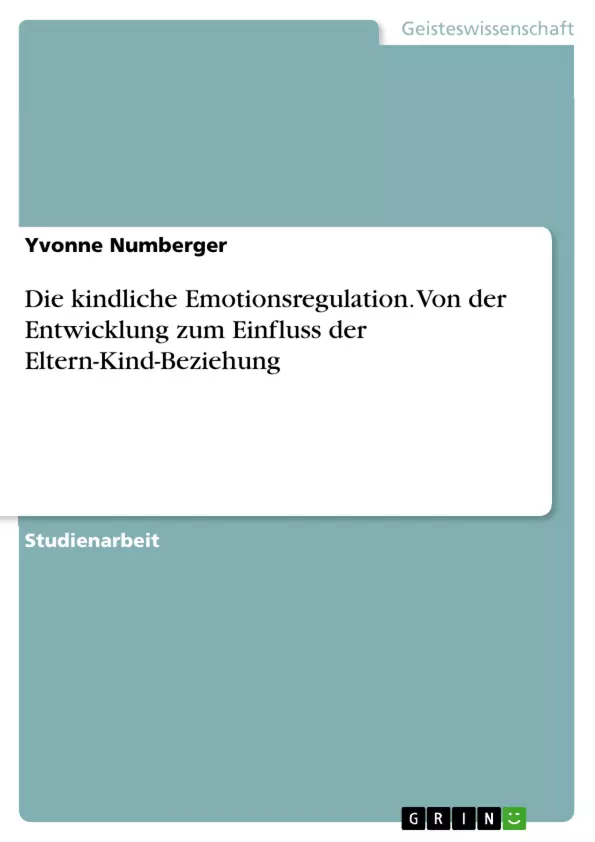Insbesondere die Eltern-Kind-Beziehung scheint eine essenzielle Rolle in der Entwicklung der Emotionsregulation zu spielen. Diese beiden Bereiche, die Entwicklung der Emotionsregulation in der Kindheit und die Beziehung zu den Eltern, werden in der vorliegenden Arbeit in Beziehung gesetzt und daraus die eigentliche Fragestellung abgeleitet. Wie entwickelt sich die kindliche Emotionsregulation und welchen Einfluss hat die Eltern-Kind-Beziehung auf die Entwicklung der Emotionsregulation bei ihrem Kind?
Regulierungsprobleme begegnen uns allen tagtäglich, ob im Privat- wie auch Arbeitsleben, in der Interaktion mit Familienangehörigen, Freunden oder Kollegen. Wie Ralf Oerter und Leo Montada es treffend beschreiben, versetzt die Fähigkeit zur Emotionsregulation eine Personen in die Lage, die Wirkung der eigenen Emotionen beeinflussen zu können und sie nicht einfach nur über sich ergehen zu lassen.
Das Lernen von Emotionsregulationsstrategien scheint zudem eine der wichtigsten Entwicklungsaufgaben darzustellen, die eng mit dem emotionalen Wohlbefinden, der sozialen Kompetenz und dem Risiko für die Entwicklung von emotionalen Störungen verbunden ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relevanz
- 1 Was bedeutet Emotionsregulation
- 2 Die Entwicklung der Emotionsregulation im Kindesalter
- 3 Der Einfluss der Eltern-Kind-Beziehung auf die Entwicklung der Emotionsregulation bei Ihrem Kind
- 4 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der kindlichen Emotionsregulation und den Einfluss der Eltern-Kind-Beziehung auf diesen Prozess. Das Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen diesen beiden Bereichen aufzuzeigen und ein besseres Verständnis für die Bedeutung der Emotionsregulation in der frühen Kindheit zu entwickeln.
- Definition und Konzepte der Emotionsregulation
- Entwicklungsstufen der Emotionsregulation im Kindesalter
- Rolle der Eltern-Kind-Beziehung in der Emotionsregulation
- Einflussfaktoren auf die Emotionsregulation (genetisch, biologisch, umweltbedingt)
- Bedeutung der Emotionsregulation für die psychosoziale Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Emotionsregulation ein und erläutert die Relevanz des Themas. Der Autor beschreibt sein persönliches Interesse an diesem Forschungsfeld, ausgelöst durch den Studienbrief zur Emotionspsychologie. Die zentrale Fragestellung der Arbeit wird formuliert: Wie entwickelt sich die kindliche Emotionsregulation, und welchen Einfluss hat die Eltern-Kind-Beziehung darauf?
Relevanz: Dieses Kapitel unterstreicht die allgegenwärtige Bedeutung der Emotionsregulation im privaten und beruflichen Leben. Es wird auf die Auswirkungen von Problemen in der Emotionsregulation hingewiesen, sowohl auf das emotionale Wohlbefinden als auch auf die soziale Kompetenz und das Risiko für die Entwicklung emotionaler Störungen. Die Studie betont die essentielle Rolle der Emotionsregulation für die emotionale und soziale Entwicklung und hebt den Einfluss der Eltern-Kind-Beziehung hervor. Forschungsergebnisse zeigen, dass Kinder in geschützten Familienumfeldern über bessere Emotionsregulationsfähigkeiten verfügen.
1 Was bedeutet Emotionsregulation: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Definitionen und Betrachtungsweisen von Emotionsregulation in der Fachliteratur. Es wird der dynamische Charakter dieses Prozesses hervorgehoben, der die Beeinflussung der eigenen Gefühle umfasst, sowohl durch extrinsische als auch intrinsische Prozesse. Die Definitionen von Gross und Thompson werden im Detail analysiert, wobei die zielgerichtete Natur der Emotionsregulation und die Unterscheidung zwischen extrinsischen und intrinsischen Prozessen betont wird.
Schlüsselwörter
Emotionsregulation, kindliche Entwicklung, Eltern-Kind-Beziehung, psychosoziale Entwicklung, Emotionsregulation Strategien, Einflussfaktoren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Entwicklung der kindlichen Emotionsregulation und der Einfluss der Eltern-Kind-Beziehung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der kindlichen Emotionsregulation und den Einfluss der Eltern-Kind-Beziehung auf diesen Prozess. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen beiden Bereichen aufzuzeigen und ein besseres Verständnis für die Bedeutung der Emotionsregulation in der frühen Kindheit zu entwickeln.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Konzepte der Emotionsregulation, Entwicklungsstufen der Emotionsregulation im Kindesalter, die Rolle der Eltern-Kind-Beziehung in der Emotionsregulation, Einflussfaktoren auf die Emotionsregulation (genetisch, biologisch, umweltbedingt) und die Bedeutung der Emotionsregulation für die psychosoziale Entwicklung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Relevanz des Themas, ein Kapitel, das sich mit der Definition von Emotionsregulation auseinandersetzt, ein Kapitel zur Entwicklung der Emotionsregulation im Kindesalter und ein Ausblick.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in das Thema der Emotionsregulation ein und erläutert dessen Relevanz. Der Autor beschreibt sein persönliches Interesse an diesem Forschungsfeld und formuliert die zentrale Fragestellung: Wie entwickelt sich die kindliche Emotionsregulation, und welchen Einfluss hat die Eltern-Kind-Beziehung darauf?
Welche Relevanz hat die Emotionsregulation?
Das Kapitel zur Relevanz unterstreicht die Bedeutung der Emotionsregulation im privaten und beruflichen Leben. Es werden die Auswirkungen von Problemen in der Emotionsregulation auf das emotionale Wohlbefinden, die soziale Kompetenz und das Risiko für die Entwicklung emotionaler Störungen aufgezeigt. Die essentielle Rolle der Emotionsregulation für die emotionale und soziale Entwicklung und der Einfluss der Eltern-Kind-Beziehung werden hervorgehoben. Forschungsergebnisse zeigen, dass Kinder in geschützten Familienumfeldern über bessere Emotionsregulationsfähigkeiten verfügen.
Wie wird Emotionsregulation definiert?
Das Kapitel "Was bedeutet Emotionsregulation?" beleuchtet verschiedene Definitionen und Betrachtungsweisen von Emotionsregulation in der Fachliteratur. Der dynamische Charakter dieses Prozesses, der die Beeinflussung der eigenen Gefühle durch extrinsische und intrinsische Prozesse umfasst, wird hervorgehoben. Die Definitionen von Gross und Thompson werden im Detail analysiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Emotionsregulation, kindliche Entwicklung, Eltern-Kind-Beziehung, psychosoziale Entwicklung, Emotionsregulationsstrategien und Einflussfaktoren.
- Quote paper
- Yvonne Numberger (Author), 2020, Die kindliche Emotionsregulation. Von der Entwicklung zum Einfluss der Eltern-Kind-Beziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1316107