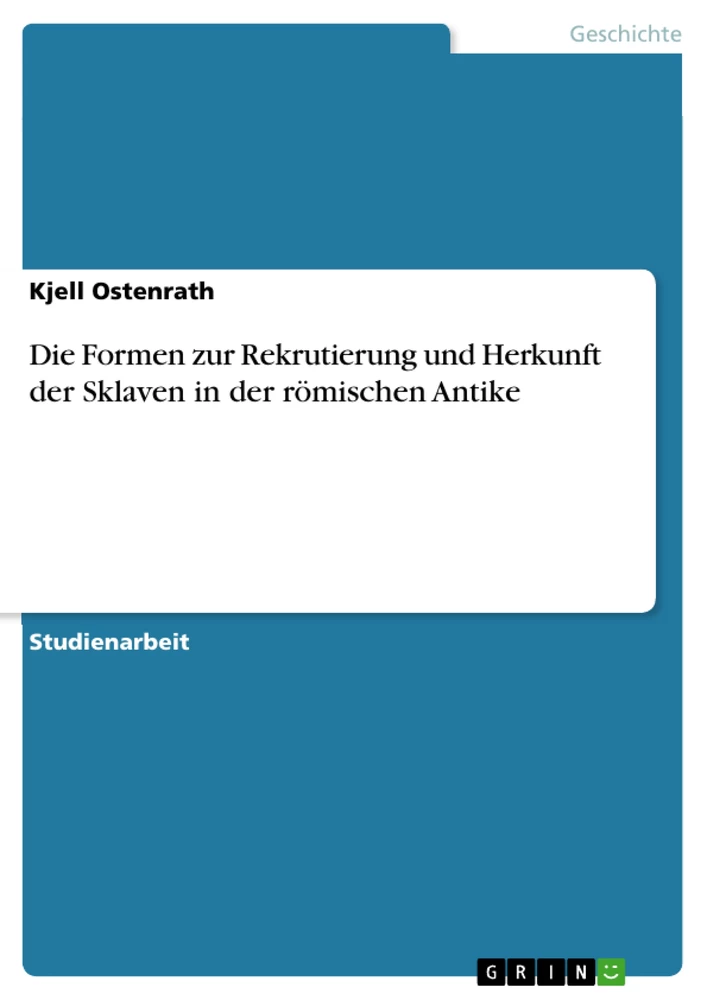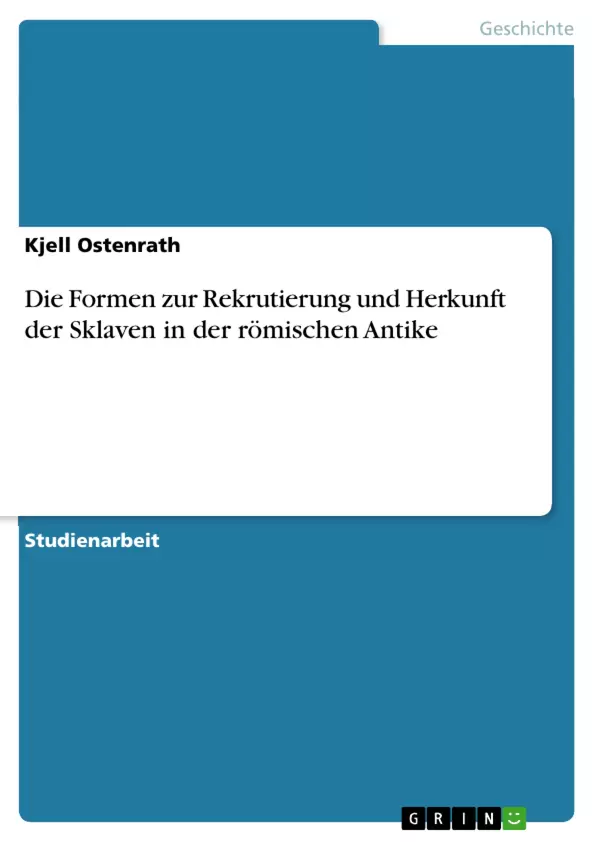Es soll in dieser Arbeit vorrangig der Frage zur Rekrutierung und Herkunft der Sklaven im Alten Rom nachgegangen werden. Woher kamen die Sklaven, und auf welche Art und Weise wurden sie zu Sklaven gemacht? Bedingt durch die Geschichte der Ausbreitung des römischen Reiches, beleuchtet diese kleine Arbeit die republikanische Zeit bis hin zu den Zeiten des Prinzipats. Der Fokus wird dabei zunächst auf die allgemeine Typologie des Unfreiseins gelenkt. Anschließend sollen die Hauptmerkmale zur Rekrutierung der Sklaven wie Kriegsgefangenschaft bis hin zu Menschenraub, untersucht werden. Danach wird der Versuch unternommen, die Herkunft der Sklaven in der römischen Gesellschaft zu ergründen. Abschließend wird resümierend ein Fazit zur Rekrutierung und Herkunft dieses unfreien Personenstandes in der römischen Antike gezogen. Die dabei verwendete Literatur entspricht weitestgehend dem neueren Forschungsstand. Ebenfalls werden zur Verifizierung einige wichtige Quellen von Autoren der Antike und römischen Geschichtsschreibern hinzugezogen. Die Monographien der Historiker Flaig und Schumacher stellen den Leitfaden für diese kleine Untersuchung dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Typologie personaler Unfreiheit in der Antike
- Die Rekrutierung der Sklaven
- Krieg und Gefangenschaft
- Piraterie
- Schuldknechtschaft
- Menschenraub und Menschenhandel
- Die Herkunft römischer Sklaven
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rekrutierung und Herkunft der Sklaven im Alten Rom. Sie untersucht, woher die Sklaven kamen und wie sie zu Sklaven gemacht wurden. Die Arbeit betrachtet die republikanische Zeit bis hin zu den Zeiten des Prinzipats und beleuchtet die Typologie des Unfreiseins sowie die Hauptmerkmale der Sklavenrekrutierung, wie z. B. Kriegsgefangenschaft und Menschenraub. Der Fokus liegt auf der Ergründung der Herkunft der Sklaven in der römischen Gesellschaft.
- Typologie der Unfreiheit in der Antike
- Methoden der Sklavenrekrutierung
- Die Herkunft der Sklaven
- Die soziale Situation von Sklaven
- Die Auswirkungen der Sklaverei auf die römische Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung skizziert die Bedeutung der Sklaverei als ein wesentliches Element der antiken Gesellschaftsordnungen. Sie betont die Schwierigkeit, die antike Alltagswelt zu verstehen, sowohl aufgrund der zeitlichen Distanz als auch wegen unserer humanistisch geprägten Bildungsideale. Die Einleitung stellt fest, dass Sklaven in verschiedenen Bereichen des römischen Lebens tätig waren, von der Oberschicht bis hin zu einfachen Arbeiten.
Zur Typologie personaler Unfreiheit in der Antike
Dieses Kapitel analysiert verschiedene Formen der Unfreiheit in der Antike, insbesondere die Sklaverei als Privateigentum und als Eigentum von Institutionen. Es betrachtet die Sklaven als "ständige Fremde" und untersucht den Prozess der Entsozialisierung, Entpersonalisierung, Entsexualisierung und Entzivilisierung, dem sie unterworfen waren. Die Sklaven verloren ihre Heimat, ihr soziales Umfeld, ihre Familien und ihre Kultur.
Die Rekrutierung der Sklaven
Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Methoden der Sklavenrekrutierung in der römischen Antike. Es untersucht den Krieg und die Gefangenschaft als eine der Hauptquellen für Sklaven, sowie Piraterie, Schuldknechtschaft und Menschenhandel.
Schlüsselwörter
Sklaverei, Antike, Römisches Reich, Unfreiheit, Rekrutierung, Herkunft, Kriegsgefangenschaft, Piraterie, Schuldknechtschaft, Menschenraub, Menschenhandel, soziale Strukturen, Gesellschaftsordnung, Entsozialisierung, Entpersonalisierung, Entsexualisierung, Entzivilisierung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurden Menschen im Alten Rom zu Sklaven gemacht?
Die Hauptquellen der Rekrutierung waren Kriegsgefangenschaft, Piraterie, Schuldknechtschaft sowie Menschenraub und Menschenhandel.
Welche Gebiete umfasste die Herkunft der römischen Sklaven?
Die Sklaven stammten aus den verschiedenen Gebieten, die das Römische Reich während seiner Ausbreitung von der Republik bis zum Prinzipat eroberte.
Was bedeutet "Entpersonalisierung" im Kontext der Sklaverei?
Es beschreibt den Prozess, bei dem Sklaven ihre Heimat, Kultur, sozialen Bindungen und ihre rechtliche Persönlichkeit verloren und als Privateigentum behandelt wurden.
In welchen Bereichen wurden Sklaven im Römischen Reich eingesetzt?
Sklaven arbeiteten in fast allen Bereichen, von hochqualifizierten Tätigkeiten in der Oberschicht bis hin zu körperlich schwerer Arbeit.
Welche Historiker dienten als Leitfaden für diese Untersuchung?
Die Arbeit stützt sich maßgeblich auf die Monographien der Historiker Egon Flaig und Leonhard Schumacher.
- Quote paper
- Kjell Ostenrath (Author), 2010, Die Formen zur Rekrutierung und Herkunft der Sklaven in der römischen Antike, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1316470