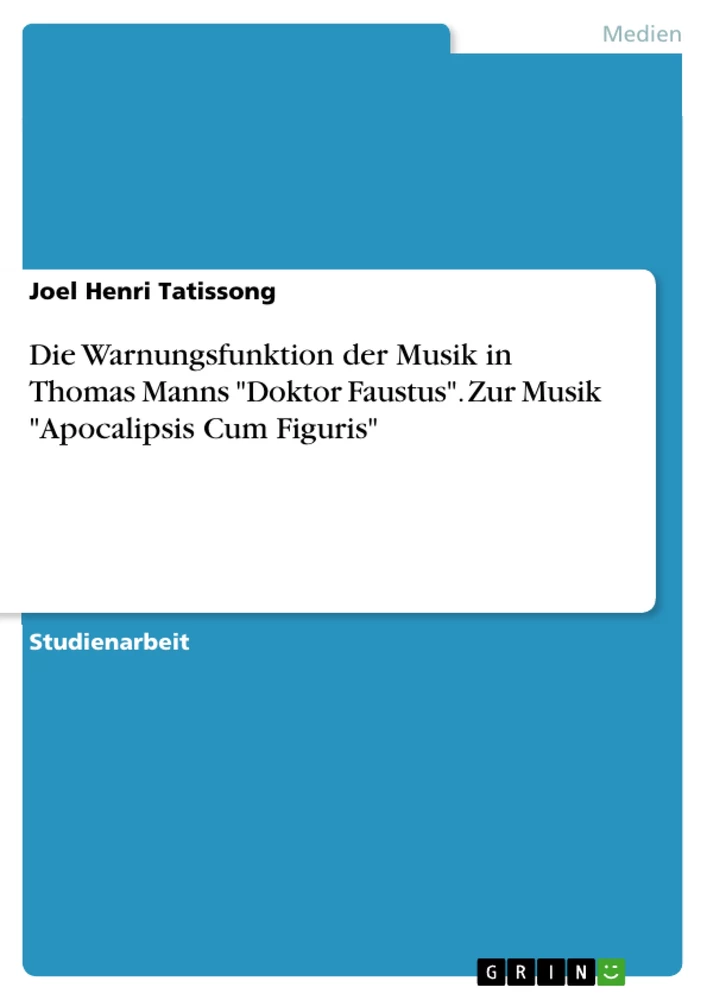Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, d.h. 1947 veröffentlicht der amerikanische Exilant Thomas Mann seinen umfangreichen Kapitel- bzw. Musik-Roman "Doktor Faustus", in dem der Erzähler Serenus Zeitblom von der faszinierenden und provotierenden Biographie seines Freundes, des deutschen, musikalisch hochbegabten Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt. Leverkühns ganze Lebensgeschichte ist in Deutschland angesiedelt; seine fortwährenden musikalischen Engagements, hinter denen die das zwanzigste Jahrhundert zeitigende Katastrophe und das durchaus zerfallende Deutschland auf ganz metaphorische Weise zurückbleibt, lassen lediglich Gedanken an die sprachlich-literarische Umsetzung der Musik und deren funktionierende Dimension im Text entstehen. Vor allem aber zeigt sich, dass der schon seit seiner Veröffentlichung vieldiskutierte Roman, bestehend aus siebenundvierzig Kapiteln, nämlich im Spiegel musiktheoretischer, musikoliterarischer, politisch-historischer, kulturtheoretischer und philosophischer Perspektiven steht.
Da das Romanganze in Thomas Manns "Doktor Faustus" nahezu zwei musikalisch inhaltsheterogene Hauptmusikstücke vor Augen führt, ist das vielsagende "Oratorium Apocalipcis cum figuris" von Interesse in der folgenden angelegten Studie. Dieses Oratorium, das zugleich im vierunddreißigsten Kapitel geschildert und aufgeführt wird, befähigt durch seine erzählerische Kompositionstechnik eine reichliche Gewinnung verschiedener Erkenntnisse im Rahmen des apokalyptischen Diskurses. Auf die Frage hin, inwiefern es Leverkühns religiös visionsbedingtem Chorwerk gelingt, den kulturellen, sozialen und politischen Untergang Deutschlands zu prophezeien, liegt die Vermutung nahe, dass Leverkühn sich durch geniale Kräfte des heterogenen Materials apokalyptischen Diskurses bedient, um diesen Untergang musikalisch in Szene zu setzen. Biblisch-johanneische und babylonische Vernichtungsbilder sind in diesem Sinne eine Art Rehabilitierung des Schicksals des alten Jerusalems bzw. der Israeliten in dem deutschen Kontext, indem die Warnungsfunktion der apokalyptischen Musik ins Spiel kommt. Die Studie wirft in ihrer Gliederung einen angerissenen Blick auf die Deutungsversuche der Musik und Apokalypse und deren Eingang in die Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts. Dann wird auf die Analyse von Leverkühns Chorwerk "Apocalipsis cum figuris" eingegangen, indem die Entstehungsgeschichte, vorkommenden Formen und Funktion der apokalyptischen Musik gründlich durchgeforstet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. THEORIE. MUSIK UND APOKALYPSE
- 1. Zum Musikbegriff: Musik und/in Literatur
- 2. Zum Apokalypsebegriff: Apokalypse und/in Literatur
- 3. Apokalyptische Musik
- II. ZU APOKALIPSIS CUM FIGURIS IN THOMAS MANNS DOKTOR FAUSTUS
- 1. Entstehungsgeschichte von Apocalipsis cum figuris
- 2. Die Bedeutung des Genies für musikalische Kompositionen
- 3. Formen der Apokalypse in Apokalipsis cum Figuris
- 4. Warnungsfunktion der Musik: Untergangsvisionen der deutschen Gesellschaft
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie untersucht die Warnungsfunktion der Musik im Kontext von Thomas Manns "Doktor Faustus", insbesondere im Musikstück "Apocalipsis cum figuris". Die Arbeit analysiert die Rolle der Musik als Medium, das den kulturellen, sozialen und politischen Untergang Deutschlands prophezeit.
- Das Werk analysiert die Verbindung zwischen Musik und Apokalypse im 20. Jahrhundert.
- Die Studie beleuchtet die Bedeutung des "Genies" für musikalische Kompositionen.
- Die Arbeit untersucht die verschiedenen Formen der Apokalypse in "Apocalipsis cum figuris".
- Die Studie analysiert die Rolle der Musik als Warnung vor dem Untergang der deutschen Gesellschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext des Romans "Doktor Faustus" und die Bedeutung der Musik für das Werk dar. Das erste Kapitel erörtert die Begriffe "Musik" und "Apokalypse" im literarischen Kontext. Es werden verschiedene Aspekte der musikalischen Klangsprache und ihre Bedeutung für die Darstellung von Untergangsvisionen beleuchtet. Das zweite Kapitel analysiert Leverkühns Werk "Apocalipsis cum figuris" im Detail und untersucht die Entstehungsgeschichte, die vorkommenden Formen der Apokalypse und die Funktion der Musik als Warnung.
Schlüsselwörter
Musik, Apokalypse, Apokalyptische Musik, Thomas Mann, "Doktor Faustus", "Apocalipsis cum figuris", Untergangsvisionen, deutsche Gesellschaft, Warnungsfunktion.
- Quote paper
- Joel Henri Tatissong (Author), 2022, Die Warnungsfunktion der Musik in Thomas Manns "Doktor Faustus". Zur Musik "Apocalipsis Cum Figuris", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1316568