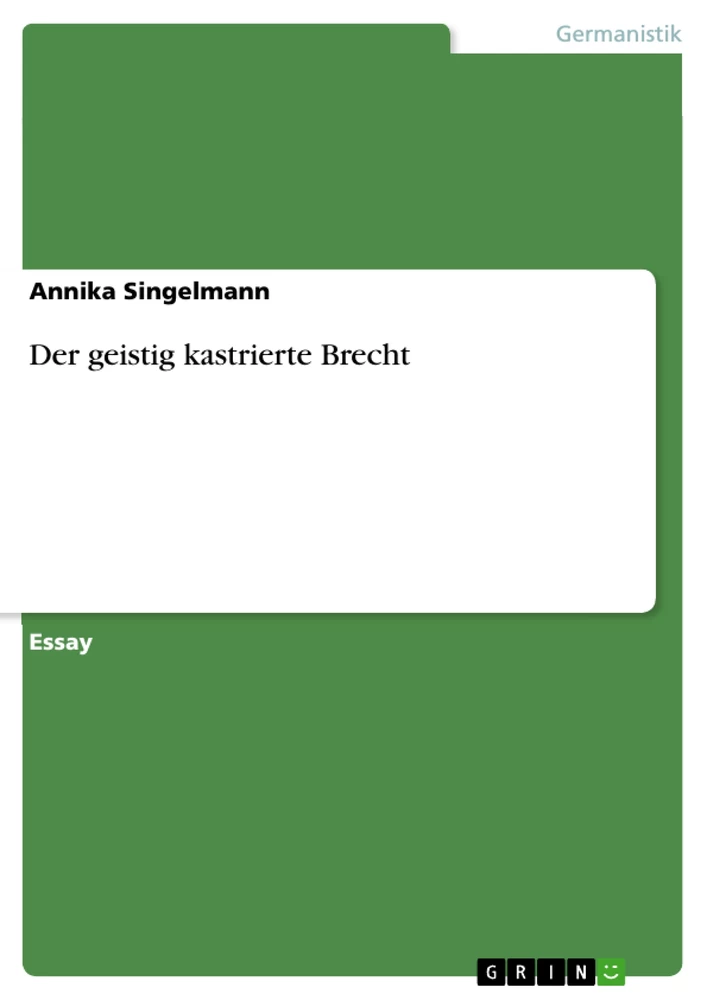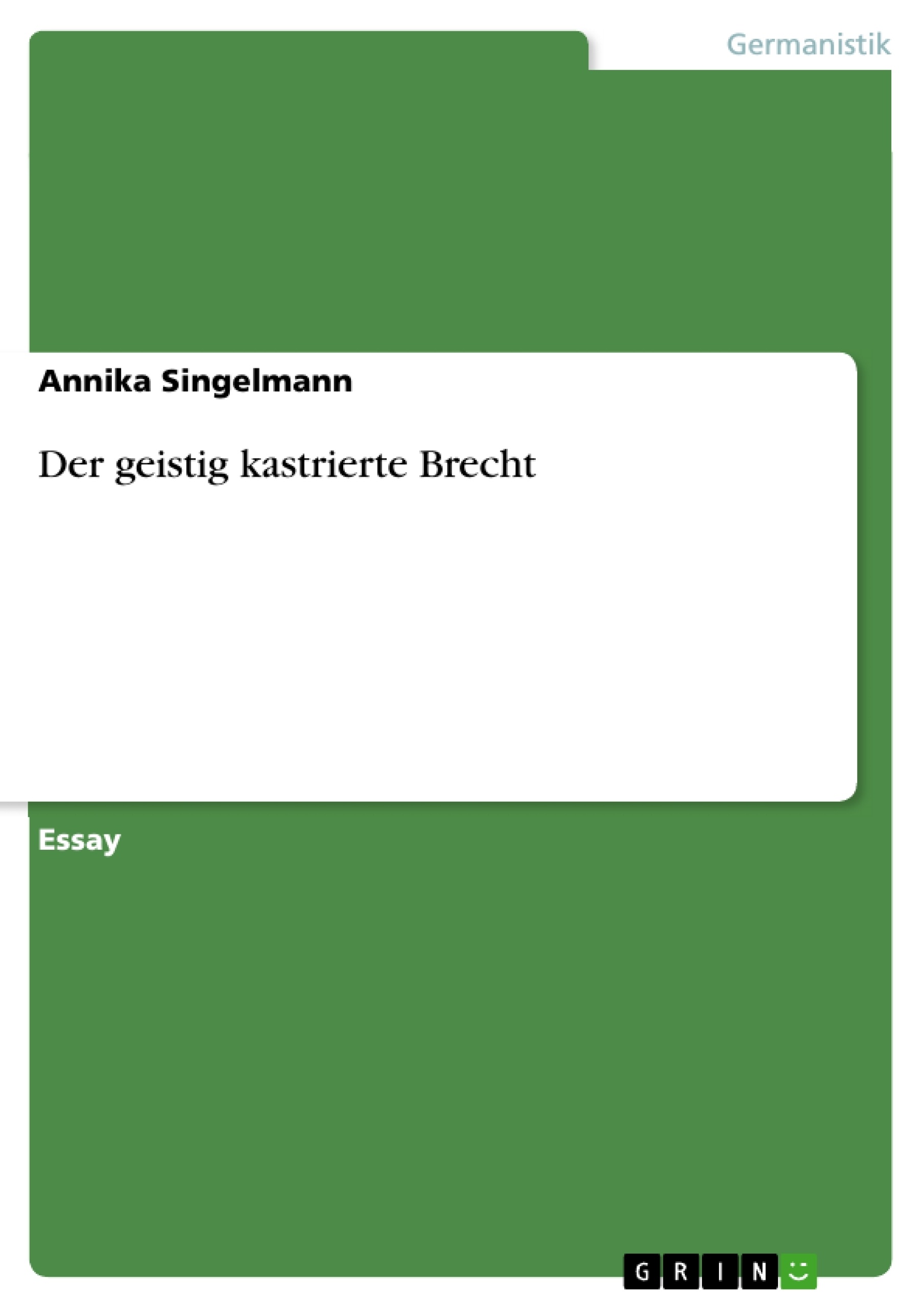Essay: Der geistig kastrierte Brecht
Brechts Bearbeitung des Lenzschen Hofmeister kann als Geniestreich oder auch als seine eigene Misere betrachtet werden. Sie ist Dokument für die ‚deutsche Misere’, die geistige Kastration des Individuums, des gesamten deutschen Volkes, durch die ausbleibende Revolution und den Akt der Anpassung. Indessen aber auch gleichsamer Beleg für den kastrierten Künstler Brecht, der in seiner Freiheit durch die kulturpolitischen Vorgaben der damaligen DDR beschnitten wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Die 1950 erschiene bzw. aufgeführte Bearbeitung des Hofmeisters von Jacob Michael Reinhold Lenz hat einige Intentionen und Motivationen.
- Der Sozialistische Realismus dominierte auch in der DDR die ideologische Fest-schreibung der künstlerischen Methoden.
- Jedoch zeigen sich bereits bei der Stück-Auswahl Brechts Vorbehalte gegenüber dem Realismusverständnis der Kulturdoktrin.
- Bereits Engels betitelte die deutsche Geschichte, als „eine einzige fortlaufende Misé-re❝3 seit dem Fehlschlagen der deutschen bürgerlichen Revolution des 16. Jahrhunderts und die darauf folgenden Jahrhunderte der Unterwerfung.
- Im Lenzschen Drama findet Brecht die Entsprechung seiner Anklagen und Vorbehalte.
- Brechts Bearbeitung hat eine Zeitspanne von ca. 150 Jahre Zeitgeschehen zur Origi-nalvorlage zu überbücken.
- Das Verhältnis von Original und Bearbeitung findet ihren Unterschied also aus der veränderten Gegenwartsperspektive.
- Im Lenzschen Hofmeister und gerade in Brechts Bearbeitung ist die Kastration, als Akt der Anpassung, um in der realen Welt bestehen zu können, das Schlüsselmotiv.
- Indes findet sich eine Entsprechung Brechts mit der Figur des Pätus.
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Bertolt Brechts Bearbeitung des Lenzschen Hofmeisters und untersucht die Intentionen und Motivationen Brechts, die sich aus der kulturpolitischen Situation der DDR und Brechts eigener künstlerischer Position ergeben. Die Arbeit beleuchtet die Kritik Brechts am Sozialistischen Realismus und seine Auseinandersetzung mit der „deutschen Misere“, die er als eine fortdauernde gesellschaftliche Problematik sieht.
- Brechts Kritik am Sozialistischen Realismus und seine Auseinandersetzung mit der „deutschen Misere“
- Die Rolle der Kastration als Symbol für die Unterdrückung des Individuums und die Anpassung an gesellschaftliche Zwänge
- Die Bedeutung des „epischen Theaters“ für Brechts künstlerische Praxis und seine Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft
- Die Analyse der Figurenkonzeption und der Handlungsstruktur in Brechts Bearbeitung des Hofmeisters
- Die Verbindung von Brechts eigener künstlerischer Situation mit der des Hofmeisters als Symbol für die „geistige Kastration“ des Künstlers
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die historische und politische Situation der DDR, in der Brechts Bearbeitung des Hofmeisters entstand. Sie beleuchtet die dominierende Ideologie des Sozialistischen Realismus und die damit verbundenen künstlerischen Vorgaben. Anschließend wird Brechts eigene Position im Kontext dieser Vorgaben dargestellt, wobei seine Kritik am Realismusverständnis der Kulturdoktrin und seine Auseinandersetzung mit der „deutschen Misere“ im Vordergrund stehen. Die Arbeit analysiert die Figurenkonzeption und die Handlungsstruktur in Brechts Bearbeitung des Hofmeisters und zeigt auf, wie Brecht die „deutsche Misere“ als eine fortdauernde gesellschaftliche Problematik darstellt. Die Arbeit untersucht die Rolle der Kastration als Symbol für die Unterdrückung des Individuums und die Anpassung an gesellschaftliche Zwänge. Sie beleuchtet die Bedeutung des „epischen Theaters“ für Brechts künstlerische Praxis und seine Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft. Abschließend wird die Verbindung von Brechts eigener künstlerischer Situation mit der des Hofmeisters als Symbol für die „geistige Kastration“ des Künstlers dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Bertolt Brecht, Jacob Michael Reinhold Lenz, Der Hofmeister, Sozialistischer Realismus, deutsche Misere, Kastration, Anpassung, episches Theater, künstlerische Freiheit, Unterdrückung, Gesellschaft, Kulturpolitik, DDR.
- Arbeit zitieren
- Annika Singelmann (Autor:in), 2007, Der geistig kastrierte Brecht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131662