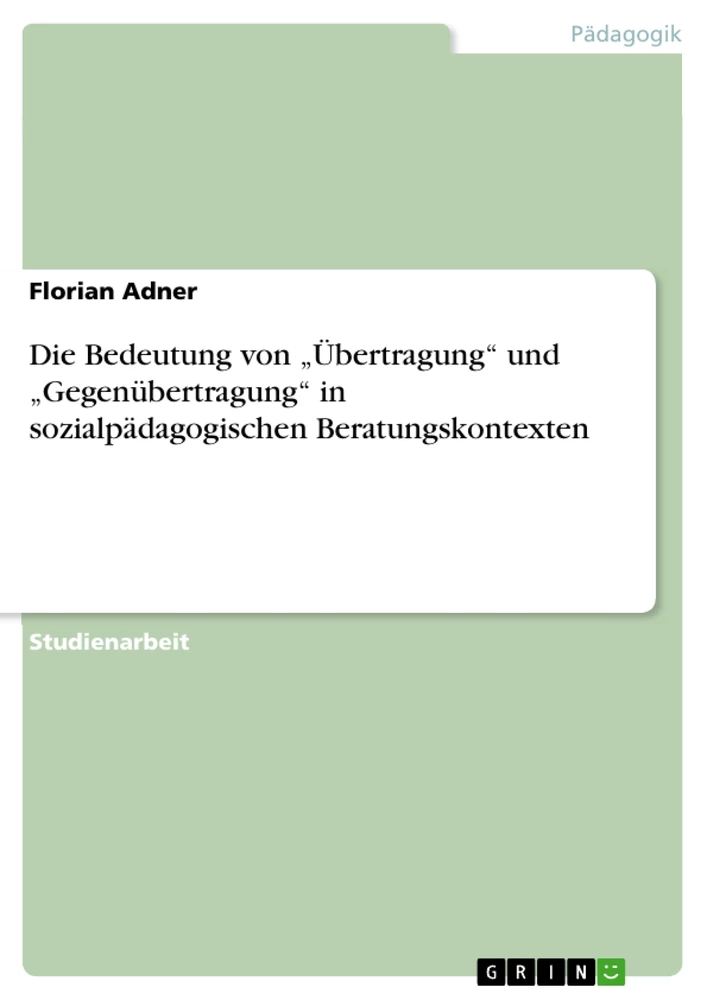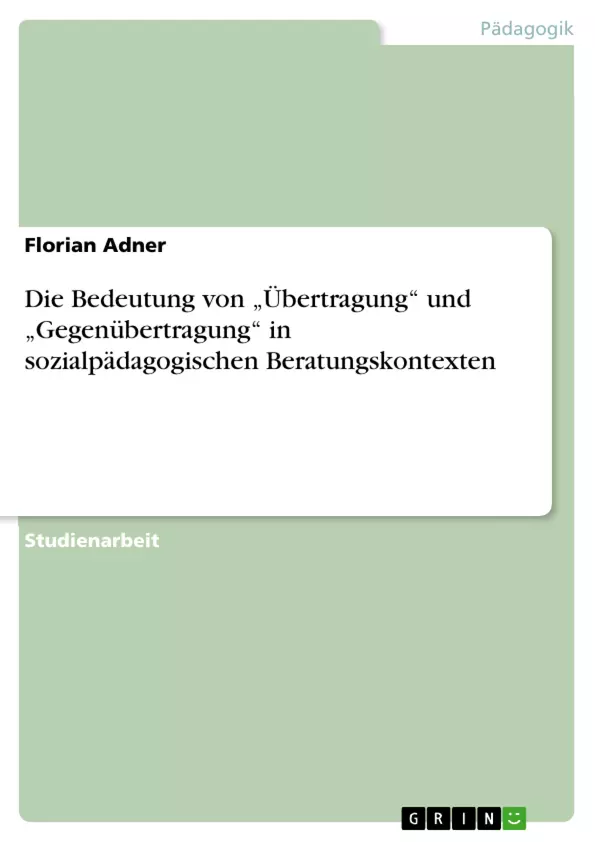Die Hausarbeit zeigt die Bedeutung des psychoanalytischen Modells der "Übertragung" und "Gegenübertragung" für Professionelle in pädagogischen Handlungsfeldern. Es soll der praxisnahen Frage nachgegangen werden, inwiefern entstehende Gefühle der Professionellen mit dem Konzept der „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ zu erklären sind.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Beratung in der Sozialen Arbeit
2.1. Was bedeutet Beratung ?
2.2 Beratung in der Sozialen Arbeit
2.3. „Nähe“ und „Distanz“ als Spannungsfeld der in sozialpädagogischen Beratungskontexten
3. „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ in der Struktur des „Arbeitsbündnis“ nach Oevermann
4. „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ in Beratungskontexten der Sozialen Arbeit
4.1. „Übertragung“
4.2 „Gegenübertragung“
4.3 „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ in der Sozialen Arbeit
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Das Forschungsinteresse der folgenden Ausarbeitung liegt auf der Bedeutung von „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ in Beratungskontexten der Sozialen Arbeit. Damit wird eine Verknüpfung von einem sozialpädagogischen Handlungsfeld (vgl. Sickendiek et al. 1999, S. 13) der professionellen Beratung, mit einem essentiellen Bestandteil der psychoanalytischen Therapie, nämlich der „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ (vgl. Mertens 1998, S. 169) hergestellt. Es soll der praxisnahen Frage nachgegangen werden, inwiefern entstehende Gefühle der Professionellen mit dem Konzept der „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ zu erklären sind.
Aus einer möglichen Erkenntnis des Ursprungs der Gefühle ergibt sich die Frage nach dem Umgang mit den entstandenen Gefühlen bei den Professionellen. Hierfür bietet bereits Oevermann (2002) mit der „Abstinenzregel“ eine erste Handlungsanweisung für die Professionellen. Allerdings findet in dessen Ausarbeitungen keine tiefgreifende theoretische Auseinandersetzung mit dem Psychoanalytischen Konzept der „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ statt. Dieses wird vielmehr vorausgesetzt. Dementsprechend hat die folgende Ausarbeitung den Anspruch, jenes Konzept auf die sozialpädagogische Arbeit angepasst darzustellen. Zu Beginn wird der Begriff der Beratung, der in der heutigen Zeit inflationär genutzt wird, für professionelle Beratung generell definiert (vgl. Sickendiek & Nestmann 2018, S. 217-218). Im Anschluss daran werden die Besonderheit von und für Beratung in sozialpädagogischen Kontexten erörtert. Jene Eingrenzung dient als thematische Einordnung für die folgende Verknüpfung mit dem Psychoanalytischen Konzept der „Übertragung“ und „Gegenübertragung“. Als Zwischenschritt wird vorher noch das „Arbeitsbündnis“ nach Oevermann (2002) vorgestellt. Darin wird theoretisch begründet, warum diese Verknüpfung von hoher Bedeutung für die (sozial-)pädagogische Praxis ist. Im Anschluss daran wird das Konzept der „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ ausführlicher dargestellt. Dies dient als Voraussetzung für die darauf aufbauende Anwendung eben jenen Konzeptes auf die sozialpädagogische Arbeit. In einem Fazit wird resümiert, inwiefern die Ausarbeitung als Hilfeangebot für Professionelle dienen kann, um innerpsychische Prozesse im Verlauf der Beratung verstehen zu können und womöglich adäquat auf die Übertragungen reagieren zu können.
2. Beratung in der Sozialen Arbeit
Der Begriff „Beratung“ begegnet uns nahezu überall im Alltag. Ob es sich auf individueller Ebene um das Einkäufen oder Geldanlegen handelt oder in größeren Organisationszusammenhängen wie Unternehmen und der Politik ereignet, es wird beraten. Beratung ist ein fester Bestandteil des modernen Lebens geworden. Die Gestaltung der Beratung kannje nach Kontext stark variieren, wie etwa face-to-face, telefonische Beratung oder via Software, zeigen. Auch in der Sozialen Arbeit ist Beratung ein zentraler Handlungsansatz zahlreicher Arbeitsfelder. Es kann sogar ein eigenes Hilfeformat in Form von Beratungsstellen angeboten werden. In Abgrenzung zu anderen Formen der Beratung ist all den sozialarbeiterischen Angeboten der Beratung gemein, dass es sich meist um kritische Lebenssituationen der Ratsuchenden handelt. Häufig sind wesentliche Aspekte ihrer Lebensführung Themen der Beratungssituation. Durch die alltägliche Nutzung des Begriffs „Beratung“ ist es für Professionelle von hoher Bedeutung, methodische Besonderheiten des Beratens zu erkennen und eine professionelle Handlungsorientierung in beratenden Rollen einzunehmen. (Vgl. Sickendiek & Nestmann 2018, S. 217-218)
2.1. Was bedeutet Beratung ?
Da der Begriff „Beratung“, wie bereits erwähnt, heute in den unterschiedlichsten Kontexten genutzt wird, ist eine Definition für die folgende Ausarbeitung notwendig. Aufgrund der diversen Nutzung im informellen wie auch professionellen Rahmen ist diesjedoch nicht so einfach. Die folgende Definition nach Sickendiek und Nestmann (2018) ist ein Versuch der Komplexität des Beratungsbegriffs gerecht zu werden und soll als Grundlage für weitere Ausführungen dienen:
„Professionelle Beratung ist Kommunikation über Fragen, Anliegen und Schwierigkeiten einer Person, einer Gruppe oder Organisation mitjemand inhaltlich Ausgewiesenen (einer Bera- ter_in oder einem Beratungsteam, Online-Beratungs-Tools etc.), der dabei behilflich ist, die Ausgangssituation zu reflektieren, Perspektiven zu erweitern, angemessene Informationen und Lösungsmöglichkeiten zu finden, Entscheidungen vorzubereiten, Belastungen und Krisen besser bewältigen zu können und weitere Handlungsoptionen zu entwickeln. Beratung bietet Klient_innen die Möglichkeit zu „reden“ und Zuhörer_innen zu finden sowie Information und reflexive Hilfe bei der kognitiven und emotionalen Orientierung in schwer durchschaubaren, komplexen Situationen und Lebenslagen. Sie unterstützt Ratsuchende dabei, selbstbestimmt Entscheidungen treffen zu können oder sich Optionen bewusst offenzuhalten. Dabei leistet Beratung Beistand für konstruktive Zukunftsüberlegungen und das Planen erster Schritte, die aus neu gewonnen Orientierungen resultieren, und sie begleitet erstes Handeln mit Reflexionsangeboten. Kurz gefasst: Beratung ist Orientierungs-, Entscheidungs-, Pla- nungs-, und Handlungshilfe.“ (Sickendiek & Nestmann 2018, S. 218)
Jene Definition soll zunächst das konzeptionelle Verständnis für „Beratung“ dieser Hausarbeit festlegen. Nach Sickendiek und Nestmann (2018) gibt es drei mögliche Formen der Beratung. Die „informelle“ Beratung, die sich in alltäglichen Beziehungen wie Familie oder Freundschaft ereignet. Zweitens die „halbformalisierte“ Beratung, in der Angehörige verschiedener Berufsgruppen eine beratende Funktion einnehmen ohne für die Beratung spezifisch ausgebildet und angestellt zu sein. Drittens die „professionelle Beratung“. Dabei sind Beraterinnen als ausgewiesene Fachkräfte tätig. Diese strukturieren ihr Handeln anhand von Beratungstheorie und Beratungswissen. Sie sind diesbezüglich auch speziell methodisch geschult. Im Optimalfall beraten sie mit methodischem Können und reflektiert. Auf einen möglichen Bestandteil von „Reflexion“, die von Sickendiek und Nestmann nicht näher erläutert wird, wird später mit dem Fokus auf „Übertragung und Gegenübertragung“ genauer eingegangen. Außerdem soll die Beratung in definierten Rollen und in definierten Berater*in-Klient*in-Bezie- hungen stattfinden. Auch die hier nur genannten „Rollen“ werden später anhand Oevermanns „Arbeitsbündnis“ genauer beschrieben und ihre Bedeutung für ein mögliches Gelingen der Beratung verdeutlicht. (Vgl. Sickendiek & Nestmann 2018,S.219)
2.2 Beratung in der Sozialen Arbeit
Speziell die Beratung in der Sozialen Arbeit findet häufig in schwierigen oder bereits krisenhaften Lebenssituationen statt. Nichtsdestotrotz kann das Angebot eine „präventive“, „akut problembewältigende“ und „rehabilitative“, wieder normalisierende Aufgabe erfüllen. Grundsätzlich bietet die Beratung die Möglichkeit, möglichst früh das Entstehen von Schwierigkeiten oder die Zuspitzung von bereits vorhanden Krisen zu verhindern. Sie kann aber auch bei bereits bestehenden Problemen in Anspruch genommen werden. Für die Soziale Arbeit ergibt sich die Herausforderung, dass die Lebensschwierigkeiten der Adressat*innen oft nicht in letzter Konsequenz „lösbar“ sind. Um trotzdem handlungsfähig zu bleiben, muss sich Beratung auf das Sprechen über Probleme, gemeinsames Reflektieren oder das Erarbeiten neuer emotionaler und kognitiver Verarbeitungsweisen und Handlungsmöglichkeiten beschränken. So zielt Beratung vor allem auf das Fördern und (Wieder-) Herstellen von Handlungs- und Bewältigungskompetenzen der Adressatinnen und der ihrer sozialen Umwelt. (Vgl. Sickendiek & Nestmann 2018, S. 220)
Beratung im bereits definierten Sinne ist in der Sozialen Arbeit sowohl ein eigenständiges Angebot wie auch eine „Querschschnittsmethode“ (Sickendiek et al. 1999, S. 13). So ist Beratung ein Charakteristikum für das interaktive Handeln von Professionellen in der Sozialen Arbeit. Sie ist in der psychosozialen Arbeit, egal ob in Einzel- oder Gruppenkontexten, in Betreuung, Bildung oder Erziehung, „eine der zentralen professionellen Handlungsorientierungen und eine der wichtigsten Methoden“ (Nestmann & Sickendiek 2005, S. 140). Die Beratung ist Bestandteil der Interaktion von Professionellen mit Adressat*innen in nahezu allen möglichen Handlungsfeldem der Sozialen Arbeit. Es gibt in der Gesellschaft ein differenziertes Berater*innennetzwerk, das viele Felder des Alltagslebens umfasst. So reicht das psychosoziale Beratungsangebot von „Aids-, Ausländer-, Berufs-, Ehe-, Erziehungs-, Familien-, genetischer Beratung, Gesundheits- bis zu Schuldner-, Schullaufbahn-, Schwangerschaftskonflikt-, Sexual-, Sucht-, Trennungs- und Scheidungsberatung“ (Schäfter 2010, S. 20) und viele mehr. In der großen Zahl an spezifischen Beratungsangeboten spiegelt sich das Leben in einer zunehmend komplexer werdenden Gesellschaft wider (vgl. Thiersch 1997, S. 103). (Vgl. Schäfter 2010, S. 19-20)
Im Folgenden sollen die Kennzeichen von Beratung in der Sozialen Arbeit herausgearbeitet werden. Nach Thiersch (2004) ist Beratung die „Verhandlung von Problemen und Schwierigkeiten im Medium von Gespräch und Freiwilligkeit“ (Thiersch 2004, S. 115). Allerdings muss die Freiwilligkeit unter Umständen erst hergestellt werden. Außerdem kann sozialpädagogische Beratung durch die Festlegung eines Kompetenzbereichs anhand eine Zielgruppenbestimmung, beispielsweise nach Altersgruppen, näher beschrieben werden. Aber auch eine inhaltliche Allzuständigkeit innerhalb eines festgelegten Feldes ist kennzeichnend für Beratung in der Sozialen Arbeit. Wie bereits erörtert ist eine Vielfalt von Handlungsfeldern für sozialpädagogische Beratung charakteristisch. In den einzelnen Beratungsgesprächen umfassen die Themenschwerpunkte nahezu alle Bereiche des Lebens. Häufig wird der Fokus von den Ratsuchenden selbst gelegt. Dementsprechend können Fragen zur Erziehung der Kinder, zum Asylrecht oder persönliche Schwierigkeiten Inhalt von Beratungsgesprächen sein. Der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH) definiert Beratung als ein alltägliches und lebenslanges Angebot. Auf dieses kann in verschiedenen Lebensphasen zurückgegriffen werden (vgl. DBSH 2007, S. 7). Aufgrund der dargestellten Vielfalt kann Beratungshandeln methodisch nicht auf spezifische Vorgehensweisen eingegrenzt werden. Die von den Adressat*innen Sozialer Arbeit praktizierte Lebensführung und ihre Lebensentwürfe sind insofern charakteristisch, dass sie häufig von den „gesellschaftlich dominanten Modellen einer angemessenen, anstrebenswerten oder wenigstens vernünftigen Lebensführung abweichen“ (Scherr 2004, S. 103). Es ist jedoch zu betonen, dass Professionelle jene Formen der Lebensführung und die Subjektivität der Adressat*innen zu respektieren haben, solange keine erkennbare Gefährdung vorliegt. (Vgl. Schäfter 2010, S. 21)
Ergänzend zu einer Einzelfallhilfe im oben beschriebenen Sinne versteht sich sozialpädagogische Beratung immer auch politisch. Es müssen die strukturellen Dimensionen der Lebenswelt der Adressat*innen beachtet werden. Ergänzend hierzu müssen Mechanismen und Phänomene der Exklusion mitgedacht werden (vgl. Barth 1990, S. 102). Mit Thiersch (1977), sollte sozialpädagogische Praxis „parteinehmende Praxis“ sein. Sie sollte dabei auf Persön- lichkeits- und Gesellschaftstheorie gestützt sein. Das theoretische Wissen sollte ergänzt durch reflektierte Beziehungen und das Erschließen von Hilfsquellen versuchen, das „Unterworfensein“ von Menschen unter belastenden Situationen zu verändern. Somit ist Beginn von Beratung zwar eine Interaktionjedoch sollte dort nicht verblieben werden. Es sollen auch menschliche Lebensumstände mit ihrer Mehrdimensionalität, speziell die sozioökonomische Bedingtheit, angegangen werden (vgl. Thiersch et al. 1977, S. 129). (Vgl. Schäfter 2010, S. 21)
In diesem Kapitel wurde verdeutlicht, dass Beratung eine besondere Tätigkeit sozialarbeiterischen Handelns ist. Sie findet in allen Handlungsfeldern Anwendung. Aufgrund dieser methodischen Breite ist die genauere Untersuchung der Herausforderungen, die sich im Beratungskontext ergeben, von hoher Bedeutung für alle Professionellen. Im weiteren wird sich auf das Spannungsfeld der „Nähe“ und „Distanz“ als Bestandteil einer professionellen Beziehung fokussiert, um dann auf die in dem Beratungskontext stattfindende „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ einzugehen.
2.3. „Nähe“ und „Distanz“ als Spannungsfeld in sozialpädagogischen Beratungskontexten
Die Herausforderung sich in Spannungsfeldern zu positionieren wird als Aspekt von „Professionalität“ gekennzeichnet. Das Spannungsfeld von „Nähe“ und „Distanz“ wird in der wissenschaftlichen Literatur immer wieder als beispielhaft für die sozialpädagogische Praxis beschrieben. Es wird als eine zentrale Aufgabe der Professionellen angesehen, sich in diesem angemessen zu positionieren (vgl. Becker-Lenz & Müller 2008, S. 4). Im Anschluss an die Einführung zu „Beratung“, speziell der sozialpädagogischen, wird der Fokus auf die Herausforderung des Ausagierens von „Nähe“ und „Distanz“ in eben jenen Beratungskontexten gelegt.
In der Literatur wird das Begriffspaar zur Beschreibung der Dynamik von Beziehung verwendet. So entfaltet sich eine zwischenmenschliche Beziehung im komplexen Wechselspiel zwischen den Grundbedürfnissen nach Nähe und gleichzeitig nach Abgrenzung. Für die professionelle Beratung muss eine „gewisse“ gefühlsmäßige Beziehung zwischen Professionellen und Adressat*innen entstehen. So muss sich die*der Beraterin von der*dem Ratsuchenden*m und seinen eingebrachten Schwierigkeiten oder Krisen berühren lassen. Hierbei müssen die Professionellen gleichzeitig Anteil nehmen und sich abgrenzen. Nur so können sie handlungsfähig bleiben. In diesem Sinne wird der Begriff „Distanz“ für eine Grenze bezüglich Empathie und Identifikation in der Beratung genutzt (Junker 1977, S. 304). Nach Heiner (2007) erfordert die in der professionellen Beziehung vorhandene Asymmetrie eine besondere Aufmerksamkeit und Sensibilität für eine „richtige“ Positionierung zwischen „Nähe“ und „Distanz“ (vgl. Heiner 2007, S. 470). So ist emotionale Nähe sowohl eine Voraussetzung als auch eine Gefahr gleichzeitig. Das Ausbalancieren hiervon ist kennzeichnende Aufgabe der Professionellen in der Beziehungsgestaltung. (Vgl. Schläfter 2010, S. 61-62)
Als Professionelle tragen die Beraterinnen die Verantwortung für die Beziehung zu den Adressatinnen. In diesem Sinne müssen sie die emotionale Nähe zu diesen beachten und falls notwendig steuern. Die Adressatinnen bringen ihre Krisen und Schwierigkeiten in die Beratung ein und öffnen sich hierfür in der Hoffnung auf Hilfe. Die daraus resultierenden Gefühle, wie Hoffnungslosigkeit, Scham oder Angst lassen ein Bedürfnis von Nähe bei den Betroffenen entstehen. Durch Selbstöffnung entsteht Nähe. Eine hoher Anteil von Adressatinnen sozialpädagogischer Beratungen hat Beziehungsabbrüche und -enttäuschungen erlebt. Dementsprechend erleben sie die wertschätzende, akzeptierende Haltung der Professionellen als besonders angenehm. Auch durch die Anteilnahme und Empathie der Beratenden entsteht Nähe in denjeweiligen Beziehungen. Der Beratung geht es darum, die Adressatinnen zu entlasten. In der Beratungsbeziehung haben die Professionellen eine gebende, zuhörende Rolle. Sie orientieren sich dabei an den Bedürfnissen der Ratsuchenden. (Vgl. Schläfter 2010, S. 6162)
In den jeweiligen Beratungssettings gibt es jedoch auch Momente, die eine emotionale „Distanz“ entstehen lassen. Nach Heiner (2007) ist festzustellen, dass Berufsanfängerinnen eher zu Überengagement tendieren. Im Gegensatz dazu nehmen sich erfahrene Professionelle eher zurück (vgl. Heiner 2007, S. 471). Womöglich haben sie die Erfahrung gemacht, dass Misserfolge zum Alltag gehören. Diese sind auch durch hohen Einsatz nicht zu verhindern. Hierbei spielt besonders das Engagement der Adressat*innen eine bedeutende Rolle. Es ist jedoch auch möglich, dass die Ratsuchenden die Wertschätzung und Aufmerksamkeit des*r Professionellen im Sinne eines Freundschaftsangebots fehlinterpretieren (vgl. Seibert 1990, S. 82). Auch das der sozialpädagogischen Praxis inhärente „Kontrollmandat“ kann für Distanz in der Beziehung zwischen Professionellen und Adressat*innen sorgen. So müssen die Fachkräfte die Adressat*innen mit Auflagen und Regeln konfrontieren und gegebenenfalls deren Einhaltung kontrollieren. Gleichzeitig können auch die Adressat*innen selbst für eine emotional distanzierte Beziehung sorgen. So können sieje nach Situation nur so viel preisgeben, wie für denjeweiligen Beratungskontext notwendig ist. Nach Dittmer (2006) sind Adressat*innen um die Einhaltung des zeitlichen Rahmen sowie die Begrenzung der Themen auf denjeweils nötigen Rahmen bemüht. Jenes Bedürfnis nach Begrenzung muss nach Heiner (2007) von den Professionellen respektiert werden. So müssen sie aufgabenbezogene und personenbezogene Beziehungsangebote deutlich voneinander trennen. Adressat*innen müssen auch die Möglichkeit haben letztere abzulehnen. Eine angemessene Distanz verhindert auch den Verlust der Fähigkeit, die Adressat*innen fachlich einzuschätzen (vgl. Retter 2000, S. 359). Nach Geißler und Hege (2001) ist „Distanz eine der Grundregeln der Sozialpsychologie, die der Aufrechterhaltung von Autorität und Fachkompetenz dient.“ (Geißler & Hege 2001, S. 67) (Vgl. Schäf- ter2010, S. 62-63)
Es ist festzustellen, dass die Balance zwischen Nähe und Distanz in der sozialpädagogischen Beziehung zu den Adressat*innen eine besondere Herausforderung darstellt. In der Diskussion wird häufig eher zu große Nähe als zu große Distanz als Gefahr thematisiert. Eine zu große Nähe wird beispielsweise mit einer Überidentifikation der Professionellen mit den Problemlagen der Adressat*innen erklärt (vgl. Heiner 2007, S. 471). Der Beratungserfolg kann jedoch auch durch eine zu große emotionale Distanz behindert werden. So ist eine ratsuchende Person beispielsweise nicht bereit oder fähig sich zu öffnen. Andererseits können auch die Professionellen nicht mehr die Bereitschaft besitzen sich dem*r Ratsuchenden aufmerksam zuzuwenden. Dementsprechend ist eine normative oder absolute Festlegung, über das perfekte Maß an Nähe und Distanz für die Gestaltung der Beratungsbeziehung nicht möglich. Die Positionierung in dem Spannungsfeld von emotionaler Nähe und emotionaler Distanz muss von den Professionellen individuell und situativ flexibel gestaltet werden. Hierfür sind mehrere Faktoren, wie etwa fachliche und persönliche Fähigkeiten der Professionellen, die persönlichen Eigenschaften des*r Adressaten oder die individuelle Passung zwischen Beratender*m und Ratsuchendem*r et cetera verantwortlich. Die folgende Erörterung von „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ fokussiert sich auf eine spezifische Dynamik von „nahen“ Beziehungen, die Bestandteil aller sozialpädagogischen Beratungskontexte ist. (Vgl. Schläfter 2010, S. 62-63)
Es war zu erkennen, dass sich das Ausbalancieren von „Nähe“ und „Distanz“ häufig auch auf der Gefühlsebene abspielt. Was genau auf dieser Ebene im Beratungsprozess geschieht, wird nicht genauer beschrieben. Mit der theoretischen Erörterung des psychoanalytischen Konzeptes der „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ soll eine mögliche Ursache für aufkommende Gefühle bei den Professionellen genauer dargestellt werden.
3. „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ in der Struktur des „Arbeitsbündnis“ nach Oevermann
Nach der theoretisch orientierten Erörterung und Darstellung des „Nähe-Distanz Spannungsfeldes“ wird mit Oevermann auf strukturelle Bedingtheiten innerhalb des „Arbeitsbündnisses“ eingegangen. Diese sind einerseits wichtig, um die strukturelle Entstehung von „Übertra- gungs-“ und „Gegenübertragungsprozessen“ besser verstehen zu können. Andererseits wird die folgende Darstellung das Konzept, speziell den Prozess, von „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ im sozialpädagogischen Beratungsprozess verorten.
Zunächst müssen einige Grundgedanken Oevermanns, so kompakt wie für das Forschungsinteresse nötig, erörtert werden, um die Konzeption des „Arbeitsbündnissess“ nach Oevermann (2002) verständlich zu machen. Es geht Oevermann um die Struktur des Handlungsproblems von Professionellen, in seiner konkreten Auseinandersetzung zunächst am Beispiel von Lehrerinnen. Seiner Auffassung nach gründen sich Professionen vor allem darin, dass sie stellvertretend für Laien Krisen bewältigen. Ihre „Wertbezüge“ sind dabei einmal die Gewährleistung der „somato-psycho-sozialen Integrität“ derjeweiligen Lebenspraxis (ähnlich wie in Kapitel 2.1 und 2.3 beschrieben) sowie die Gewährleistung von Gerechtigkeit im Zusammenleben des „vergemeinschaftenden Verbandes, für den ein gemeinsames konkretes Rechtsbewusstsein gilt“ (Oevermann 2002, S. 23). Die beiden Fokusse werden für die Beratung erst unter der Bedingung der Krise thematisch. Aus der jeweils individuellen, von derjeweiligen Person und ihrer Umwelt abhängigen, Krisensituation ergibt sich die „nicht-Standardisierbarkeit“ professionellen sozialpädagogischen Handelns. Sie bezieht sich immer auf die „Konkretion eines Falles in seiner historischen Eigenart und Eigenlogik“ (Oevermann 2002, S. 30).
Nach Oevermann (2002) ist die Vermittlung von Wissen und Normen nicht rein technisch durch konditionierende Lernprogramme möglich. Jene Vermittlung findet auch in sozialpädagogischen Beratungen in den unterschiedlichen Handlungsfeldem statt. Sie erfordert soziale Beziehungen, in die die sozialpädagogische Praxis eingebettet ist. In dieser Beziehung unterscheidet Oevermann (2002) in Anlehnung an Talcott Parsons zwischen zwei möglichen Sozialbeziehungen. Der „diffusen“ Sozialbeziehung, die sich zwischen ganzen Menschen abspielt, und „spezifischen“ Sozialbeziehungen, die in Form von „rollenförmigen Sozialbeziehungen“ ausagiert werden, in denenjeweils eine Rollendefinition festgelegt ist. Für Oevermann (2002) ist die Familie das Paradebeispiel für eine „diffuse“ Sozialbeziehungen. Dementsprechend müssen die Menschen „rollenförmiges Handeln“ in Form von „spezifischen“ Sozialbeziehungen erst lernen. Inwiefern die Ratsuchenden in sozialpädagogischen Beratungen über jenes Wissen verfügen, muss immer im Prozess beobachtet werden. Besonders für Kinder und Jugendliche in sozialpädagogischen Beratungskontexten ist dieses erlernte Vorwissenjedoch anzuzweifeln. Häufig gestaltet sich ein ambivalentes, gleichzeitig in „diffusen“ und „spezifischen“ Sozialbeziehungen agierendes Verhältnis der Kinder und Jugendlichen zu den Professionellen. Genau dies erachtet Oevermann (2002) als eine günstige strukturelle Voraussetzung für die Integration in ein pädagogisches Arbeitsbündnis. Um das Ziel der „somato-psycho-so- zialen Integrität“ zu erreichen, soll der*die Adressaten als widersprüchliche Einheit von „diffusen“ und „spezifischen“ Sozialbeziehungen agieren. Dem Professionellen schreibt Oevermann eine „spezifische“ Sozialbeziehung zu. Jene Strukturmerkmale verknüpft Oevermann nun mit dem psychoanalytischen Konzept der „Übertragung“ und „Gegenübertragung“. So schreibt Oevermann dem*r Ratsuchenden innerhalb der Struktur des Arbeitsbündnisses die „Grundregel“ zu. Diese besagt, dass der*die Ratsuchende sich in Form einer „diffusen“ Sozialbeziehung einbringen soll. Es soll von ihm*ihr alles eingebracht werden, was ihm*ihr durch den Kopf geht. Dies soll auch das ganz unwichtig Erscheinende oder peinliches beinhalten. In diesem Sinne stellt sich die Übertragung des*r Beratenen auf den*die Professionellen ein. Den Professionellen kommt die Aufgabe zu, diese Übertragungen anzunehmen und die damit aufkommenden Gegenübertragungsgefühle innerlich zuzulassen. Allerdings dürfen diese aufgrund der „spezifischen“ Sozialbeziehung nicht ausagiert werden. So wird den Professionellen die „Abstinenzregel“ in der Strukturlogik des Arbeitsbündnisses als „spezifische Rollenbeziehung“ zugeschrieben. Dies kann wie folgt in Form einer Abbildung veranschaulicht werden. (Vgl. Oevermann 2002, S. 31-43)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Struktur des Arbeitsbündnisses (Vgl. Oevermann 2002, S. 43)
4. „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ in Beratungskontexten der Sozialen Arbeit
4.1. „Übertragung“
Die „Übertragung“ ist ein wichtiger Bestandteil der psychoanalytischen Therapie. In dieser, auf Sigmund Freud zurückgehenden psychologischen Therapieform, gilt die „Übertragung“ mitsamt ihrer Handhabung als unverzichtbarer Bestandteil. Nach Mertens (1998) ist eine „Verkomplizierung“ des Verständnisses von „Übertragung“ festzustellen. So dient aktuell der Begriff „Übertragungsbeziehung“ (Sandler 1983) als „Notbehelf‘. Dieser soll dem konzeptionellen Übergang von einer „individualisierenden persönlichkeitspsychologischen“ zu einer „sozialpsychologischen“ und „interaktionellen Betrachtungsweise“ gerecht werden. Trotzdem ist anzumerken, dass auch dieser von verschiedenen Autorinnen unterschiedlich genutzt wird. (Vgl. Mertens 1998, S. 169)
Ein Charakteristikum der Psychoanalyse ist die Auseinandersetzung mit „unbewussten“ Anteilen des Individuums. So geht es ihr auch sowohl um die bewusste wie auch die unbewusste „Therapeut-Patient-Beziehung“. Für diese Ausarbeitung ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass in Analogie zu Oevermann (2002) therapeutische Momente auch Teil des Arbeitsbündnisses zwischen Professionellen Sozialarbeiterinnen und Adressatinnen, unter anderem auch in Beratungskontexten, sind. Da es sich bei der Psychoanalyse jedoch um eine psychologische Theorie handelt, wird in der entsprechenden Literatur die „Therapeut-Patient-Beziehung“ als Terminus genutzt. Nach Freud (1912) kann zwischen „positiver“ und „negativer“ Übertragung unterschieden werden. Jene Übertragungen können als Endpunkte eines Kontinuums bezeichnet werden. Ähnlich wie nahezu jede Beziehung, enthält jede Übertragung liebevolle und feindselige Gefühle. So können sie diejeweils gegenseitigen Gefühle kaschieren. Es kann mit feindseligen Gefühlen die liebevolle Seite der Übertragung kaschiert werden und umgekehrt. (Vgl. Mertens 1998, S. 271)
Das Übertragungskonzept erklärte Freud zunächst „triebtheoretisch“. Es wird die „Vorstellungsrepräsentanz“ einer wichtigen Person in der Kindheit mit „Libido“ besetzt. Im Prozess der Übertragung findet eine Verschiebung der Triebenergie auf den*die Analytiker*in statt. So beginnt der*die Patient*in den*die Analytiker*in zu begehren. Die behandelte Person ist sich nicht bewusst darüber, dassjene Begierde eigentlich einem Elternteil gilt. Außerdem gilt nicht die reale Person des*r Analytiker*in als Ziel der Liebe, sondern das Bild, das die behandelte Person sich in Bezug auf die früheren Bezugspersonen macht. Es werden auch nur Wünsche in der „Übertragung“ wiederbelebt, die aus den unterschiedlichsten Gründen in der Kindheit nicht befriedigt wurden. Sie konstituieren nun dem „Auftrieb des Es“ folgend eine Wiederkehr des Verdrängten. (Vgl. Mertens 1998, S. 271)
Bis Anna Freud (1936) galt die „Übertragung“ als eine Manifestation des „Es“. Sie war somit eine Äußerung verdrängter sexueller und aggressiver Triebimpulse. Anna Freud (1936) erweiterte die Übertragung „libidinöser Triebimpulse“ um die „Übertragung“ der Abwehr. In diesem Sinne stellt die „Übertragungsform“ eine Wiederholung alter Formen der Abwehr der zu behandelnden Person dar. Sie sind damit auch ein Widerstand in der Behandlung. In psychoanalytischen Therapieformen rückt dadurch das „Ich“ mit seinen speziellen Modi der Triebabwehr in den Fokus der Behandlung. Seit der Einführung des „Über-Ich-Konzeptes“ (1923) gehen Analytiker*innen davon aus, dass auch „Über-Ich-Aspekte“ von Patientinnen übertragenwerden. (Vgl. Mertens 1998, S. 272)
Anhand von „objektbeziehungspsychologischen Theorieansätzen“ konnte differenzierter ausgearbeitet werden, was übertragen wird. Mit Sandler und Sandler (1978) kann davon ausgegangen werden, dass in eine Beziehung immer auch Vorstellungen über die Erwartungen des Gegenübers, sein tatsächliches Verhalten oder der Situationskontext miteingehen. In diesem Sinne müssen Beziehungen komplexer konzipiert werden. Es tragen sich in einer Beziehung die teilnehmenden Personen auf subtile Weise gegenseitige Erwartungen an. Im Interaktionsprozess distanzieren sie sich von diesen und einigen sich auf bestimmte Erwartungen. Jener Aushandlungsprozess wird nicht nur von bewussten und unbewussten Bedürfnissen geprägt. Er wird auch von „Affekten“ beeinflusst, die den Prozess der Interaktion begleiten. So können beispielsweise „generationsübergreifende Übertragungen“ unbewusst transferiert werden. Es werden also nicht nur „Trieb-“ und „Über-Ich-Impulse“ oder „Selbst-“ oder „Objektrepräsentanzen“ übertragen, sondern auch eine unterschiedlich komplexe „Beziehungsrepräsentanz“, die als prototypische abstrahierte Erinnerungsfigur im Unbewussten erhalten geblieben ist. (Vgl. Mertens 1998, S. 272)
4.2 „Gegenübertragung“
Nach Mertens (1998) ist festzustellen, dass das Konzept der „Gegenübertragung“ seit seiner Entdeckung 1910 durch Sigmund Freud bis in die 1980er Jahre immer wieder unterschiedlich gedeutet wurde. Freud (1910) selbst schildert die Entdeckung der „Gegenübertragung“ wie folgt: „Wir sind auf die „Gegenübertragung“ aufmerksam geworden, die sich beim Arzt durch den Einfluß des Patienten auf das unbewußte Fühlen des Arztes einstellt, und sind nicht weit davon, die Forderung zu erheben, daß der Arzt diese Gegenübertragung in sich erkennen und bewältigen müsse.“ (Freud 1910, S. 108) Hiermit wird auch zugleich eine Aufgabe an die Therapeutinnen beschrieben, die Oevermann (2002) als „Abstinenzregel“ festlegt. (Vgl. Mertens 1998, S. 65-66)
Margaret Little (1951) geht von einer „ganzheitlichen“ Definition der „Gegenübertragung“ aus. Neben der „ganzheitlichen“ gab es in der Vergangenheit noch „klassische“ oder „totalis- tisch“ bezeichnete Auffassung von „Gegenübertragung“. Little (1951) identifizierte vier Dimensionen der Gegenübertragung, die sich voneinander unterscheiden lassen. Erstens die Gegenübertragung als eine unbewusste Handlung dem*r Patientin gegenüber. Zweitens „neurotische Übertragungselemente“, die in der Interaktion dazu führen können, dass der*die Analytikerin die zu behandelnde Person wie eine enge Bezugsperson bezieht. Drittens „nicht-neurotische“ Reaktionen des*r Analytikerin auf die Übertragung deri Patientin. Dies wird häufig auch als „normale Gegenübertragung“ bezeichnet. Und viertens die Gesamtheit der Haltungen desi Analytikerin gegenüber demi Patientin. (Vgl. Mertens 1998, S. 65)
In den vergangen Jahrzehnten rückte die Subjektivität desi Analytikerin den Fokus. Damit bekam auch die „unbewusste“ Beziehung mehr Aufmerksamkeit. Diese wird als eine unverzichtbare „innere Orientierungsleistung“ angesehen, um vor allem unbewusste „Selbstentwürfe“, „Szenen“, „Phantasien“ und „Konflikte“ desiPatienten zu verstehen. Zu dieser Subjektivität können Analytikerinnen sich heutzutage aufgrund von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen bekennen, ohne als Mystikerinnen eingeschätzt zu werden. Im psychoanalytischen Verständnis sind die Leiden desi Patientin nicht als isolierte Symptome zu begreifen. Sie sind in diesem Sinne Ausdruck einer Persönlichkeit. Diese hat sich in einer „intersubjektiven Matrix“ in der Sozialisation und dem Prozess des Heranwachsens entwickelt. Über die Wahrnehmung seiner eigenen konkordanten „Gegenübertragung“ kann der*die Analytiker*in in diese „intersubjektive Matrix“ eintauchen. Womöglich können darin Situationen entstehen, die in vielem den traumatisierenden und konflikthaften Situationen des*r Patientin ähneln. Es findet eine teilweise Identifikation mit Persönlichkeitsanteilen des Gegenübers statt (vgl. Rauh 2009). Gleichzeitig hat der*die Analytiker*in die Möglichkeit dem*r Patientin einen Raum für „Neuerfahrungen“ zu schaffen, indem er anders als frühere Bezugspersonen reagiert. Mit einem gekonnten Umgang von komplementären „Gegenübertragungen“ kann der*die Analytiker*in die Reinszenierung von alten Traumatisierungen und konflikthaften Erfahrungen verhindern. Allerdings können diese auch durch „Gegenübertragungen“ verfestigt werden. Im Optimalfall können traumatische und konflikthafte Erfahrungen interaktiv so bearbeitet werden, dass neue Erfahrungen nach der gemeinsamen „Durcharbeitung“ jener negativen Erfahrungen stattfinden können. Mertens (1998) bezeichnet die Fähigkeit mit Gegenübertragung arbeiten zu können als eine differenzierte, explizier- und reflektierbare Vorgehensweise, in der auch eine wirkliche Meisterschaft, freilich nicht im Schnellverfahren oder in Wochenendkursen, erreicht werden kann.“ (Mertens 1998, S. 68). (Vgl. Mertens 1998. S. 66-68)
Als Ergänzung zu den hier erörterten theoretischen Konzepten von „Gegenübertragung“ werden im Folgenden konkret formulierte „Gegenübertragungsphantasien“ wiedergegeben. Es handelt sich bei all diesen um „Gegenübertragungen“ von Professionellen in sozialpädagogischen Beratungskontexten. Diese werden aus einem Aufsatz zitiert, in dem Ulrike Treier (1987) den stationären Aufenthalt einer stark selbstgefährdenden Jugendlichen schildert. Aufgrund des Forschungsinteresses steht nicht das Verhalten der Patientin im Vordergrund, sondern die geschilderten „Gegenübertragungen“. Die Patientin soll nach einem längeren stationären Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik eine „letzte Chance“ in der von Ulrike Treier betreuten Wohngruppe erhalten. Die Wohngruppe ist Teil des Therapeutischen Heims des Vereins für Psychoanalytische Sozialarbeit e. V. in Rottenburg. Treier (1987) schildert vor Beginn der Behandlung folgende Gegenübertragungen:
- „auf jeden Fall wollten wir anders sein, als die Eltern der Patientin, die sich uns in erschütternder Weise als äußerst eindringend und verschlingend ihrer Tochter gegenüber dargestellt hatten;
- Phantasien, bei uns werde die Patientin alle die sie knebelnden und fesselnden Utensilien nicht brauchen, sie werde vielmehr unsere positiven, zurückhaltenden Beziehungsangebote annehmen, standen im Vordergrund.
- Auf jeden Fall wollte wir anders sein, als ihre bisherigen Therapeuten und Betreuer: Wir wollten sie weder fesseln noch knebeln, noch ihr die Sonde stecken.“ (Treier et al. 1987, S. 82)
Im weiteren Verlauf der Hilfe änderten sich die „Gegenübertragung“ mit dem gezeigten Verhalten der Patientin. Während des Betreuungszeitraums stieg unter anderem die Verzweiflung der Patientin. In dieser Phase schildert Treier (1987) „Gegenübertragungen“, die stark von dem Gefühl der Verzweiflung, Wut und Hass geprägt waren. Nachdem die Selbstzerstörung der Patientin trotz zwischenzeitlicher kleineren Entwicklungsschritten immer heftiger wurde, beschreibt Treiter (1987) Gefühle der „Entmutigung“ und „Dehumanisierung“. In ihren Gegenübertragungen fühlte sich das Team „wie die Verhaltenstherapeut*innen, die messend und beobachtend, gefühlsentleert das Leid der Patientin seziert hatten.“ (Treier et al. 1987, S. 83) Durch eine reflektierte Auseinandersetzung mit den geschilderten „Gegenübertragungen“ änderte das Team der Betreuenden mit Unterstützung einer Supervisorin das Betreuungskonzept der Patientin und konnte eine angemessene Lösung finden. (Vgl. Treier et al. 1987, S. 80-83)
4.3 „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ in der Sozialen Arbeit
Bosshard (1999) beschreibt Übertragungs- und Gegenübertragungsvorgänge als allgemein menschliche Phänomene. Diese entwickeln sich injeder Beziehung. Häufig geschieht dies unbemerkt und unreflektiert. Sie können die Wahrnehmung des jeweils anderen Menschen, die emotionale Einstellung und das Verhalten ihm gegenüber beeinflussen. Dementsprechend müssen Professionelle über Wissen und Bewusstheit bezüglich der Mechanismen von Übertragung und Gegenübertragung verfügen. Nur so können sie Beziehungen realistisch einschätzen, regulieren und gestalten (vgl. Bernier & Johnson 1997, S. 153). Speziell in asymmetrischen, helfenden Beziehungen kommt der Übertragung eine besondere Bedeutung zu. So lässt die Struktur, wie bereits bei Oevermann gezeigt, Übertragungen von Seiten der Adressat*in- nen verstärkt entstehen. Es ist Aufgabe der Professionellen diese reflektiert im Beratungsprozess zu bearbeiten (vgl. Biestek 1968, S. 98). (Vgl. Schäfter 2010, S. 64)
Jene Übertragungen und Projektionen entstehen durch eine unbewusste Prägung des Erlebens und der Deutung von aktuellen Beziehungserfahrungen durch Erfahrungen der Vergangenheit. Es können unbewältigte Konflikte, unerfüllte Wünsche oder auch Ängste so bis in die Gegenwart wirken. Dies hat zur Folge, dass eine aktuelle Beziehungen nach erlebten Mustern gelebt wird. In den Übertragungssituationen ist eine dritte Person aus der Vergangenheit beteiligt. In der Begegnung mit einer zweiten Person wird die Person an einen Menschen aus ihrer Biografie erinnert. Es werden unbewusst deren Persönlichkeitseigenschaften in den*die aktuelle In- teraktionspartner*in projiziert (vgl. Miller 2002, SS. 471). Eine angemessene Distanz der Professionellen zeigt sich darin, dass sie von ihren eigenen Gefühlen, die durch die Übertragung ausgelöst werden, berührt wird sichjedoch nicht mitreißen lässt. Die ausgelösten Gefühle sind einerseits Erkenntnisinstrument für die Professionellen. Andererseits ist es methodische Hilfe, da sie die Adressatinnen mit dem Zurückgeben eben dieser Gefühle auf diese aufmerksam macht. So ist das Erlangen von Ausgewogenheit zwischen Nähe und Distanz in Beratungsbeziehungen nach Bosshard (1999) über eine Sensibilisierung gegenüber Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen möglich (ebd. S. 290.). (Vgl. Schäfter 2010, S. 64)
5. Fazit
Es ist zunächst die hohe Bedeutung von Beratung für die sozialpädagogische Praxis festzustellen. Die Professionellen müssen sich darüber bewusst sein, dass sie in der Interaktion mit den Adressat*innen immer wieder eine Berater*innenrolle einnehmen. Aufgrund ihrer Professionalität müssen sie dabei wissenschaftlich fundiert agieren und ihre Beratung anhand von Beratungstheorie und Beratungswissen strukturieren. Es ist in der Praxisjedoch häufig festzustellen, dass Beratung, wenn nicht explizit im Namen verortet, nicht als Bestandteil von sozialpädagogischer Praxis gedacht wird. Dabei wird meistens mit Fachwissen beraten. Dass in solchen Beratungskontextenjedoch anhand von Beratungswissen gehandelt wird, ist selten zu beobachten.
In der Ausarbeitung wurde dem Autor bewusst, in wie vielen ergänzenden Professionen sich Sozialpädagoginnen wissen aneignen müssen. Mit Thiersch (2004) müssen immer auch sozioökonomische Bedingungen als ein Aspekt der Beratung mitgedacht werden. Hierfür ist eine Auseinandersetzung mit soziologischen Theorien notwendig. Parallel dazu muss jedoch auch die konkrete Interaktion mit den Adressatinnen reflektiert und analysiert werden. Da auchjene auf wissenschaftlichen Theorien bezogen sein sollte, ist ein Wissen über psychologische Theorien ebenfalls nötig. So kann mit Mertens (1998) eine Erklärung für entstehende Gefühle der Professionellen die „Gegenübertragung“ sein. Dieser Gefühlsausdruck kann jedoch anhand von Alltagstheorien auch fälschlicherweise anders gedeutet werden. Daraus resultierende Konflikte sind unter anderem für den Beratungsprozess hinderlich. Höchstwahrscheinlich müssen auch die Adressat*innen die entstehenden Konsequenzen aushalten. Obwohl es sich eigentlich um ein unprofessionelles Handeln der Professionellen handelt.
Die Bedeutung von „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ für die sozialpädagogische Praxis konnte nach Einschätzung des Autors sehr gut herausgearbeitet werden. Da zunächst festgestellt wurde, dass Beratung eine „Querschnittsmethode“ nahezu aller sozialpädagogischen Handlungsfelder ist, war eine Grundbedingung für die Analyse gegeben (vgl. Sickendiek & Nestmann 2018, S. 220). Mit Bosshard (1999) kann davon ausgegangen werden, dass sich „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ in nahezu allen menschlichen Beziehungen ergeben. Somit ist das Konzept auch über Beratungskontexte sozialpädagogischer Arbeit hinaus für alle sozialpädagogischen Interaktionen von Bedeutung. Dass mit diesem Konzept die oft schwer erklärbaren Gefühle der Professionellen nachvollziehbarer werden, kann sehr unterstützend für diese sein. Denn auch die Professionellen sind nur Menschen (vgl. Nagera 1987, S. 519). Allerdings müssen sie als Professionelle auch ihre eigenen Gefühle anhand von wissenschaftlichen Theorien einordnen. Der Autor ist der Überzeugung, dass bereits das Verständnis über den Ursprung empfundener Gefühle die Professionellen in ihrer Interaktion mit den Adressat*innen entlasten kann. Darüber hinaus kann es als Wissensquelle für die Professionellen über die Innenwelt der Adressat*innen, die ansonsten sehr schwer zugänglich ist, dienen. Am Wichtigsten erachtet der Autorjedoch, dass die Professionellen mit einem bewussten Umgang von „Gegenübertragungen“ Retraumatisierungen verhindern können und den Adres- sat*innen die Möglichkeit geben können, solche Erfahrungen neu zu verknüpfen. Mit diesem Wissen müssen sich Professionelle immer selbst hinterfragen, wenn ein Kind oder ein*e Jugendliche^ in eine Krisensituation während der Interaktion mit den Professionellen gerät. Somit muss sich, wie bereits Mertens (1998) festgestellt hat, ein geübter Umgang mit „Gegenübertragungsmechanismen“ über jahrelange Erfahrung einstellen.
Es muss bedacht werden, dass die Psychoanalyse ein klassisches Paradigma in der Disziplin der Psychologie, ähnlich wie die Lerntheorien, ist. Daher muss davon ausgegangen werden, dass auch andere Erklärungen, wie beispielsweise bindungstheoretische Erklärungsansätze für die erlebten Gefühle möglich sind. Das Konzept von „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ baut in sich wiederum auf weiteren Konzepten des psychoanalytischen Paradigmas auf. Es ist deshalb wichtig sich über das Konzept hinaus Wissen aus der Psychoanalyse anzueignen. Dabei ist zu beachten, dass die Psychoanalyse von unterschiedlichen Analytiker*innen verschieden weiterentwickelt worden ist. So gibt es unterschiedliche Deutungen der Konzepte innerhalb der Psychoanalyse, die jeweils wiederum für weitere Konzepte als Teile der Definition von Bedeutung sind (vgl. Mertens 1998).
Auch das Konzept der „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ an sich muss zumindest bewusst kritisch genutzt werden. Denn die sehr unspezifischen Formulierung in der Erörterung des Konzeptes ermöglichen eine breite Anwendung dessen. So bestand beispielsweise die ,,to- talistische“ Auffassung der Gegenübertragung darauf, dass das Konzept alle Gefühle umfas- sen solle, die der*die Analytiker*in gegenüber seinem*r Patient*in verspürt (vgl. Mertens 1998, S. 64). Es wurde zwar im Anschluss daran versucht, dies ein wenig zu konkretisieren. Allerdings ist es immer noch ein Konzept, das viel Interpretationsraum ermöglicht. Es wurde versucht, dies anhand der Darstellungen von Ulrike Treier (1987) zu veranschaulichen. Somit ergibt sich für die Professionellen die Frage, was sie als „Gegenübertragungen“ definieren.
Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass es grundsätzlich für professionelle Beratung unterstützend ist, wenn sich die beratende Person über das Vorhandensein von „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ bewusst ist. Speziell für ihre Rolle als Professionelle mit der Aufgabe, eben nicht die „Gegenübertragung“ auszuagieren (vgl. Oevermann 2002), sondern sich über den Mechanismus bewusst zu sein und bestenfalls neue Erfahrungen für die Adressatinnen zu ermöglichen. Außerdem ist das Wissen über die Übertragungs- und Gegenübertragungsmechanismen hilfreich, wenn die Professionellen sich in dem Spannungsfeld der „Nähe“ und „Distanz“ positionieren müssen. Allerdings ist die Analyse von „Gegenübertragung“ als mögliche Wissensquelle über das Innenleben der Adressatinnen mit bedacht zu nutzen. Jenes mögliche Wissen muss im hermeneutischen Sinne immer wieder überprüft werden. Es mussjedoch immer beachtet werden, dass ein gewisses Grundwissen über die Psychoanalyse Voraussetzung ist, um das Konzept anzuwenden.
6. Literaturverzeichnis
Barth, K. (1990): Möglichkeiten und Grenzen sozialpädagogischer Beratung im Allgemeinen Sozialen Dienst. In: Brunner, E.. J. & Schönig, W. (Hrsg.): Theorie und Praxis von Beratung. Pädagogische und psychologische Konzepte. Freiburg im Breisgau. S. 100-128.
Biestek, F. (1968): Wesen und Grundsätze der helfenden Beziehung in der sozialen Einzelhilfe. 2. Auflage. Freiburg im Breisgau.
Becker-Lenz, R. & Müller, S. (2008): Der professionelle Habitus in der Sozialen Arbeit. Grundlagen eines Professionsideals. Bern.
Bernier, G. &Johnsson, L. (1997): Psychosoziale Arbeit. Eine praktische Theorie. Weinheim und Basel.
Bosshard, M. (1999): Sozialarbeit und Sozialpädagogik in der Psychiatrie. Lehrbuch. Bonn.
DBSH Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. (2002): Qualitätsbeschreibung Sozialprofessionelle Beratung. Autoren: Schulz-Wallenein/ Maus. Beschluss der Bundesmitgliederversammlung des DBSH am 15./16.11.02 in Halle. www.dbsh.de/Qualit_t_Beratung.pdf vom 27.01.07
Dittmer, I. (2006): Erfahrene Beratung. Beratungserfahrungen und Beratungsprozesse in subjektiven Sichtweisen der Ratsuchenden. Tübingen.
Freud, A. (1936): Das Ich und die Abwehrmechanismen. München.
Freud, S. (1910): Über Psychoanalyse. Fünf Vorlesungen, GW VIII, S. 160.
Freud, S. (1912): Zur Dynamik der Übertragung. GWVIII, S. 364-374.
Freud, S. (1923): Das Ich und das Es. GW XIII, S. 237-289.
Geißler, K. A. & Hege, M. (1988/2001): Konzepte sozialpädagogischen Handelns. Ein Leitfaden für soziale Berufe. 10., aktualisierte Auflage. Weinheim und Basel.
Heiner, M. (2007): Soziale Arbeit als Beruf. Fälle - Felder - Fähigkeiten. München.
Junker, H. (1977): Theorien der Beratung. In: Hornstein, W. & Bastine, R. & Junker, H. & Wulf, C. (Hrsg.): Funk-Kolleg Beratung in der Erziehung Band 1. Frankfurt am Main. S. 285-310.
Nagera, Humberto (1987): Psychoanalytische Grundbegriffe. Eine Einführung. Frankfurt am Main
Nestmann, F. & Sickendiek, U. (2005): Beratung. In: Otto, H.-U. & Thiersch, H. (Hrsg.): Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik. 3. Auflage. München. S. 140-152.
Mertens, W. (1998): Psychoanalytische Grundbegriffe. Weinheim.
Miller, D.. (2002): Herman Nohls „Theorie“ des pädagogischen Bezugs. Eine Werkanalyse. Bern
Oevermannn, U. (2002): Professionalisierungsbedürftigkeit und Professionalisiertheit pädagogischen Handelns. In: Kraul, M. (Hrsg.): Biographie und Profession. Klinkhart, Bad Heilbr- runn. S. 19-63
Rauh, B. (2009): Szenisches Verstehen. In: Ahrbeck, B. & Willmann, M. (Hrsg.): Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch. Stuttgart, S. 173-181
Retter, H. (2000): Studienbuch Pädagogische Kommunikation. Bad Heilbrunn.
Sandler, J. & Sandler, A. - M. (1983): The second censorship, the three box model andd some technical implications. International Journal ofPsych-Analysis, Jahrgang 64, S. 413-425.
Seibert, U. (1990): Beratung in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik. Methodenintegration. In: Brunner, E. J. & Schönig, W. (Hrsg.): Theorie und Praxis von Beratung. Pädagogische und psychologische Konzepte. Freiburg im Breisgau. S. 77-86.
Thiersch, H. (1997): Soziale Beratung. In: Nestmann, F. (Hrsg.): Bausteine für eine interdisziplinäre Wissenschaft undPraxis. Tübingen. S. 99-110.
Thiersch, H. (2004): Sozialarbeit/Sozialpädagogik und Beratung. In: Engel, F. & Nestmann, F. & Sickendiek, U. (Hrsg.): Handbuch Beratung. Band 1: Disziplinen und Zugänge.Tübingen. S.115-124.
Thiersch, H. & Frommann, A. & Schramm, D. (1977): Sozialpädagogische Beratung. In: Thiersch, H. (Hrsg.): Kritik und Handeln. Interaktionistische Aspekte der Sozialpädagogik. Neuwied undDarmstadt. S. 95-130.
Treier, U., et al. (1987): Probleme von Gegenübertragungen und Rahmen in stationären Langzeitbehandlungen psychotischer Kinder und Jugendlicher. In: Psychosozial, 10. Jahrgang. München, Weinheim.
Sandler, J. (1983): Die Beziehung zwischen psychoanalytischen Konzepten und psychoanalytischer Praxis. In: Psyche Einzelartikel. 37. Jahrgang Heft 7. Gießen: Psychosozial Verlag, S. 577-595.
Schäfter, C. (2010): DieBeratungsbeziehung in der Sozialen Arbeit. Wiesbaden.
Scherr, A. (2004): Beratung als Form wohlfahrtsstaatlicher Hilfe. In: Schützeichel, R. & Brüsemeister, T. (Hrsg.): Die beratene Gesellschaft. Zur gesellschaftlichen Bedeutung von Beratung. Wiesbaden. S. 95-110.
Sickendiek, U. & Nestmann, F. (2018): Beratung in kritischen Lebenssituationen. In: Graßhof, G. & Renker, A. & Schröder, W. (Hrsg.), Soziale Arbeit. Eine elementare Einführung. Wiesbaden. S. 217-235.
Sickendiek, U. & Engel, F. & Nestmann, F. (1999): Beratung. Eine Einführung in sozialpädagogische und psychosoziale Beratungsansätze. Weinheim und München.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument untersucht die Bedeutung von "Übertragung" und "Gegenübertragung" in Beratungskontexten der Sozialen Arbeit. Es analysiert, inwiefern die Gefühle der Professionellen mit diesen Konzepten erklärt werden können und wie man mit diesen Gefühlen umgeht.
Was sind die Hauptpunkte des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Punkte: Einleitung; Beratung in der Sozialen Arbeit (Definition, Besonderheiten im sozialpädagogischen Kontext, Spannungsfeld von "Nähe" und "Distanz"); "Übertragung" und "Gegenübertragung" im "Arbeitsbündnis" nach Oevermann; "Übertragung" und "Gegenübertragung" in Beratungskontexten der Sozialen Arbeit; Fazit; Literaturverzeichnis.
Wie wird "Beratung" in diesem Dokument definiert?
Professionelle Beratung wird definiert als Kommunikation über Fragen, Anliegen und Schwierigkeiten einer Person, Gruppe oder Organisation mit jemandem (Berater*in, Beratungsteam, Online-Beratungs-Tools etc.), der behilflich ist, die Ausgangssituation zu reflektieren, Perspektiven zu erweitern, angemessene Informationen und Lösungsmöglichkeiten zu finden, Entscheidungen vorzubereiten, Belastungen und Krisen besser bewältigen zu können und weitere Handlungsoptionen zu entwickeln. Kurz gesagt: Beratung ist Orientierungs-, Entscheidungs-, Planungs-, und Handlungshilfe.
Welche Herausforderungen werden in Bezug auf "Nähe" und "Distanz" in der Sozialen Arbeit diskutiert?
Das Dokument betont, dass die Positionierung in dem Spannungsfeld von emotionaler Nähe und emotionaler Distanz von den Professionellen individuell und situativ flexibel gestaltet werden muss. Es wird diskutiert, dass sowohl zu große Nähe als auch zu große Distanz den Beratungserfolg behindern können.
Was ist das "Arbeitsbündnis" nach Oevermann?
Das "Arbeitsbündnis" nach Oevermann beschreibt die strukturellen Bedingungen professionellen Handelns. Es erklärt, warum die Verknüpfung des psychoanalytischen Konzepts von "Übertragung" und "Gegenübertragung" von hoher Bedeutung für die (sozial-)pädagogische Praxis ist. Im Arbeitsbündnis wird den Ratsuchenden die Grundregel der "diffusen" Sozialbeziehung zugeschrieben, während den Professionellen die Abstinenzregel in Form einer "spezifischen Rollenbeziehung" zukommt.
Was versteht man unter "Übertragung" und "Gegenübertragung"?
"Übertragung" bezieht sich auf die unbewussten Gefühle, Wünsche und Erwartungen, die Klienten auf ihre Berater*innen projizieren, basierend auf früheren Beziehungen. "Gegenübertragung" beschreibt die unbewussten Gefühle und Reaktionen der Berater*innen auf die Übertragung der Klienten. Das Dokument geht genauer auf die unterschiedlichen Interpretationen und Dimensionen beider Konzepte ein.
Welche Bedeutung haben "Übertragung" und "Gegenübertragung" in der Sozialen Arbeit?
Professionelle müssen sich der Mechanismen von "Übertragung" und "Gegenübertragung" bewusst sein, um Beziehungen realistisch einschätzen, regulieren und gestalten zu können. Reflektierte Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen hilft, Retraumatisierungen zu verhindern und neue Erfahrungen für die Klienten zu ermöglichen.
Welche Einschränkungen bei der Anwendung des Konzepts der „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ werden erwähnt?
Das Konzept sollte bewusst und kritisch genutzt werden, da die sehr unspezifischen Formulierungen in der Erörterung des Konzeptes eine breite Anwendung dessen ermöglichen. Darüber hinaus baut das Konzept in sich wiederum auf weiteren Konzepten des psychoanalytischen Paradigmas auf. Es ist deshalb wichtig, sich über das Konzept hinaus Wissen aus der Psychoanalyse anzueignen.
- Quote paper
- Florian Adner (Author), 2022, Die Bedeutung von „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ in sozialpädagogischen Beratungskontexten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1316632