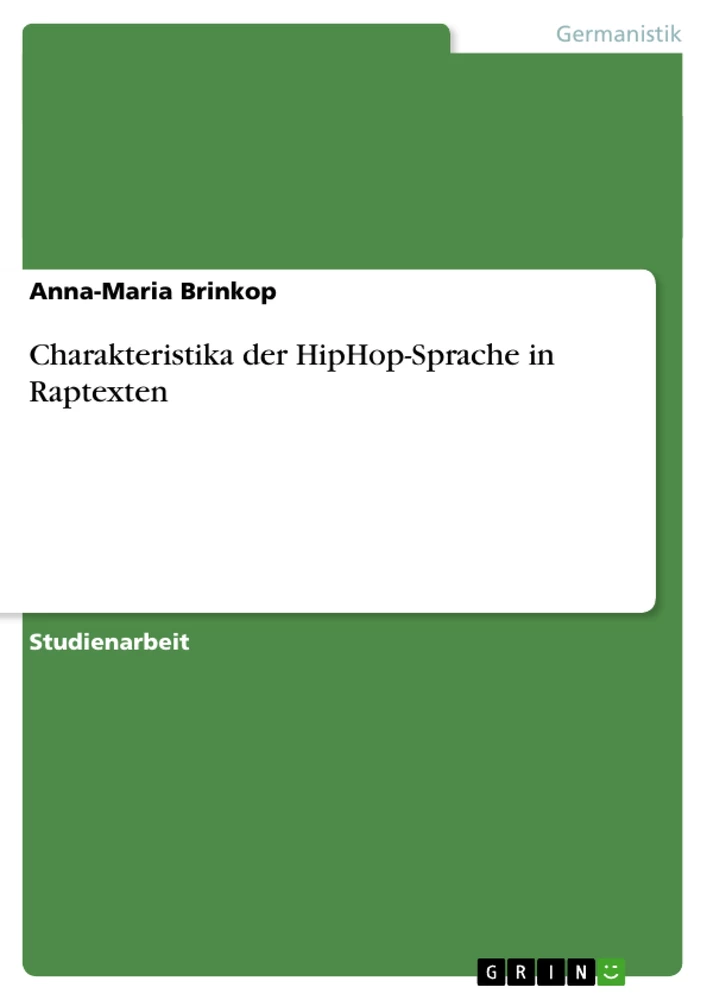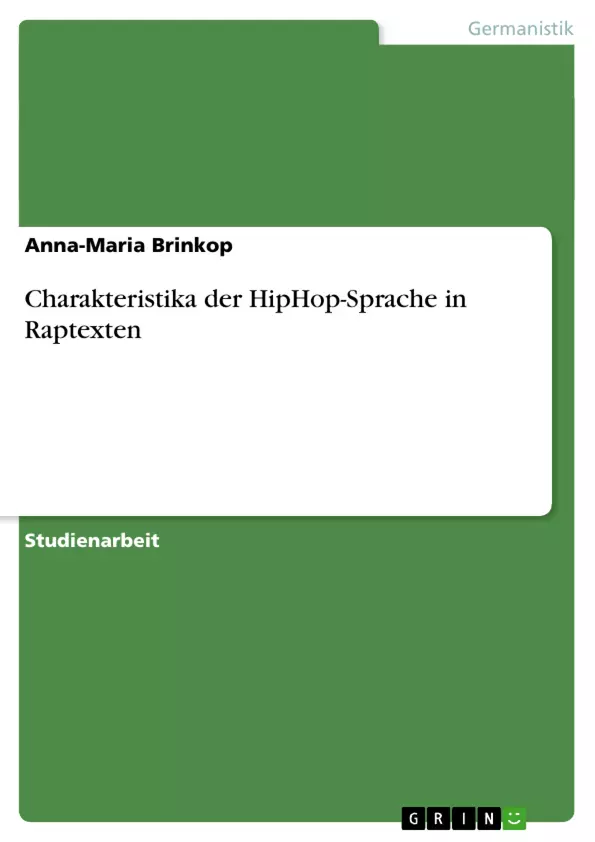„Voll fett, Mama!“, kommentiert ein Junge in lässig-sportlichem HipHop-Outfit das
zubereitete Mittagessen seiner Mutter. „Mama sagt, das ist gar nicht fett!“, wettert die kleine
Schwester.
Das Konzept, auf dem dieser Werbespot beruht, ist das Spiel mit der Sprache, genau
genommen mit der Jugendsprache, die das Thema dieser Arbeit darstellt. Doch bereits der
Werbespot zeigt, dass nicht von einer homogenen Jugendkultur gesprochen werden kann,
sondern diese von verschiedenen Untergruppierungen geprägt ist. Der Junge aus dem
Werbespot fühlt sich einer bestimmten Subkultur zugehörig. Sein Auftritt (der mit
rhythmischen HipHop-Beats unterlegt ist), seine Kleidung (die aus scheinbar zu großen
Sporthemden und Hosen, einer umgedrehten Baseballkappe und vielen Goldketten besteht)
und das Vokabular (in diesem Fall das Adjektiv „fett“) deuten auf seine Zugehörigkeit zur
HipHop-Subkultur hin. Diese Darstellung spiegelt die in der aktuellen Jugendsprachforschung
aufgestellte These wider, dass es nicht die Jugend als homogene Gruppe und damit auch keine
einheitliche Jugendsprache gibt.1 Vielmehr existieren so viele Jugendsprachen wie es
Subkulturen gibt. Ausgehend von dieser These scheint es sinnvoll, jugendsprachliche
Phänomene über die soziale Kategorie der Gruppe zu untersuchen.
Die Arbeit gliedert sich folgendermaßen: Zunächst wird in zwei Kapiteln ein kurzer Abriss
über die Geschichte der HipHop-Kultur in Amerika und Deutschland sowie eine Darstellung
der „Gesetze“ des HipHop gegeben.
In einem weiteren Abschnitt wird ein Überblick über die Jugendsprachforschung im
Allgemeinen gegeben sowie das methodisches Vorgehen beschrieben. Dabei wird die
Auswahl des Textkorpus` begründet und das analytische Vorgehen beschrieben. Den dritten
Abschnitt und damit auch den Schwerpunkt der Arbeit bildet die linguistische Analyse, die
vornehmlich der traditionellen Jugendsprachforschung verpflichtet ist. Dabei wurden die
augenfälligsten Phänomene hinsichtlich ihrer sprachsystematischen Anwendung und der
Funktion genauer untersucht und analysiert. Zu diesen Merkmalen zählen Anglizismen,
Vulgarismen, konnotative Verschiebungen, Personenbezeichnungen und soziale
Typisierungen, Wertadjektive und Wortbildung. Der vierte und letzte Abschnitt soll Aspekte des Raps aufgezeigt werden, die ebenfalls charakteristische Merkmale darstellen.
Dazu zählen die metaphorische Ausdrucksweise und die Intertextualität in Rap-Texten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die HipHop-Kultur – „Wenn ihr HipHop als Kultur seht, hebt eure Arme, bewegt sie von rechts nach links"
- Die Geschichte des HipHop - US-amerikanische Ursprunge
- HipHop in Deutschland
- Die Gesetze des HipHop
- Jugendsprache – Ein Überblick
- Forschungsüberblick zum Thema Jugendsprache
- Musik- und Jugendsprachforschung
- Methodisches Vorgehen
- Das Textkorpus
- Die Analyse
- Anglizismen in der HipHop-Kultur – „Ihr Typen wollt deluxemasig flown,Styles kicken wie ich?"
- Anglizismus - Eine Definition
- Methode der Untersuchung der Anglizismen
- Auswertung der Untersuchung
- Gründe der Verwendung von Anglizismen in deutschen Rap-Texten
- Wortschatz – „Bitch, du bist der Typ ohne Eier im Sack“
- Vulgarismen
- Personenbezeichnung und soziale Typisierung
- Konnotative Verschiebung
- Wertadjektive
- Die,,neue deutsche Harte“ im HipHop
- Homophobe Tendenzen im HipHop
- Frauenfeindlichkeit im HipHop
- Nationalsozialistische Tendenzen
- Wortbildung in der HipHop-Sprache – „ Jede Menge Klänge für Abgeher und Stagediver
- Substantive
- Adjektive
- Verben
- Zwischenfazit: Wortbildung
- Exkurs: Vom Infix „izz” und dem Suffix „izzle” – „Fo' shizzle, my nizzle"
- Die Syntax - „Habt ihr Interesse, an Rap und fette Basse?"
- Vergleiche und Metaphern – „HipHop ist wie Pizza auch schlecht noch recht beliebt"
- Vergleiche in Rap-Texten
- Metaphern in Rap-Texten
- Intertextualitat - „Ohladida“ Eine Analyse eines Beefs
- Exkurs: Musik- und Textgestaltung–„Verse für den Kopf, Basse für den Magen"
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Primarquellen (Textkorpus)
- Sekundarquellen
- Internetquellen
- Anhang
- Tabelle Textkorpus
- Grafiken
- Tabellen
- Korpus Songtexte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der linguistischen Analyse der HipHop-Sprache im deutschsprachigen Raum. Ziel ist es, ein linguistisches Profil dieser Sprache zu erstellen, indem sprachsystematische Aspekte untersucht und charakteristische Merkmale herausgearbeitet werden. Die Arbeit betrachtet die HipHop-Sprache als eigenständiges Sprachsystem und untersucht, inwiefern sie sich von der allgemeinen Jugend- und Standardsprache abgrenzt. Dabei werden verschiedene sprachliche Ebenen wie Wortschatz, Wortbildung, Syntax und Stilmittel analysiert.
- Die Entwicklung und Verbreitung der HipHop-Kultur in Deutschland
- Die sprachlichen Besonderheiten der HipHop-Sprache
- Der Einfluss von Anglizismen und Vulgarismen auf die HipHop-Sprache
- Die Rolle von Metaphern und Intertextualität in Rap-Texten
- Die Bedeutung der HipHop-Sprache für die Subkultur und ihre Identitätsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Relevanz der Untersuchung der HipHop-Sprache dar. Sie beleuchtet die Bedeutung der Sprache für die Subkultur und die Herausforderungen, die sich aus der Untersuchung von Jugendsprachen aus der Out-Group-Perspektive ergeben.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Geschichte der HipHop-Kultur, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Es werden die Ursprünge des HipHop und seine Entwicklung zu einer globalen Kulturbewegung dargestellt. Außerdem werden die „Gesetze“ des HipHop erläutert, die die Kultur prägen und für ihre Mitglieder verbindlich sind.
Das dritte Kapitel bietet einen Überblick über die Jugendsprachforschung im Allgemeinen und beleuchtet die spezifischen Aspekte der Musik- und Jugendsprachforschung. Es werden verschiedene Ansätze und Theorien zur Analyse von Jugendsprachen vorgestellt.
Das vierte Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der Arbeit. Es werden die Auswahl des Textkorpus und die analytischen Methoden erläutert, die für die Untersuchung der HipHop-Sprache verwendet werden.
Das fünfte Kapitel analysiert die Verwendung von Anglizismen in der HipHop-Sprache. Es werden die Gründe für die Verwendung von Anglizismen und deren Auswirkungen auf die deutsche Sprache untersucht.
Das sechste Kapitel befasst sich mit dem Wortschatz der HipHop-Sprache. Es werden verschiedene Kategorien von Wörtern untersucht, wie Vulgarismen, Personenbezeichnungen und Wertadjektive. Außerdem wird die „neue deutsche Harte“ im HipHop beleuchtet und deren Auswirkungen auf die Sprache analysiert.
Das siebte Kapitel untersucht die Wortbildung in der HipHop-Sprache. Es werden verschiedene Arten der Wortbildung, wie die Bildung von Substantiven, Adjektiven und Verben, analysiert.
Das achte Kapitel befasst sich mit der Syntax der HipHop-Sprache. Es werden die Besonderheiten der Satzstruktur und die Verwendung von grammatischen Elementen in Rap-Texten untersucht.
Das neunte Kapitel analysiert die Verwendung von Vergleichen und Metaphern in Rap-Texten. Es werden die Funktionen dieser Stilmittel und ihre Bedeutung für die sprachliche Gestaltung von Rap-Texten untersucht.
Das zehnte Kapitel befasst sich mit dem Phänomen der Intertextualität in Rap-Texten. Es wird ein Beispiel für einen „Beef“ analysiert und die Bedeutung von Intertextualität für die HipHop-Kultur erläutert.
Das elfte Kapitel bietet einen Exkurs in die Musik- und Textgestaltung von Rap-Songs. Es werden drei Beispiele für Rap-Songs analysiert und die Zusammenhänge zwischen Musik und Text untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die HipHop-Kultur, Jugendsprache, Anglizismen, Vulgarismen, Wortbildung, Syntax, Metaphern, Intertextualität, Rap-Texte, Musik- und Textgestaltung. Die Arbeit beleuchtet die sprachlichen Besonderheiten der HipHop-Sprache und untersucht, inwiefern sie sich von der allgemeinen Jugend- und Standardsprache abgrenzt. Sie analysiert verschiedene sprachliche Ebenen und untersucht die Bedeutung der Sprache für die Subkultur und ihre Identitätsbildung.
- Arbeit zitieren
- Anna-Maria Brinkop (Autor:in), 2008, Charakteristika der HipHop-Sprache in Raptexten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131683