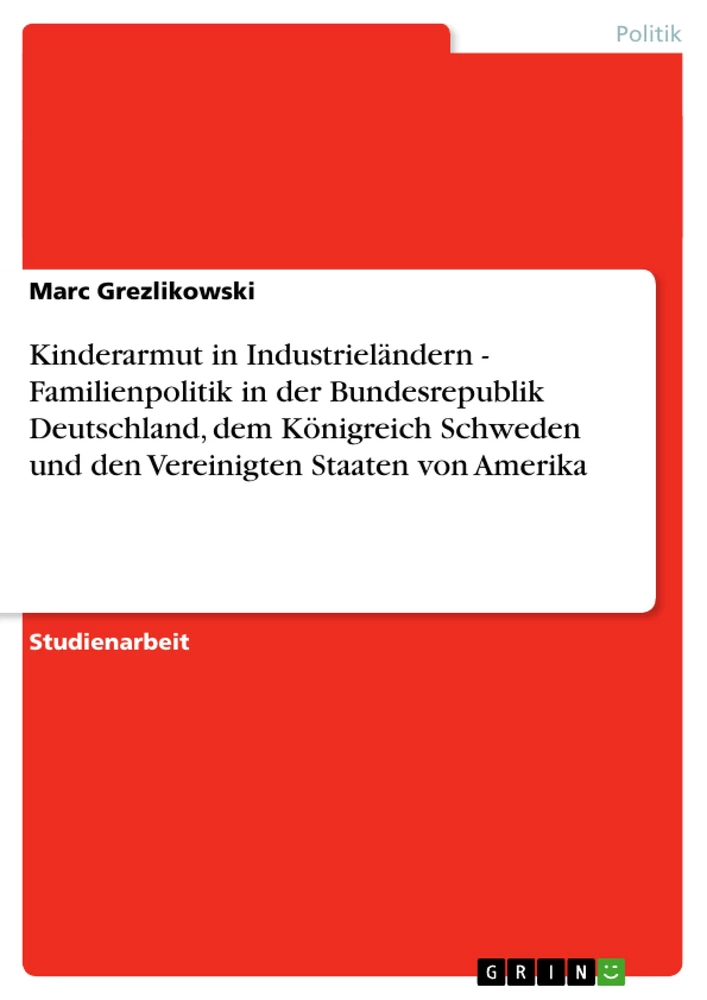Im März 2005 veröffentlichte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) eine umfassende Studie zur Entwicklung der Kinderarmut in den sogenannten Industrieländern seit dem Jahr 1990 („Child Poverty in Rich Countries 2005“). Diese kam zu dem Ergebnis, dass sich in 17 von 24 OECD-Staaten die Lebensverhältnisse von Kindern innerhalb der vergangenen 15 Jahre verschlechtert haben. In Schweden leben beispielsweise vier Prozent der Kinder in relativer Armut, in Deutschland sind es dagegen über zehn und in den Vereinigten Staaten von Amerika sogar knapp 22 Prozent. Zudem zeigt die Studie deutliche Unterschiede im Rückgang beziehungsweise Anstieg der relativen Kinderarmut in den „reichen“ Ländern der westlichen Welt. So fiel sie beispielsweise in den USA um 2,4 Prozent, während sie in Deutschland mit 2,7 Prozent überdurchschnittlich stark anstieg. UNICEF zufolge besteht ein erheblicher Zusammenhang zwischen der Höhe staatlicher Aufwendungen für soziale Leistungen und der Kinderarmut. In den Vereinigten Staaten liegt die Höhe der Sozialleistungen bei unter fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts und die der Kinderarmut bei über 20 Prozent. Schweden dagegen gibt mehr als zehn Prozent des BIP für sein Wohlfahrtssystem aus – nur vier Prozent der Kinder sind hier von relativer Armut betroffen. Doch nicht nur die Höhe der Sozialleistungen ist entscheidend für die Bekämpfung der Armut. So geben zehn OECD-Län¬der, unter ihnen auch Deutschland, einen ungefähr gleichen Anteil ihres Bruttoinlandspro¬dukts für soziale Absicherung aus – trotzdem variiert die Armutsrate von drei Prozent in Norwegen über zehn Prozent in Deutschland bis zu 15 Prozent in Groß Britannien.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition
- Kinderpolitik in Schweden, den USA und Deutschland
- Politik in Schweden - das sozialdemokratische Modell
- Politik in den USA -,,workfare“ statt „welfare“
- Politik in Deutschland - der Mittelweg
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Kinderarmut in Industrieländern und analysiert die Familienpolitik in Deutschland, Schweden und den USA. Ziel ist es, die unterschiedlichen sozialpolitischen Ansätze der drei Länder zu vergleichen und die finanziellen sowie nicht-finanziellen Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut zu beleuchten.
- Definition von Armut und Kinderarmut
- Analyse der Familienpolitik in Schweden, den USA und Deutschland
- Vergleich der sozialpolitischen Ansätze der drei Länder
- Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut
- Zusammenhang zwischen Familienpolitik und Kinderarmut
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Kinderarmut in Industrieländern ein und stellt die Relevanz der Thematik anhand von Statistiken und Studien dar. Im zweiten Kapitel wird der Armutsbegriff definiert und die Unterscheidung zwischen absoluter und relativer Armut erläutert. Die Studie von UNICEF wird vorgestellt, die sechs Analyseansätze für Kinderarmut in wohlständigen Industriestaaten einbezieht.
Das dritte Kapitel widmet sich der Familien- und Kinderpolitik in Schweden, den USA und Deutschland. Es werden die sozialpolitischen Ansätze der drei Länder im Detail dargestellt und die jeweiligen Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut analysiert. Dabei wird auf die Unterschiede in den Wohlfahrtssystemen und die jeweiligen Ideologien der Länder eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Kinderarmut, Familienpolitik, Sozialpolitik, Wohlfahrtsstaat, Schweden, USA, Deutschland, sozialdemokratisches Modell, liberale Ideologie, Mittelweg, relative Armut, absolute Armut, UNICEF, Familienleistungen, Kinderbetreuung, Bildung, Gesundheit, Lebensstandard.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Kinderarmut in Industrieländern gemessen?
Es wird meist zwischen absoluter Armut (Mangel an Grundbedürfnissen) und relativer Armut (Einkommen deutlich unter dem Landesdurchschnitt) unterschieden.
Warum hat Schweden eine so geringe Kinderarmutsrate?
Schweden nutzt ein sozialdemokratisches Modell mit hohen Staatsausgaben für soziale Leistungen, Kinderbetreuung und Bildung, was die Armutsquote auf ca. 4% senkt.
Wie unterscheidet sich die US-Politik von der schwedischen?
Die USA verfolgen einen liberalen "Workfare"-Ansatz mit geringeren Sozialleistungen, was zu einer deutlich höheren Kinderarmutsrate von über 20% führt.
Welchen Platz nimmt Deutschland im Vergleich ein?
Deutschland wird oft als "Mittelweg" beschrieben. Trotz ähnlicher Sozialausgaben wie andere Länder stieg die Kinderarmut hier zeitweise überdurchschnittlich an.
Welche Rolle spielt die UNICEF bei diesem Thema?
UNICEF veröffentlicht umfassende Studien wie „Child Poverty in Rich Countries“, die den Zusammenhang zwischen staatlichen Investitionen und Armutsraten belegen.
- Arbeit zitieren
- Marc Grezlikowski (Autor:in), 2008, Kinderarmut in Industrieländern - Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich Schweden und den Vereinigten Staaten von Amerika, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131721