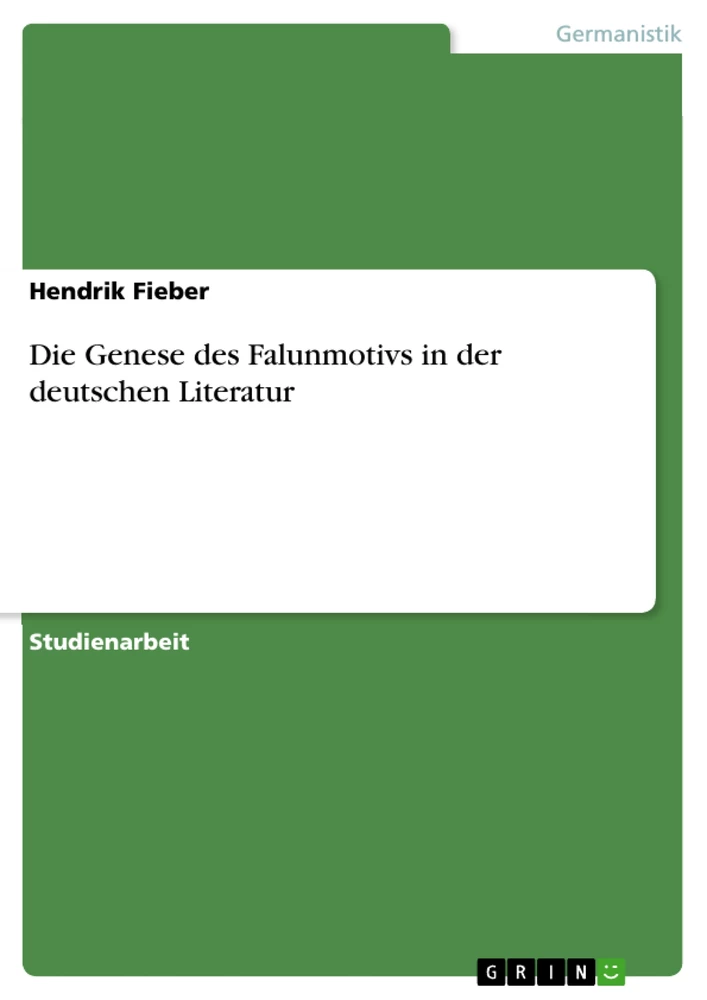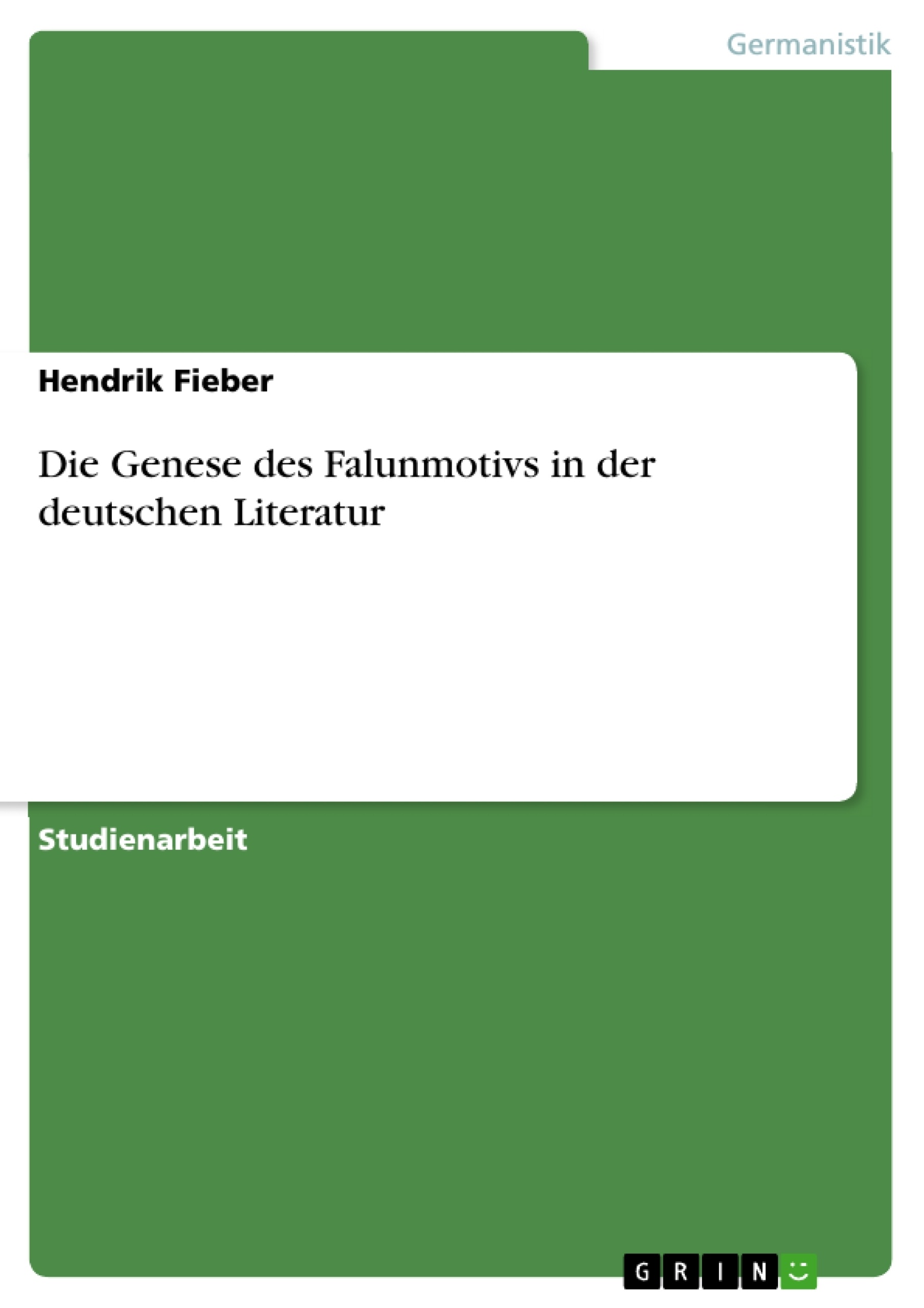Die Geschichte des Bergmannes von Falun gehört zu den großen Motiven der deutschen Literatur und hat nicht ohne Grund Einzug in Elisabeth Frenzels dichtungsgeschichtliches Lexikon Stoffe der Weltliteratur gefunden. Die Überlieferung des Schicksal von Mathias Israelson, der 50 Jahre nach seinem Tod unter Tage als konservierte Leiche geborgen und von seiner ehemaligen Verlobten identifiziert wurde, beruht auf historischen Tatsachen und ist vor allem im 19. Jahrhundert von „nicht weniger als dreißig Autoren“ (Gold 1990, 115) bearbeitet worden.
Die literaturwissenschaftliche Forschung hat viele dieser Werke, die zum Teil von namhaften Dichtern wie E.T.A Hoffmann, Johann Peter Hebel oder Hugo von Hofmansthal verfasst worden sind, genau untersucht. Allerdings gehen diese Untersuchungen in der Regel nur von jeweils einem Werk aus, das in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt und genauestens auf mögliche Bedeutungsebenen abgeklopft wird. Im günstigsten Fall werden ein oder zwei Referenzwerke innerhalb des Falunthemas genannt, zu dem sich intertextuelle Bezüge im vorliegenden Werk feststellen lassen. Kaum beachtet wird in der wissenschaftlichen Forschung hingegen die Frage, in wie fern das Falunmotiv in der Literatur von den frühen Werken bis zu den späten Adaptionen eine auf Intertextualität basierende Entwicklung durchgemacht hat.
Diese Arbeit geht von der These aus, dass sich in den Bearbeitungen der bedeutenden Autoren für das Falunmtov eine stringente Genese feststellen lässt, die sowohl einen Ausgangspunkt als auch einen Endpunkt aufweist und in der gegenläufige Tendenzen so gut wie nicht festzustellen sind. Um der Fülle der Bearbeitungen Herr zu werden beschränkt sich diese Arbeit auf die Untersuchung der fünf bedeutendsten Werke der Autoren Schubert, Hebel, von Arnim, Hoffmann und von Hofmansthal, verweist aber an einigen Stellen auf weitere Werke innerhalb des Themas.
Darüber hinaus soll in dieser Arbeit außerdem eine weitere These vertreten werden, die davon ausgeht, dass das bekannteste Werk innerhalb der Faluntradition, Johann Peter Hebels Unverhofftes Wiedersehen, für die Genese des Motivs keine entscheidende Rolle spielt und dass stattdessen die Entwicklung des Motivs den anderen hier bearbeiteten Autoren zuzusprechen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der historische Kern der Falungeschichte
- Schubert als Wegbereiter für die literarische Bearbeitung des Falunstoffes
- Johann Peter Hebels Unverhofftes Wiedersehen
- Achim von Arnims Ballade Des ersten Bergmanns ewige Jugend
- E.T.A Hoffmanns Novelle Die Bergwerke zu Falun
- Abschied von der Wiedersehensszene: Hugo von Hofmansthals Drama Das Bergwerk zu Falun
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Genese des Falunmotivs in der deutschen Literatur. Sie untersucht, wie dieses Motiv in verschiedenen Werken von bedeutenden Autoren wie Schubert, Hebel, von Arnim, Hoffmann und von Hofmansthal verarbeitet wurde und welche Entwicklung es dabei durchgemacht hat. Die Arbeit stellt die These auf, dass die Entwicklung des Motivs einen klaren Verlauf aufweist, der von den frühen Werken bis zu den späten Adaptionen verfolgt werden kann.
- Die historische Grundlage des Falunmotivs
- Die Rolle von Schubert als Wegbereiter für die literarische Bearbeitung des Themas
- Die Entwicklung des Motivs in den Werken von Hebel, von Arnim, Hoffmann und von Hofmansthal
- Die Bedeutung der Wiedersehensszene in der Genese des Motivs
- Die Frage, ob Hebels Unverhofftes Wiedersehen eine entscheidende Rolle für die Entwicklung des Motivs spielt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach der Genese des Falunmotivs in der deutschen Literatur. Sie erläutert die Bedeutung des Themas und die Relevanz der ausgewählten Werke.
Das zweite Kapitel beleuchtet den historischen Kern der Falungeschichte. Es beschreibt den Leichenfund im Bergwerk von Falun im Jahr 1719 und die verschiedenen Quellen, die über dieses Ereignis berichten. Es werden die verschiedenen Versionen der Geschichte beleuchtet, darunter die von Leyel und die von Dependorf.
Das dritte Kapitel widmet sich der Rolle von Gotthilf Heinrich von Schubert als Wegbereiter für die literarische Bearbeitung des Falunstoffes. Es zeigt, wie Schubert in seinem Werk Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften den Leichenfund aus naturwissenschaftlicher Perspektive betrachtet und gleichzeitig die Wiedersehensszene erstmals dichterisch gestaltet.
Das vierte Kapitel analysiert Johann Peter Hebels Unverhofftes Wiedersehen. Es untersucht, wie Hebel den Falunstoff in seiner Erzählung verarbeitet und welche Bedeutung die Wiedersehensszene in seinem Werk hat.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit Achim von Arnims Ballade Des ersten Bergmanns ewige Jugend. Es analysiert die Gestaltung des Motivs in Arnims Werk und die Rolle der Wiedersehensszene in der Ballade.
Das sechste Kapitel untersucht E.T.A Hoffmanns Novelle Die Bergwerke zu Falun. Es analysiert die Gestaltung des Motivs in Hoffmanns Werk und die Bedeutung der Wiedersehensszene in der Novelle.
Das siebte Kapitel befasst sich mit Hugo von Hofmansthals Drama Das Bergwerk zu Falun. Es analysiert die Gestaltung des Motivs in Hofmansthals Werk und die Rolle der Wiedersehensszene im Drama.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Genese des Falunmotivs, die literarische Bearbeitung des Falunstoffes, die Wiedersehensszene, die Werke von Schubert, Hebel, von Arnim, Hoffmann und von Hofmansthal, Intertextualität, historische Quellen, naturwissenschaftliche Perspektive, dichterische Gestaltung, romantische Liebe, Bergwerk von Falun, Eisenvitriol, Leichenfund, Bergmannswitwen, Gastwirtschaften, Falunstoff, Rezeptionsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der historische Kern der Falungeschichte?
Es geht um Mathias Israelson, der 1719 nach 50 Jahren als konservierte Leiche in einem Bergwerk in Falun gefunden und von seiner ehemaligen Verlobten identifiziert wurde.
Welche Autoren haben das Falunmotiv bearbeitet?
Zu den bedeutendsten Autoren zählen G.H. von Schubert, Johann Peter Hebel, Achim von Arnim, E.T.A. Hoffmann und Hugo von Hofmannsthal.
Welche Rolle spielt Hebels „Unverhofftes Wiedersehen“?
Die Arbeit vertritt die These, dass Hebels Werk zwar bekannt ist, für die literarische Genese des Motivs jedoch eine weniger entscheidende Rolle spielt als oft angenommen.
Wie entwickelte sich das Motiv in der Literatur?
Die Genese zeigt eine Entwicklung von der naturwissenschaftlichen Betrachtung (Schubert) über romantische Novellen (Hoffmann) bis hin zum modernen Drama (Hofmannsthal).
Was ist die zentrale Bedeutung der Wiedersehensszene?
Die Szene, in der die gealterte Braut ihren jung gebliebenen toten Bräutigam identifiziert, ist das emotionale und strukturelle Herzstück fast aller Bearbeitungen.
- Arbeit zitieren
- Hendrik Fieber (Autor:in), 2007, Die Genese des Falunmotivs in der deutschen Literatur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131745