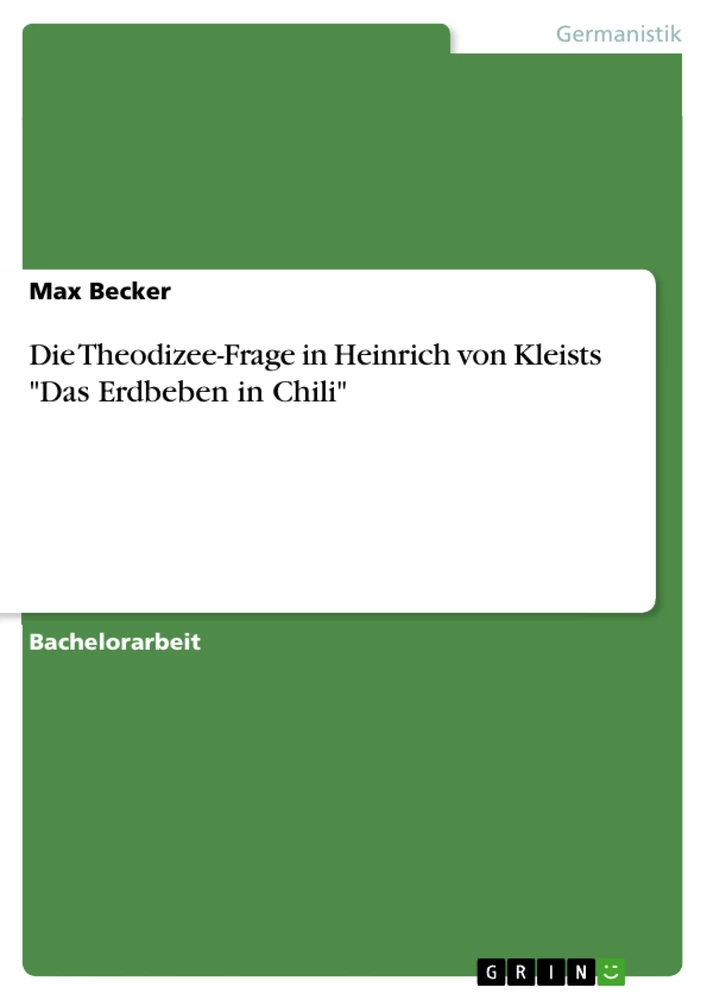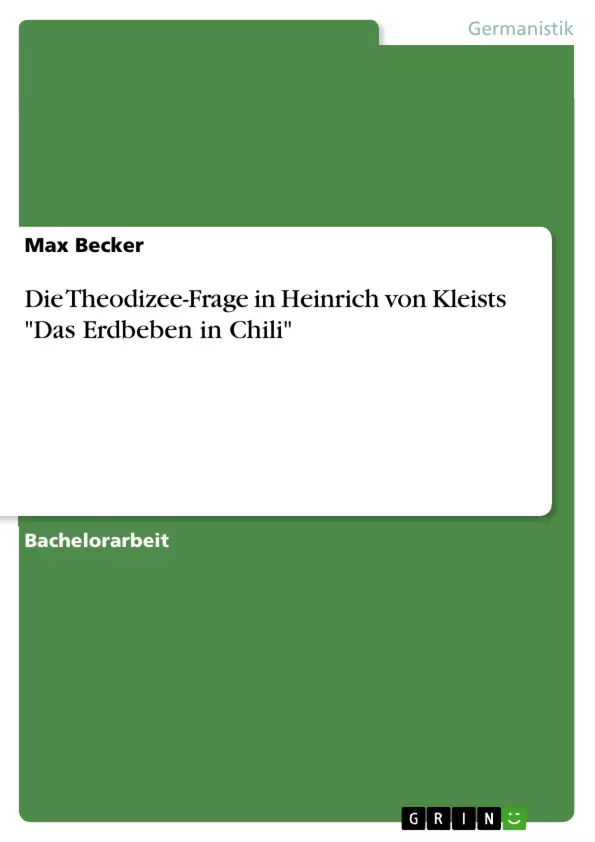Diese Arbeit soll, in Anlehnung an die Theodizee-Debatte in Kleists Novelle "Das Erbeben von Chili", den Umgang des Autors mit der seine Erzählung maßgeblich prägenden Frage des Glaubens an einen gerechten Gott näher beleuchten. Dabei wird
zunächst einmal der Begriff der Theodizee erklärt und die ganze Bandbreite der Auslegungen dieses Begriffes erläutert. Anschließend sollen dann, um die Textanalyse auch vor dem Hintergrund der von Kleist selbst ausgewählten
historischen Gegebenheiten vornehmen zu können, sowohl die ideengeschichtliche Komponente des Erdbebens von Lissabon herausgearbeitet als auch der biografische Bezug des Textinhalts zum Lebensinhalt von Heinrich von Kleist hergestellt werden.
Abschließend wird dann die Textanalyse selbst in Angriff genommen.
Die früheste von Kleist publizierte Erzählung "Das Erdbeben in Chili" relatiert die Liebesgeschichte eines geächteten Paares, das inmitten der katastrophalen Geschehnisse des historisch beglaubigten Erdbebens in Santiago de Chile im Jahr 1647 zunächst durch glückliche Umstände gerettet wird, nur um später erneut in eine Katastrophe zu geraten, indem sie dem Lynchmob der Gläubigen zum Opfer fallen. Obwohl Kleist auf ein historisches Ereignis verweist, das vor dem Erdbeben in Lissabon stattfand, literarisiert er die diesem Erdbeben entspringenden philosophischen und theologischen Kritikpunkte der Spätaufklärung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theodizee
- Begriffserklärung und Problemabriss
- Leibniz' Theodizee
- Theodizee-Verfahren
- Die Bonisierung des Übels durch Leugnungsversuche
- Die „Depotenzierung“ des Übels durch Verharmlosung
- Kleists erkenntnistheoretische Krise
- Das Erdbeben von Lissabon – eine ideengeschichtliche Referenz
- Das Erdbeben in Chili
- Eine zweite Heilsgeschichte? Ein Abriss der Bibelzitate im Erdbeben in Chili
- Perspektivierung des Leidens in das Erdbeben in Chili
- Die transzendente Fixierung der Deutungsinstanz
- Die Deutungsinstanz des Zufalls
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Theodizee-Frage in Heinrich von Kleists Novelle "Das Erdbeben in Chili" und analysiert den Umgang des Autors mit der Frage des Glaubens an einen gerechten Gott im Kontext des Erdbebens von Lissabon.
- Der Begriff der Theodizee und seine historische Entwicklung
- Leibniz' Theodizee und ihre Kritikpunkte
- Die ideengeschichtliche Bedeutung des Erdbebens von Lissabon
- Die Darstellung von Leiden und Schicksal in Kleists Novelle
- Die transzendente und zufällige Deutung von Katastrophen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Thematik der Theodizee-Frage und ihre Relevanz in Kleists Novelle ein. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs und stellt den Kontext der aufklärerischen Debatte im 18. Jahrhundert dar.
- Das zweite Kapitel behandelt den Begriff der Theodizee. Es geht auf die Problematik des Leids im Angesicht eines allmächtigen und allgütigen Gottes ein und stellt Leibniz' Theodizee als ein relevantes Beispiel vor.
- Das dritte Kapitel analysiert Kleists erkenntnistheoretische Krise, die sich aus der Auseinandersetzung mit der Theodizee-Frage ergibt.
- Das vierte Kapitel beleuchtet das Erdbeben von Lissabon als ein historisches Ereignis, das die Theodizee-Debatte neu entfacht hat.
- Das fünfte Kapitel analysiert die Darstellung des Erdbebens in Chili in Kleists Novelle. Es untersucht die Bibelzitate, die Perspektivierung des Leids und die Rolle der Deutungsinstanz.
Schlüsselwörter
Theodizee, Erdbeben von Lissabon, Heinrich von Kleist, "Das Erdbeben in Chili", Leiden, Schicksal, Gott, Glaube, Religion, Aufklärungszeit, Empirismus, Rationalität, Transzendenz, Zufall.
- Quote paper
- Max Becker (Author), 2022, Die Theodizee-Frage in Heinrich von Kleists "Das Erdbeben in Chili", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1317776