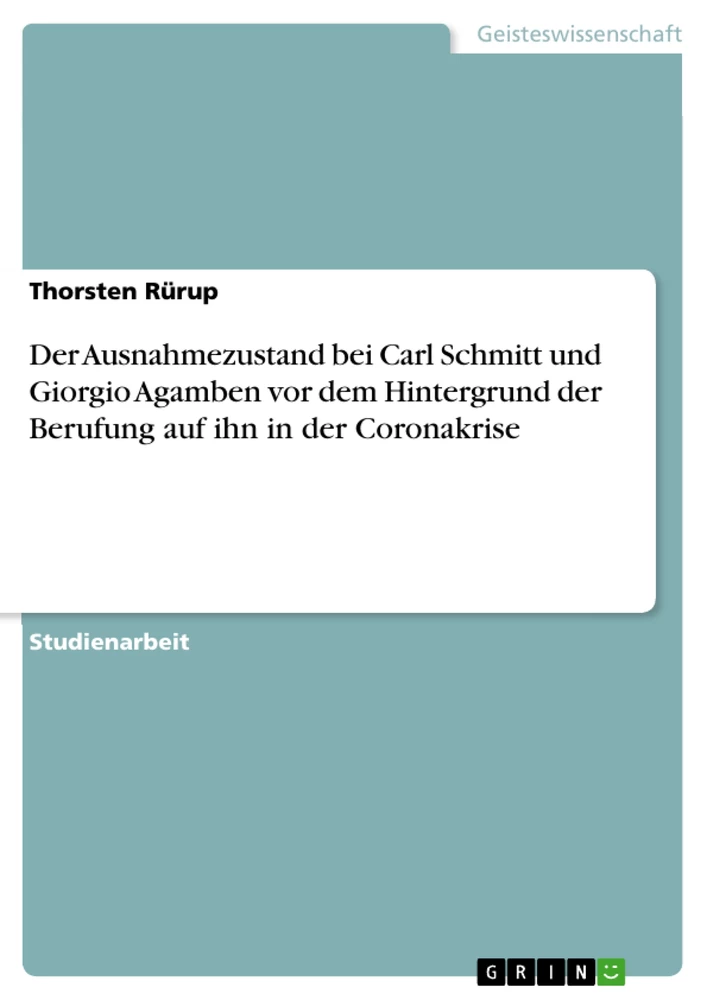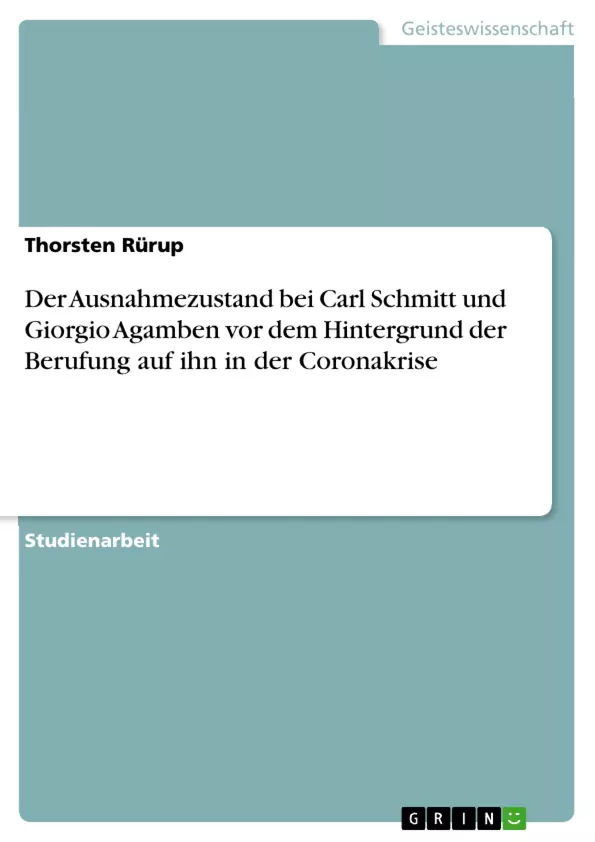Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Thema „Der Ausnahmezustand bei Carl Schmitt und Giorgio Agamben vor dem Hintergrund der Berufung auf ihn in der Corona-Krise“. Die vorliegende Hausarbeit unterzieht den Terminus Ausnahmezustand anhand der folgenden Forschungsfrage einer genauen Untersuchung: Wie unterscheiden sich die Terminologien des Ausnahmezustands von Carl Schmitt und Giorgio Agamben und wie sind sie vor dem Hintergrund der Berufung auf ihn in der Corona-Krise einzuordnen?
Am 25. Oktober 2021 zitierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung den geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit den Worten „Der Ausnahmezustand, vom Bundestag festgestellt, der kann aus meiner Sicht beendet werden“. Dieser Satz repräsentiert symbolhaft die anhaltende Diskussion um die Ausweitung der staatlichen Befugnisse seit dem Beginn der Corona-Krise Anfang des Jahres 2020 bis heute. Dabei wird die Rhetorik vom Ausnahmezustand augenscheinlich als Begründung für staatliches Handeln und insbesondere für die Einschränkung von Grundrechten herangezogen. In diesem Kontext scheint es geboten, den Begriff des Ausnahmezustands einer genauen Diagnose zu unterziehen. Dafür bieten sich die Arbeiten von Carl Schmitt und Giorgio Agamben, die im wissenschaftlichen Diskurs über den Ausnahmezustand eine hohe Relevanz aufweisen, an.
Der erste Teil der Arbeit widmet sich dem Terminus Ausnahmezustand. Es wird zunächst ein Rückblick auf die Notrechtslehre vorgenommen. Darauf folgt eine Rezeption des Terminus Ausnahmezustand aus den Perspektiven von Schmitt und Agamben, bevor ihre zentralen Unterschiede diskutiert werden. Anschließend erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit der Rhetorik vom Ausnahmezustand in der anhaltenden Diskussion über die Einschränkung von Grundrechten in der Corona-Krise. Hierzu werden Beiträge von Agamben, Barczak, Hoffmann und Stübinger herangezogen. Daran schließt sich eine eigene Einschätzung des Verfassers der vorliegenden Arbeit an. Im Fazit werden die Ergebnisse aus dem ersten Teil der Arbeit mit den Befunden aus dem kritischen Diskurs über die Rhetorik vom Ausnahmezustand zusammengeführt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung.
- 2 Der Ausnahmezustand
- 2.1 Rückschau auf das Notstandsrecht
- 2.2 Die Terminologie des Ausnahmezustands nach Schmitt
- 2.3 Der Ausnahmezustand aus der Perspektive Agambens
- 2.4 Zentrale Unterschiede zwischen Schmitt und Agamben
- 3 Die Bedienung der Rhetorik vom Ausnahmezustand in der Corona-Krise
- 3.1 Kritischer Diskurs in der Corona-Krise
- 3.2 Kritik des Verfassers der Hausarbeit
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Begriff des Ausnahmezustands im Kontext der Corona-Krise, insbesondere die Theorien von Carl Schmitt und Giorgio Agamben und deren Relevanz in der aktuellen Debatte über staatliche Befugnisse und Grundrechtseinschränkungen. Die Forschungsfrage lautet: Wie unterscheiden sich die Terminologien des Ausnahmezustands von Carl Schmitt und Giorgio Agamben und wie sind sie vor dem Hintergrund der Berufung auf ihn in der Corona-Krise einzuordnen?
- Der Begriff des Ausnahmezustands und seine historische Entwicklung
- Schmitts und Agambens Konzepte des Ausnahmezustands und ihre zentralen Unterschiede
- Die Rhetorik des Ausnahmezustands in der Corona-Krise und die Kritik an dessen Anwendung
- Die Bedeutung von Grundrechten in Zeiten des Ausnahmezustands
- Die Rolle des Staates und der Gesellschaft in der Bewältigung der Corona-Krise
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik des Ausnahmezustands ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext der Corona-Krise dar. Es beleuchtet die Debatte um die Ausweitung staatlicher Befugnisse und die Einschränkung von Grundrechten. Das zweite Kapitel widmet sich dem Begriff des Ausnahmezustands anhand der Theorien von Carl Schmitt und Giorgio Agamben. Es werden sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede in ihren Konzepten aufgezeigt. Das dritte Kapitel analysiert die Nutzung der Rhetorik vom Ausnahmezustand in der Corona-Krise. Es werden verschiedene kritische Stimmen zu diesem Thema beleuchtet und die Einordnung der Hausarbeit in den Diskurs vorgenommen. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet eine eigene Einschätzung des Autors zur Thematik.
Schlüsselwörter
Ausnahmezustand, Carl Schmitt, Giorgio Agamben, Corona-Krise, Grundrechte, Notstandsrecht, Staat, Politik, Rhetorik, Kritik, Recht, Leben, Demokratie, Souveränität, Macht.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich Schmitt und Agamben beim Ausnahmezustand?
Carl Schmitt sieht den Ausnahmezustand als souveräne Entscheidung zur Rettung der Ordnung, während Agamben ihn als dauerhaftes Paradigma des Regierens und als Raum der Rechtsleere analysiert.
Welche Rolle spielt der Ausnahmezustand in der Corona-Krise?
Die Rhetorik vom Ausnahmezustand wurde genutzt, um weitreichende staatliche Befugnisse und die Einschränkung von Grundrechten zu begründen.
Was kritisiert Giorgio Agamben an den Corona-Maßnahmen?
Agamben warnt vor der Normalisierung des Ausnahmezustands und der Reduktion des Menschen auf das „nackte Leben“ unter dem Vorwand der Gesundheitssicherheit.
Was versteht man unter Notstandsrecht?
Das Notstandsrecht umfasst gesetzliche Regelungen, die dem Staat in Krisenzeiten außerordentliche Befugnisse einräumen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.
Wie wird die Beendigung des Ausnahmezustands in der Arbeit thematisiert?
Die Arbeit reflektiert die politische Debatte (z. B. Aussagen von Jens Spahn) über den Zeitpunkt, an dem die vom Bundestag festgestellte epidemische Lage und die damit verbundenen Sonderbefugnisse enden sollten.
- Citar trabajo
- Thorsten Rürup (Autor), 2022, Der Ausnahmezustand bei Carl Schmitt und Giorgio Agamben vor dem Hintergrund der Berufung auf ihn in der Coronakrise, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1318082