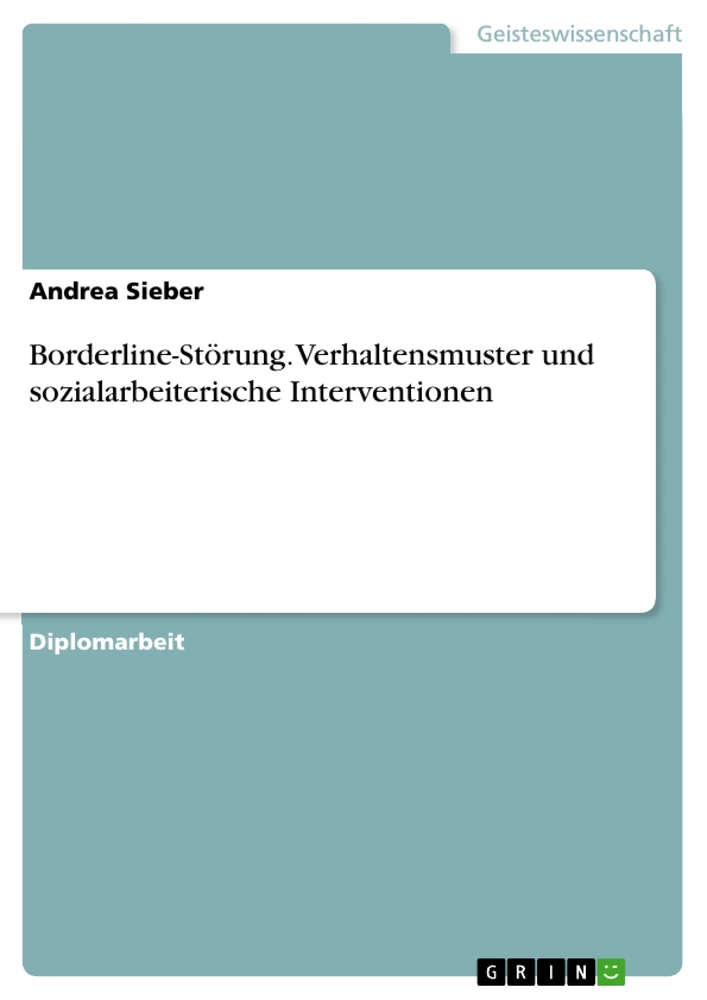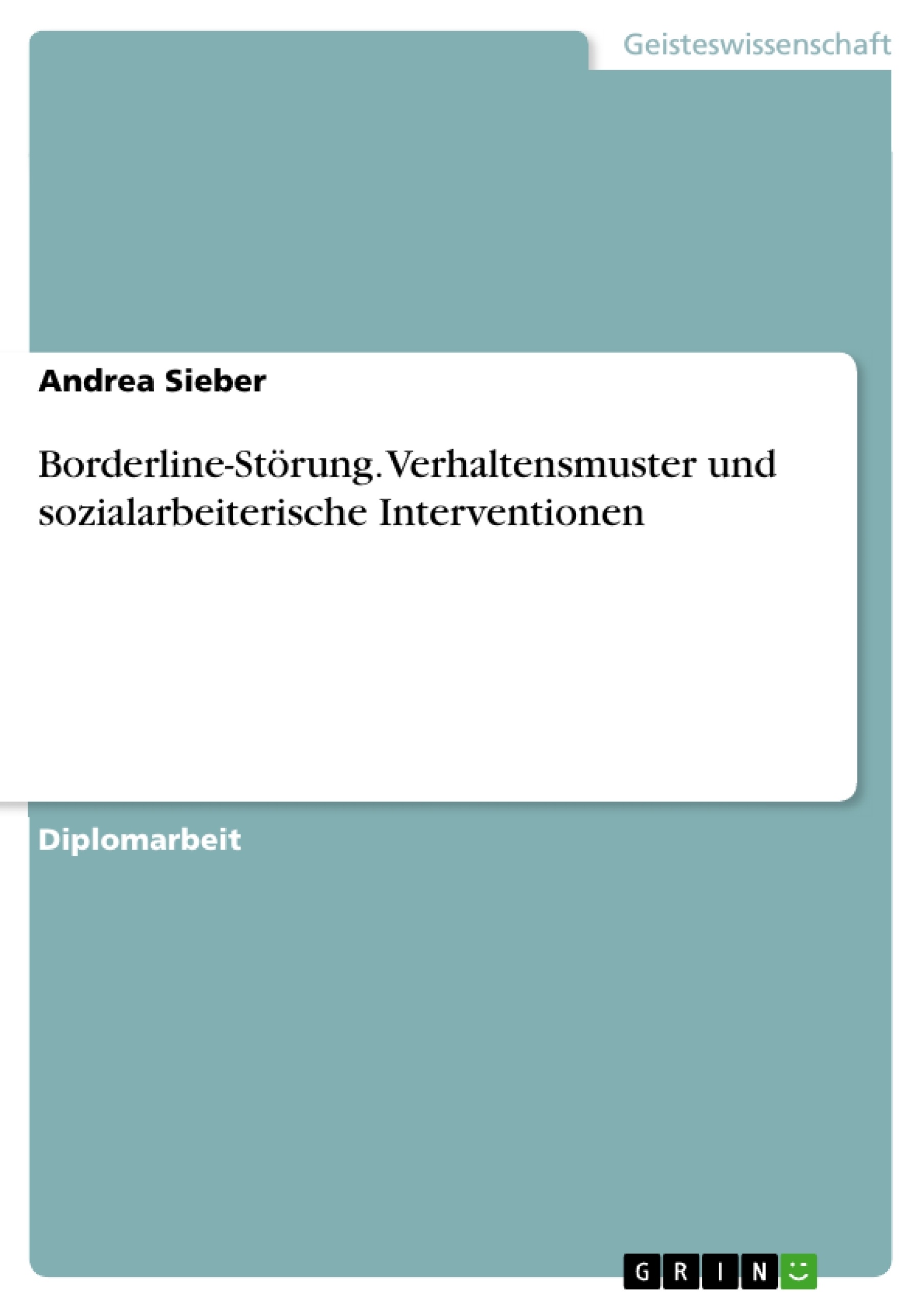In verschiedenen literarischen Neuerscheinungen wird das Borderline-Phänomen als „Krankheit der Moderne“ bezeichnet, welches Schätzungen zu Folge derzeit die drittgrößte Gruppe psychischer psychischer Erkrankungen darstellt. Der Begriff Borderline (Grenze, Grenzgänger) an sich impliziert die „besondere“ Fähigkeit dieser Menschen, nicht nur sich selbst, sondern auch ihr persönliches Umfeld an ihre Grenzen zu bringen. Warum Menschen mit einer Borderline-Störung eine solche Wirkung haben können und welche konkreten Verhaltensmuster sie aufweisen, stellt neben der Auseinandersetzung mit aktuellen Behandlungsmethoden und sozialarbeiterischen Interventionsschritten ein Schwerpunkt dieser Arbeit dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschreibung der Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Die Geschichte des Störungsbegriffs
- Definition der Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Die Entwicklung einer Persönlichkeitsstörung
- Allgemeine Kriterien einer Persönlichkeitsstörung nach dem DSM-IV
- Diagnostische Kriterien der Borderline-Störung nach dem DSM IV
- Epidemiologie
- Verlauf und Prognose
- Differenzialdiagnose und Komorbidität
- Ätiologie
- Persönlichkeitsstruktur eines Menschen mit Borderline-Erkrankung nach Kernberg
- Störung der Entwicklung des Selbst als Ursprung der Borderline-Erkrankung
- „Primitive Abwehrmechanismen“
- Identitätsdiffusion und pathologische Auffassung von anderen
- Fähigkeit der Realitätsprüfung
- Zusammenfassung
- Verhaltensweisen und Symptome von Menschen mit einer Borderline-Störung
- Erläuterung der Kriterien nach dem DSM-IV
- Weitere wichtige Merkmale der Borderline-Störung
- Zusammenfassung
- Sozialarbeit mit Borderline-Persönlichkeiten: Behandlungsmethoden und Interventionen
- Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) nach Linehan
- Der dialektisch-behaviorale Behandlungsansatz
- Dialektische Strategie
- Die Therapeutische Beziehung in der DBT
- Sozialarbeiterische Strategien
- Das Kommunikationsmodell: SET
- Aufgabenbereiche und Bedeutung der Sozialarbeit im Umgang mit psychisch Kranken/ Borderline-Persönlichkeiten
- Der ganzheitlich-systemische Anspruch der Sozialarbeit
- Empowerment
- Erlernte Hilflosigkeit
- Das Konzept der Salutogenese
- Die professionelle Haltung in der Empowerment-Arbeit
- Empowerment-Strategien
- Angehörigenarbeit
- Die Welt einer Borderline-Persönlichkeit verstehen
- Auswirkungen des Borderline-Verhaltens auf den Angehörigen
- Verantwortung übernehmen
- Grenzen setzen
- Hilfe in Anspruch nehmen
- Zusammenfassung
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Borderline-Persönlichkeitsstörung zu vermitteln. Sie beschreibt die Störung, ihre Symptome, ihre Behandlung und die Rolle der Sozialarbeit in diesem Kontext. Der Fokus liegt auf der Vermittlung von Wissen und Handlungskompetenzen für den Umgang mit Betroffenen.
- Beschreibung der Borderline-Persönlichkeitsstörung und ihrer Geschichte
- Analyse der Symptome und Verhaltensweisen von Menschen mit Borderline-Störung
- Darstellung verschiedener Therapieansätze, insbesondere der Dialektisch-Behavioralen Therapie (DBT)
- Beschreibung der Aufgaben und des ganzheitlich-systemischen Ansatzes der Sozialarbeit bei Borderline-Erkrankungen
- Der Empowerment-Ansatz und die Arbeit mit Angehörigen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung ein und erläutert die steigende Bedeutung des Themas in der Forschung und Praxis. Sie hebt die Unsicherheiten im Umgang mit dieser Störung hervor und benennt die Zielsetzung der Arbeit: die Darstellung von Symptomen, Verhaltensweisen und Behandlungsmethoden sowie sozialarbeiterischer Interventionen.
Beschreibung der Borderline-Persönlichkeitsstörung: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der Borderline-Persönlichkeitsstörung, beginnend mit der historischen Entwicklung des Störungsbegriffs. Es definiert die Störung anhand der Kriterien des DSM-IV, beleuchtet epidemiologische Daten, Verlauf und Prognose sowie die Differenzialdiagnose und Komorbidität. Schließlich wird die Persönlichkeitsstruktur nach Kernberg detailliert erklärt, inklusive der Störung der Selbstentwicklung, primitiver Abwehrmechanismen, Identitätsdiffusion und der Fähigkeit zur Realitätsprüfung.
Verhaltensweisen und Symptome von Menschen mit einer Borderline-Störung: Dieses Kapitel beschreibt die konkreten Verhaltensweisen und Symptome der Borderline-Störung im Detail, basierend auf den Kriterien des DSM-IV. Es beleuchtet die komplexen Zusammenhänge der oft unberechenbaren und impulsiven Verhaltensmuster, um ein besseres Verständnis für die Lebenssituation von Betroffenen zu ermöglichen. Zusätzliche wichtige Merkmale wie Depression, Antisozialität, Drogenmissbrauch, Essstörungen und Sexualität werden ebenfalls behandelt.
Sozialarbeit mit Borderline-Persönlichkeiten: Behandlungsmethoden und Interventionen: Dieses Kapitel fokussiert auf Behandlungsmethoden und sozialarbeiterische Interventionen. Im Mittelpunkt steht die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) nach Linehan, deren dialektisch-behavioraler Ansatz, die therapeutische Beziehung und sozialarbeiterische Strategien ausführlich erläutert werden. Das Kommunikationsmodell SET wird als unterstützende Methode vorgestellt. Die Rolle der Sozialarbeit, ihr ganzheitlich-systemischer Ansatz, der Empowerment-Ansatz und die Angehörigenarbeit werden ebenfalls umfassend behandelt, inklusive der Bedeutung von erlernter Hilflosigkeit und Salutogenese.
Schlüsselwörter
Borderline-Persönlichkeitsstörung, DSM-IV, Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT), Sozialarbeit, Empowerment, Angehörigenarbeit, Symptome, Verhaltensweisen, Behandlungsmethoden, Kernberg, Identitätsdiffusion, Impulsivität, Selbstverletzung, Komorbidität, SET.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Borderline-Persönlichkeitsstörung: Ein umfassender Überblick"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Störung, ihrer Symptome, ihrer Behandlung und der Rolle der Sozialarbeit im Kontext der BPS.
Welche Aspekte der Borderline-Persönlichkeitsstörung werden behandelt?
Das Dokument behandelt die Geschichte des Störungsbegriffs, die Definition nach DSM-IV, Epidemiologie, Verlauf und Prognose, Differenzialdiagnose und Komorbidität, Ätiologie (nach Kernberg), Persönlichkeitsstruktur, Symptome und Verhaltensweisen, verschiedene Therapieansätze (insbesondere die Dialektisch-Behaviorale Therapie - DBT), die Rolle der Sozialarbeit, den ganzheitlich-systemischen Ansatz, Empowerment, Angehörigenarbeit und das Kommunikationsmodell SET.
Wie wird die Borderline-Persönlichkeitsstörung definiert?
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung wird anhand der diagnostischen Kriterien des DSM-IV definiert. Das Dokument beschreibt diese Kriterien detailliert und beleuchtet die Entwicklung einer Persönlichkeitsstörung im Allgemeinen.
Welche Behandlungsmethoden werden vorgestellt?
Im Mittelpunkt steht die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) nach Linehan. Ihr dialektisch-behavioraler Ansatz, die therapeutische Beziehung und sozialarbeiterische Strategien werden ausführlich erläutert. Zusätzlich wird das Kommunikationsmodell SET als unterstützende Methode vorgestellt.
Welche Rolle spielt die Sozialarbeit im Umgang mit Borderline-Persönlichkeiten?
Das Dokument beschreibt die Aufgaben und den ganzheitlich-systemischen Ansatz der Sozialarbeit bei Borderline-Erkrankungen. Der Empowerment-Ansatz und die Bedeutung der Angehörigenarbeit werden ebenfalls umfassend behandelt, inklusive der Bedeutung von erlernter Hilflosigkeit und Salutogenese.
Welche Schlüsselkonzepte werden im Dokument behandelt?
Schlüsselkonzepte umfassen die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT), Empowerment, Angehörigenarbeit, Identitätsdiffusion, Impulsivität, Selbstverletzung, Komorbidität und das Kommunikationsmodell SET. Die Persönlichkeitsstruktur nach Kernberg und der Einfluss von "primitiven Abwehrmechanismen" werden ebenfalls detailliert beleuchtet.
Wer ist die Zielgruppe dieses Dokuments?
Die Zielgruppe umfasst alle, die ein umfassendes Verständnis der Borderline-Persönlichkeitsstörung erlangen möchten, insbesondere Fachkräfte im sozialen und therapeutischen Bereich. Das Dokument vermittelt Wissen und Handlungskompetenzen für den Umgang mit Betroffenen und deren Angehörigen.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den Symptomen?
Das Kapitel "Verhaltensweisen und Symptome von Menschen mit einer Borderline-Störung" beschreibt die konkreten Verhaltensweisen und Symptome im Detail, basierend auf den Kriterien des DSM-IV. Es beleuchtet die komplexen Zusammenhänge der oft unberechenbaren und impulsiven Verhaltensmuster.
Wie wird der Empowerment-Ansatz beschrieben?
Der Empowerment-Ansatz wird im Kontext der Sozialarbeit erläutert. Das Dokument thematisiert "erlernte Hilflosigkeit" und das Konzept der Salutogenese und beschreibt die professionelle Haltung sowie Strategien im Empowerment-Ansatz.
Was ist die Bedeutung der Angehörigenarbeit?
Die Angehörigenarbeit wird als wichtiger Bestandteil der Unterstützung von Betroffenen mit Borderline-Störung betrachtet. Das Dokument gibt Hinweise, wie Angehörige die Welt der Borderline-Persönlichkeit verstehen, mit den Auswirkungen des Borderlines-Verhaltens umgehen, Verantwortung übernehmen, Grenzen setzen und Hilfe in Anspruch nehmen können.
- Quote paper
- Andrea Sieber (Author), 2004, Borderline-Störung. Verhaltensmuster und sozialarbeiterische Interventionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131824