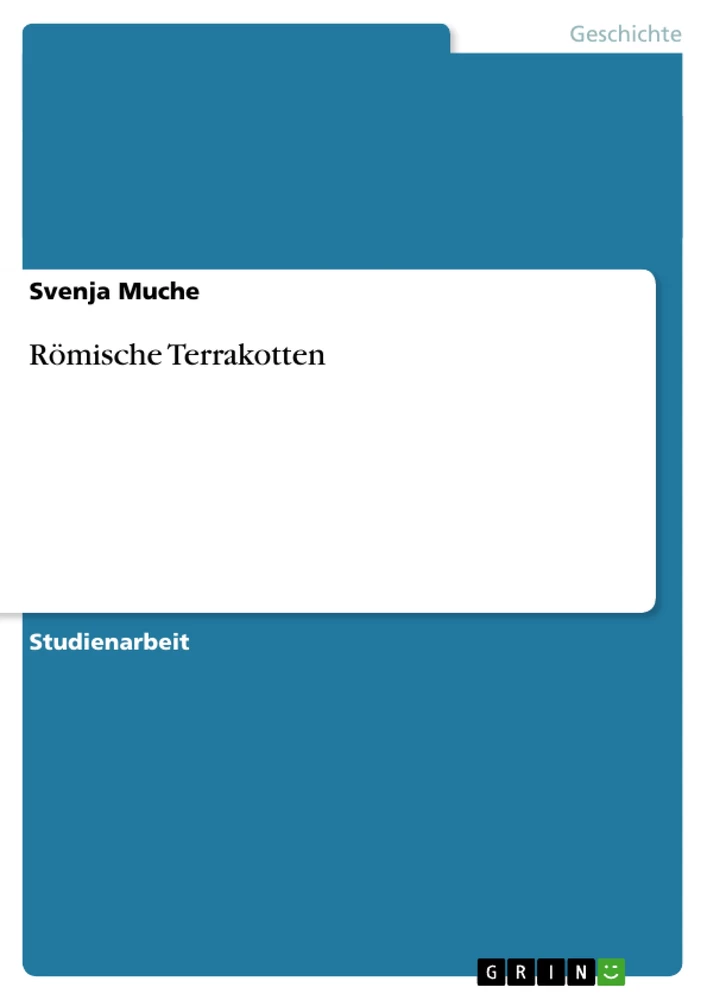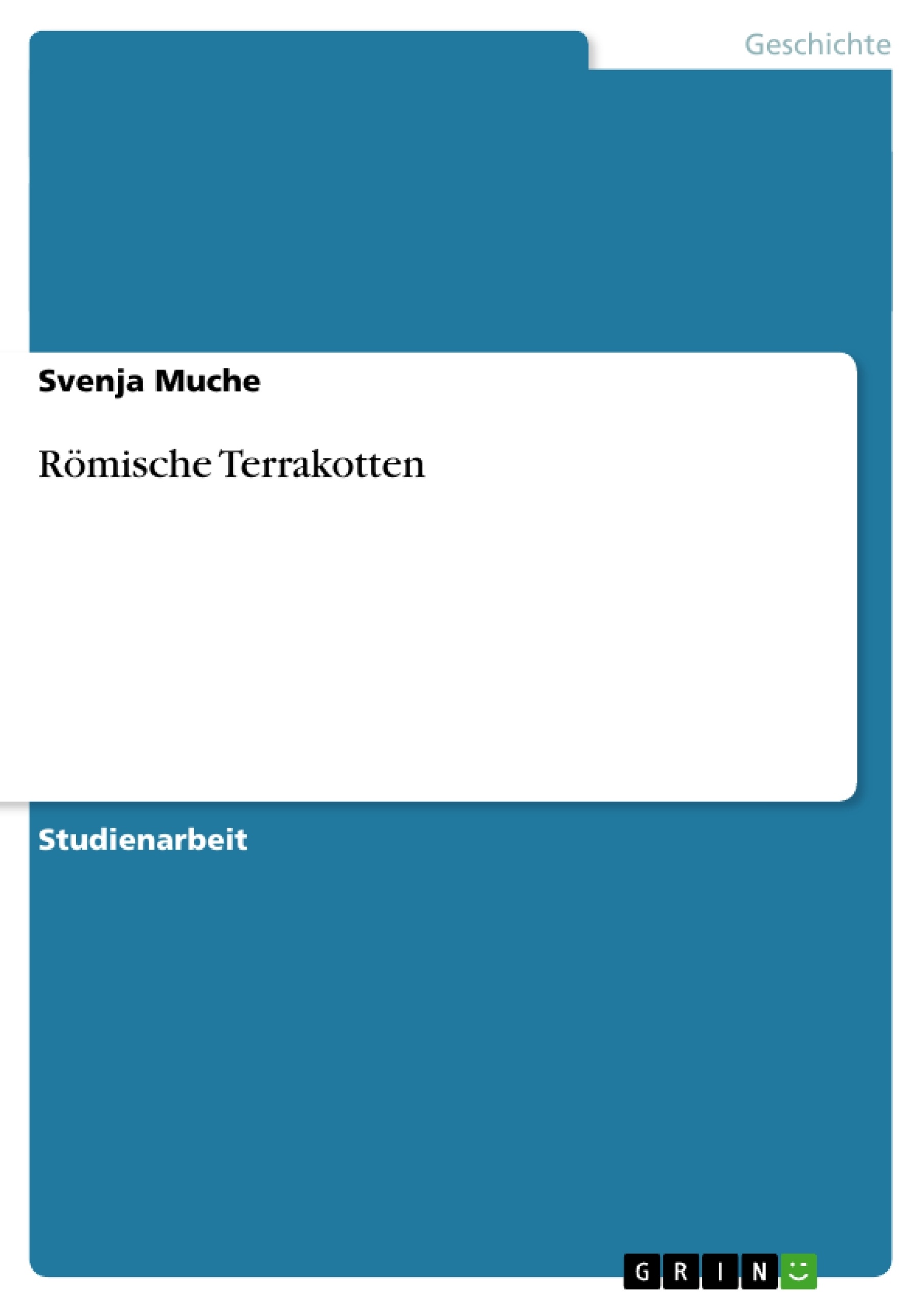Bereits für das vorgeschichtliche Mitteleuropa sind Tonfiguren nachweisbar. Zu nennen seien hier
unter anderem die recht zahlreich vorkommenden, handgeformten Vogelfiguren der Urnenfelderund
Hallstadtzeit.
Für das mittlere Rheingebiet belegen eine Reihe handgeformter kugeliger Rasseln aus der 1. Hälfte
des 1. Jahrhunderts nach Christus, sowie eine nur fragmentarisch erhaltene Tierfigur eine
kontinuierliche Fabrikation zumindest handgeformter Figuren und Rasseln von in erster Linie
Vögeln von der Urnenfelderzeit bis in römische Zeit. Für die Provinzen Raetien und Noricum
mangelt es bisher an Belegen aus der Laténezeit um eine derartige Kontinuität auch für diese
Gebiete statuieren zu können.1
Diese vorrömischen Terrakotten unterscheiden sich jedoch sowohl in Technik, als auch im Stil stark
von jenen der Römerzeit. Der Stil ist stark stilisiert und an geometrischen Schemata orientiert.
Damit steht er in einem deutlichen Kontrast zu den um Realismus bemühten Darstellungen
römischer Plastik. Dies zeigt sich auch in zahlreichen Pferdefiguren aus der Hallstadtzeit, wie z. B.
jener aus einem Grabhügel bei Zainingen in Baden-Württemberg.2 Hals und Kopf des Pferdes
könnten isoliert gesehen auch als einer Vogelfigur zugehörig betrachtet werden. Nur in Verbindung
mit dem Körper ist das dargestellte Tier zu identifizieren. Gleiches gilt für die wenigen bekannten
anthropomorphen Figuren, wie zum Beispiel jene stark stilisierten, als Schalenaufsätze genutzten
Statuetten aus der hallstadtzeitlichen Nekropole von Fischbach-Schirndorf in der Oberpfalz.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Technik und Bemalung
- 2.1. Drehscheiben-Ware
- 2.2. Handgeformte Ware
- 2.3. Modelware
- 2.4. Bemalung
- 3. Typen
- 3.1. Götter
- 3.2. Büsten
- 3.3. Darstellungen von Menschen
- 3.4. Reiterfiguren
- 3.5. Tiere
- 3.6. Früchte
- 4. Werkstätten
- 4.1. Kölner Werkstattgruppe
- 5. Verwendung und Bedeutung
- Liste abgekürzt zitierter Literatur
- Abbildungsnachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit römischen Terrakotten, insbesondere in den Provinzen Raetien und Noricum. Sie untersucht die Herstellungstechnik, die verschiedenen Typen und die Verwendung dieser Figuren im römischen Kontext. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Terrakottenproduktion von der vorrömischen Zeit bis in die römische Kaiserzeit und analysiert den Einfluss römischer Kultur auf die einheimische Bevölkerung.
- Herstellungstechnik von römischen Terrakotten
- Typologie und Stil der Terrakotten
- Verwendung und Bedeutung von Terrakotten in der römischen Gesellschaft
- Einfluss römischer Kultur auf die einheimische Bevölkerung
- Regionale Unterschiede in der Terrakottenproduktion
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Einführung in das Thema der römischen Terrakotten und stellt die Entwicklung der Terrakottenproduktion von der vorrömischen Zeit bis in die römische Kaiserzeit dar. Es wird auf die Unterschiede zwischen vorrömischen und römischen Terrakotten eingegangen und die Bedeutung der römischen Terrakotten als Träger von Kulturinhalten hervorgehoben.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Technik und Bemalung von römischen Terrakotten. Es werden die verschiedenen Herstellungsverfahren, wie Drehscheiben-Ware, Handgeformte Ware und Modelware, detailliert beschrieben. Die Kapitel beleuchtet die regionalen und zeitlichen Unterschiede in der Herstellungstechnik und geht auf die Bedeutung der Modelware für die Massenproduktion von Terrakotten ein.
Das dritte Kapitel behandelt die verschiedenen Typen von römischen Terrakotten. Es werden die wichtigsten Kategorien, wie Götter, Büsten, Darstellungen von Menschen, Reiterfiguren, Tiere und Früchte, vorgestellt und anhand von Beispielen erläutert. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Terrakotten als Ausdruck der römischen Religion, Mythologie und Kultur.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Werkstätten, in denen römische Terrakotten hergestellt wurden. Es wird die Kölner Werkstattgruppe als Beispiel für eine bedeutende Produktionsstätte vorgestellt und die Bedeutung der Werkstätten für die Verbreitung von Terrakotten in den römischen Provinzen hervorgehoben.
Das fünfte Kapitel behandelt die Verwendung und Bedeutung von römischen Terrakotten in der römischen Gesellschaft. Es wird auf die verschiedenen Funktionen der Terrakotten als Kultgegenstände, Spielzeug, Dekorationselemente und Grabbeigaben eingegangen. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Terrakotten als Ausdruck der römischen Kultur und Lebensweise.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen römische Terrakotten, Herstellungstechnik, Typologie, Verwendung, Bedeutung, Raetien, Noricum, römische Kultur, einheimische Bevölkerung, Werkstätten, Kölner Werkstattgruppe, Kultgegenstände, Spielzeug, Dekorationselemente, Grabbeigaben.
Häufig gestellte Fragen
Was sind römische Terrakotten?
Dabei handelt es sich um aus Ton gebrannte Figuren, Büsten oder Reliefs, die in römischer Zeit weit verbreitet waren und als Kultgegenstände, Spielzeug oder Grabbeigaben dienten.
Welche Herstellungstechniken wurden für Terrakotten genutzt?
Es gab handgeformte Ware, auf der Drehscheibe hergestellte Stücke und die massenhaft produzierte Modelware, bei der der Ton in Formen gepresst wurde.
Welche Motive sind typisch für römische Tonfiguren?
Häufige Typen sind Götterdarstellungen, Büsten, Menschen, Reiterfiguren, Tiere und Früchte.
Wie unterscheiden sich römische von vorrömischen Terrakotten?
Vorrömische Figuren sind oft stark stilisiert und geometrisch, während römische Terrakotten einen deutlichen Realismus in der Darstellung anstreben.
Was war die Kölner Werkstattgruppe?
Eine bedeutende Produktionsstätte für Terrakotten, die maßgeblich zur Verbreitung dieser Figuren in den römischen Provinzen wie Raetien und Noricum beitrug.
Wofür wurden Terrakotten im Alltag verwendet?
Sie fanden Verwendung als religiöse Kultgegenstände im privaten Bereich, als Dekoration, Kinderspielzeug oder als Beigaben in Gräbern.
- Quote paper
- Svenja Muche (Author), 2008, Römische Terrakotten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131841