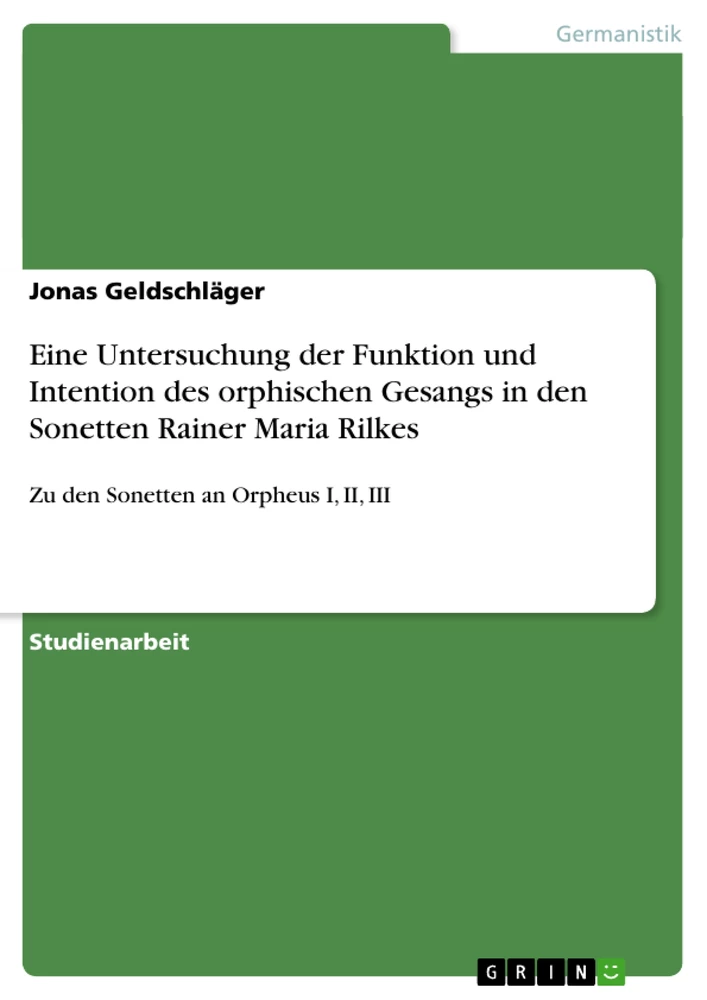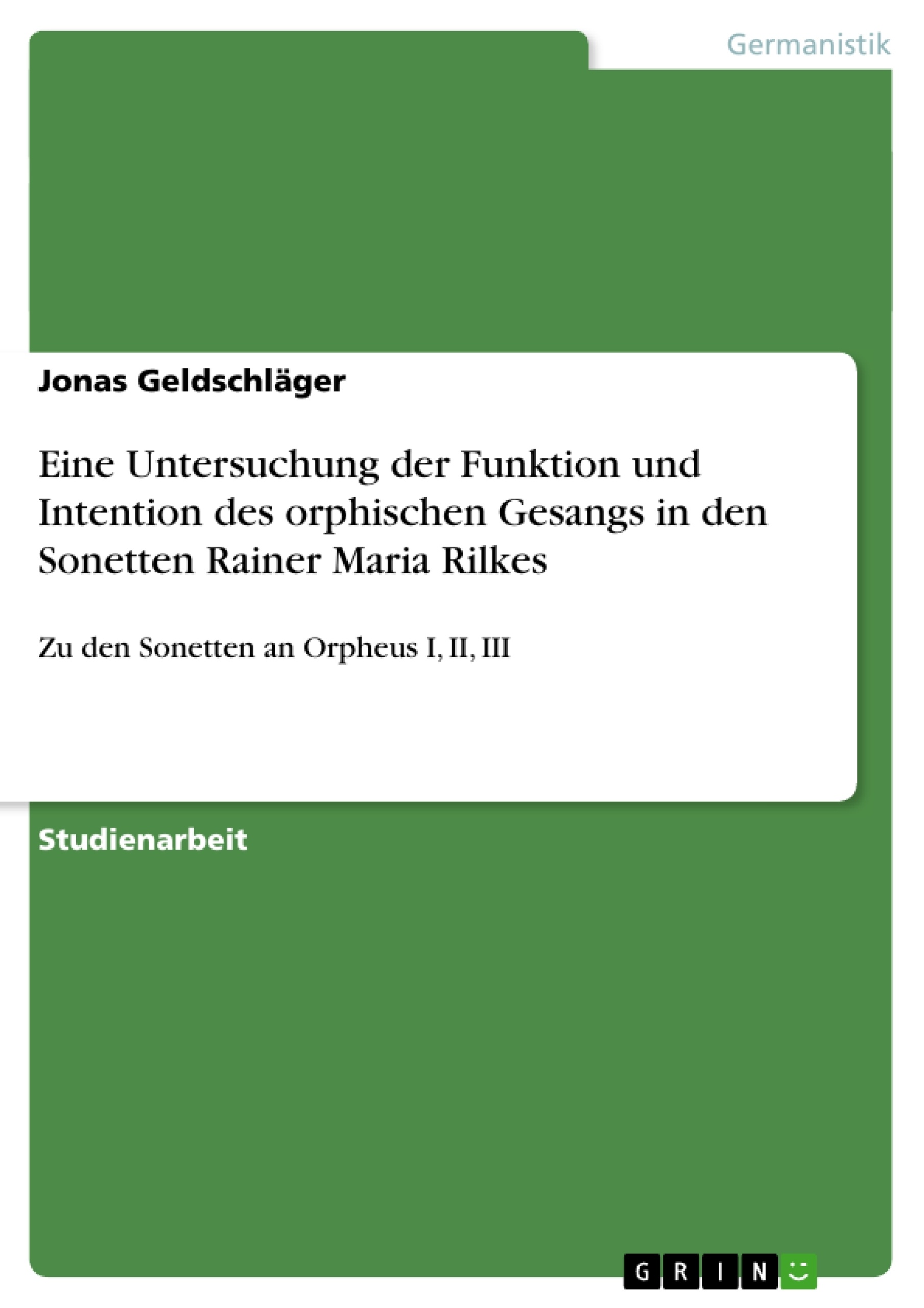Der Orpheusmythos, wie er von Ovid vorgestellt wird, erfuhr in den Jahren seiner Rezeption eine facettenreiche Wandlung; so wurde der singende Leierspieler, der versucht, Eurydike aus den Fängen der Unterwelt zu befreien, doch scheitern musste, zum Sinnbild eines christlichen Heilands, zum Topos des Gesangs und zur mystifizierten Sagengestalt.
Doch lässt sich das ganze Spektrum, das den sagenumwobenen Orpheus fasst, in einige mögliche Mytheme, die in ihren Variationen immer wieder auftauchen, unterteilen: Orpheus liebt Eurydike, Eurydikes Tod und Orpheus' Trauer, Erfolgreicher Gang in den Hades durch den Gesang, Scheitern des Gangs in den Hades trotz Gesang, der einsame Orpheus (schafft Harmonie in der Natur durch Gesang), der einsame Orpheus (wird zum Opfer, wenn er auch singt), der tote Orpheus (sein Haupt singt jedoch weiter) und der tote Orpheus, welcher auf Apolls Hilfe angewiesen ist, um den Naturgewalten zu trotzen.
Auffällig scheint in dieser Mythemenverkettung, dass ein Merkmal omnipräsent bleibt und sich durch alle Leitthemen zieht: der orphische Gesang. Dieser Gesang ist es also, der den Orpheus, wie er überliefert wird, ausmacht, Orpheus ist Sänger und Dichter zugleich; sein Gesang erfährt eine Wirkung, die die Umwelt in ihren Grundfesten erschüttern lässt und sie ganz in seinen Bann zieht. Die Umschreibungen des Gesangs sind in der Lyrik vielfältig, doch soll in der vorliegenden Arbeit auf die Bedeutungsebenen in den Sonetten an Orpheus von Rainer Maria Rilke Bezug genommen werden.
Es soll untersucht werden, inwiefern der Gesang Gegenstand der ersten drei Sonette des ersten Teils ist und was für eine Bedeutung ihm auf einer syntaktischen, semantischen und assoziativen Ebene zugeschrieben wird. Dieses Vorhaben soll sowohl analytisch als auch interpretatorisch nachvollzogen werden. Weiterhin sollen die Verbindungen, die jedes Sonett in sich fasst, betrachtet werden, um anschließend einen übergreifenden Zusammenhang darzustellen. Den Abschluss der Untersuchung soll der Versuch bilden, die These, dass es innerhalb der ausgewählten Sonette eine Wandlung vom Leben zum Göttlichen gibt, die allein durch den orphischen Gesang geschaffen wird, den die Gedichte scheinbar selbst bilden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Die Sonette an Orpheus
- 1.2. Bemerkungen zum Paratext
- 2. Die Bedeutung der Sonette für den orphischen Gesang
- 2.1. Das erste Sonett
- 2.2. Das zweite Sonett
- 2.3. Das dritte Sonett
- 3. Die drei Sonette im Vergleich - Wie der Gesang eine Omnipräsenz erfährt
- 3.1. Der Baum des Lebens
- 3.2. Das Göttliche des Gesangs
- 3.3 Die Verbindung von Dasein und Gesang durch das Göttliche
- 3.4. Die Verwandlung des Daseins zum Göttlichen durch den Gesang
- 4. Wie sich die Sonette zum orphischen Gesang selbst erklären
- 5. Schlussbemerkung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Funktion und Intention des orphischen Gesangs in den ersten drei Sonetten aus Rainer Maria Rilkes Gedichtzyklus „Sonette an Orpheus“. Durch eine analytische und interpretatorische Herangehensweise wird die Bedeutung des Gesangs auf syntaktischer, semantischer und assoziativer Ebene beleuchtet. Ziel ist es, die Verbindungen zwischen den einzelnen Sonetten zu betrachten und einen übergreifenden Zusammenhang zu präsentieren. Dabei soll die These untersucht werden, dass die Sonette eine Wandlung vom Leben zum Göttlichen darstellen, die durch den orphischen Gesang initiiert wird.
- Die Rolle des orphischen Gesangs in den ersten drei Sonetten von Rilkes „Sonette an Orpheus“
- Analyse der syntaktischen, semantischen und assoziativen Bedeutung des Gesangs
- Verbindungen zwischen den Sonetten und die Darstellung eines übergreifenden Zusammenhangs
- Untersuchung der These, dass die Sonette eine Wandlung vom Leben zum Göttlichen durch den Gesang vermitteln
- Die Bedeutung des Paratexts für die Interpretation der Sonette
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung, die die Sonette an Orpheus und ihre Bedeutung für den Orpheusmythos beleuchtet. Es werden die verschiedenen Mytheme des Orpheusmythos vorgestellt und der orphische Gesang als zentrales Element herausgestellt. Kapitel Zwei untersucht die Bedeutung der Sonette für den orphischen Gesang. Es werden die ersten drei Sonette im Detail analysiert, wobei die Bedeutung des Gesangs auf verschiedenen Ebenen betrachtet wird. Kapitel Drei vergleicht die ersten drei Sonette und zeigt, wie der Gesang eine omnipräsente Kraft darstellt, die Leben und Dasein verwandelt. Kapitel Vier betrachtet die Sonette als eine selbstständige Erklärung des orphischen Gesangs.
Schlüsselwörter
Orpheusmythos, Sonette an Orpheus, orphischer Gesang, Wandlung, Göttlichkeit, Leben, Dasein, syntaktische Analyse, semantische Analyse, assoziative Analyse, Paratext, Mytheme, Übersteigung, Baum des Lebens.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale These der Untersuchung zu Rilkes Sonetten?
Die These besagt, dass innerhalb der ersten drei Sonette eine Wandlung vom irdischen Leben zum Göttlichen stattfindet, die allein durch den orphischen Gesang bewirkt wird.
Welche Bedeutung hat der Orpheusmythos für Rilke?
Orpheus dient Rilke als Sinnbild des vollendeten Dichters und Sängers, der durch seine Kunst die Grenzen zwischen Leben und Tod, Mensch und Gott überwindet.
Was wird im ersten Sonett thematisiert?
Es beschreibt das Entstehen eines "Baumes im Ohr", ein Symbol für die raumgreifende und verwandelnde Kraft des Gesangs in der Natur.
Wie unterscheiden sich die ersten drei Sonette in ihrer Aussage?
Sie zeigen eine Steigerung: vom Wirken des Gesangs in der Natur über die Verinnerlichung bis hin zur Definition des Gesangs als "Dasein" und göttliche Instanz.
Was bedeutet "Gesang ist Dasein" bei Rilke?
Es ist der Ausdruck einer Existenzform, die nicht zweckgebunden ist, sondern im reinen Klingen und Sein aufgeht, jenseits menschlichen Begehrens.
Welche Rolle spielt die Sprache (Syntax/Semantik) in der Analyse?
Die Arbeit analysiert, wie Rilke durch spezifische Wortwahl und Satzbau die Omnipräsenz und die mystische Wirkung des orphischen Prinzips sprachlich konstruiert.
- Quote paper
- Jonas Geldschläger (Author), 2009, Eine Untersuchung der Funktion und Intention des orphischen Gesangs in den Sonetten Rainer Maria Rilkes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131905