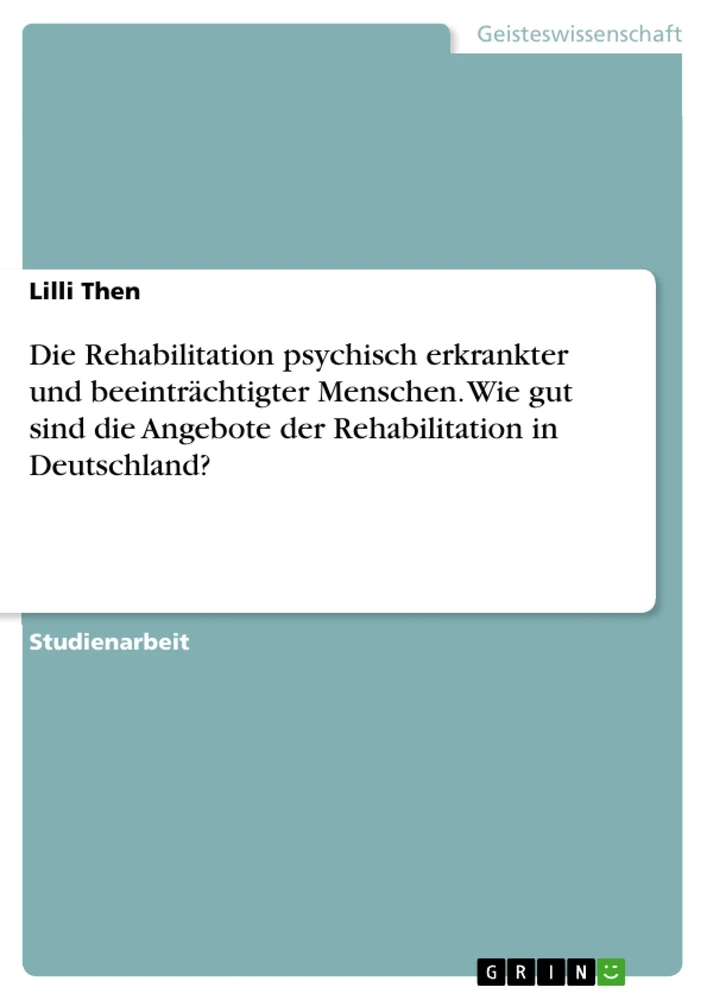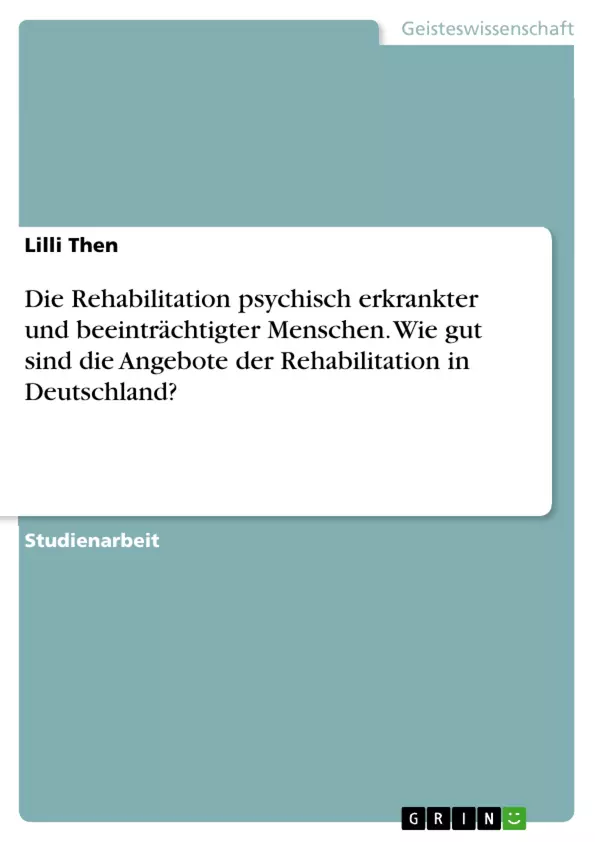Allein in Deutschland sind jedes Jahr 27,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Gegenstand dieser Hausarbeit ist deshalb der Ablauf der üblichen Rehabilitationsprogramme für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Beeinträchtigungen, welche Angebote es gibt und welche Perspektiven nach einem solchen Programm für die Menschen vorhanden sind. Es wird die Frage beantwortet, wie gut die Angebote der Rehabilitation in Deutschland sind und ob etwas verbessert werden müsste.
Das Ziel dieser Hausarbeit ist es, den Ablauf der Rehabilitation in Deutschland zu präsentieren und zu diskutieren, außerdem werden Perspektiven erläutert. Dies wird durch die Vorstellung der Voraussetzungen, des Ablaufes sowie der Nachbetreuung im Rehabilitationsverfahren erreicht. Zunächst werden einige Begrifflichkeiten geklärt. Danach werden die Voraussetzungen, der Ablauf und einige weitere Aspekte einer Rehabilitation speziell für psychisch kranke und beeinträchtigte Menschen aufgezeigt. Um das Thema auszubauen, werden die Perspektiven der Menschen nach den Rehabilitationsprogrammen aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesetzliche Grundlagen und Begriffsklärung
- Rehabilitation
- Gesetzliche Grundlagen
- Wer ist Rehabilitationsbedürftig und Rehabilitationsfähigkeit
- Menschen mit Psychischen Erkrankungen
- Warum werden Menschen Psychisch krank?
- Verschiedene Psychische Erkrankungen
- Rehabilitation Psychisch Kranker Menschen
- Wie kommt es zu einer Rehabilitation
- Maßnahmen der Rehabilitation
- Medizinische Rehabilitation
- Berufliche Rehabilitation – Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben
- Soziale Rehabilitation – Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- Geriatrische Rehabilitation
- Möglichkeiten und Perspektiven nach Rehabilitation und Psychischer Erkrankung
- Möglichkeiten nach der Medizinischen Rehabilitation
- Möglichkeiten nach einer Beruflichen Rehabilitation in einer Werkstatt für behinderte Menschen
- Perspektiven bei einer Psychischen Erkrankung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Ablauf von Rehabilitationsprogrammen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Beeinträchtigungen in Deutschland. Sie beleuchtet die Angebote, die zur Verfügung stehen, und die Perspektiven, die nach einer Rehabilitation bestehen. Die Arbeit analysiert die Effektivität der Rehabilitationsprogramme und untersucht, ob Verbesserungsbedarf besteht.
- Gesetzliche Grundlagen und Definitionen der Rehabilitation
- Ursachen und Auswirkungen psychischer Erkrankungen im Kontext von Arbeit und Rehabilitation
- Ablauf von Rehabilitationsprogrammen für psychisch erkrankte Menschen
- Möglichkeiten der Teilhabe nach der Rehabilitation
- Perspektiven für psychisch erkrankte Menschen nach dem Rehabilitationsverfahren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Gegenstand der Hausarbeit vor und erläutert die Zielsetzung. Sie beleuchtet die hohe Prävalenz psychischer Erkrankungen in Deutschland und die Bedeutung der Rehabilitation für die betroffenen Menschen.
Das zweite Kapitel widmet sich den gesetzlichen Grundlagen und der Begriffsklärung im Kontext von Rehabilitation. Es beleuchtet das Grundgesetz und das Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) sowie die Definitionen von Rehabilitation, Rehabilitationsbedürftigkeit und Rehabilitationsfähigkeit.
Im dritten Kapitel werden verschiedene Aspekte der Rehabilitation psychisch erkrankter Menschen betrachtet. Es geht um die Voraussetzungen für einen Rehabilitationsprozess, die verschiedenen Maßnahmen der Rehabilitation, wie z. B. medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation, sowie die Rolle der geriatrischen Rehabilitation.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Möglichkeiten und Perspektiven nach Rehabilitation und psychischer Erkrankung. Es beleuchtet die Möglichkeiten der beruflichen und sozialen Teilhabe sowie die Herausforderungen, denen sich psychisch erkrankte Menschen nach der Rehabilitation stellen müssen.
Schlüsselwörter
Psychische Erkrankungen, Rehabilitation, Teilhabe am Arbeitsleben, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, SGB IX, Rehabilitationsprogramme, Perspektiven, Werkstätten für behinderte Menschen, Medizinische Rehabilitation, Berufliche Rehabilitation, Soziale Rehabilitation, Geriatrische Rehabilitation.
- Citar trabajo
- Lilli Then (Autor), Die Rehabilitation psychisch erkrankter und beeinträchtigter Menschen. Wie gut sind die Angebote der Rehabilitation in Deutschland?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1319529