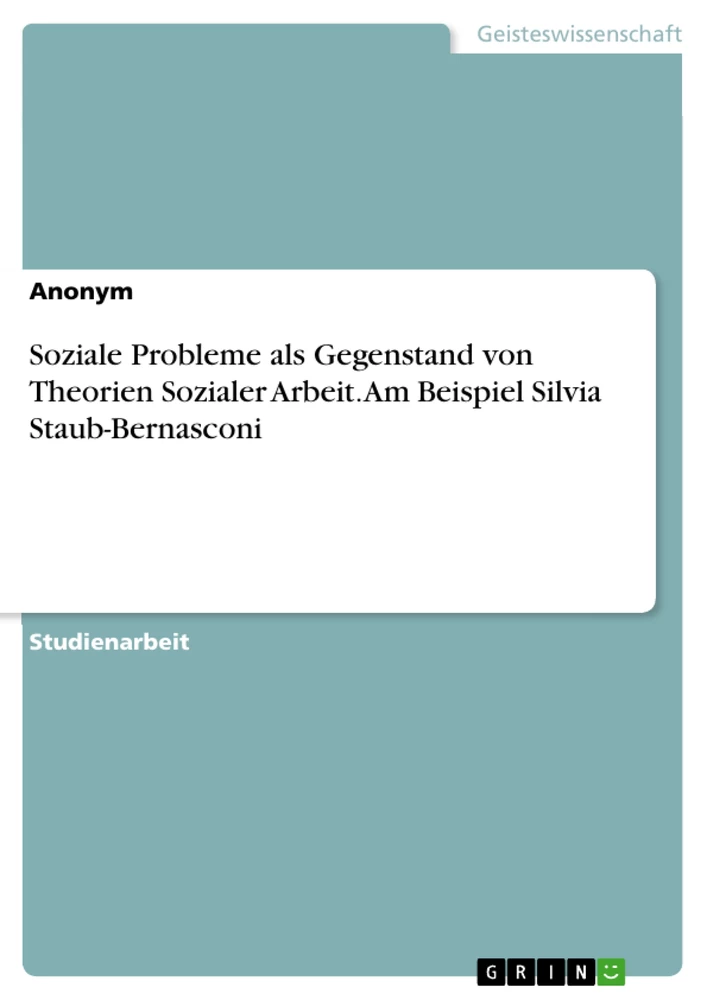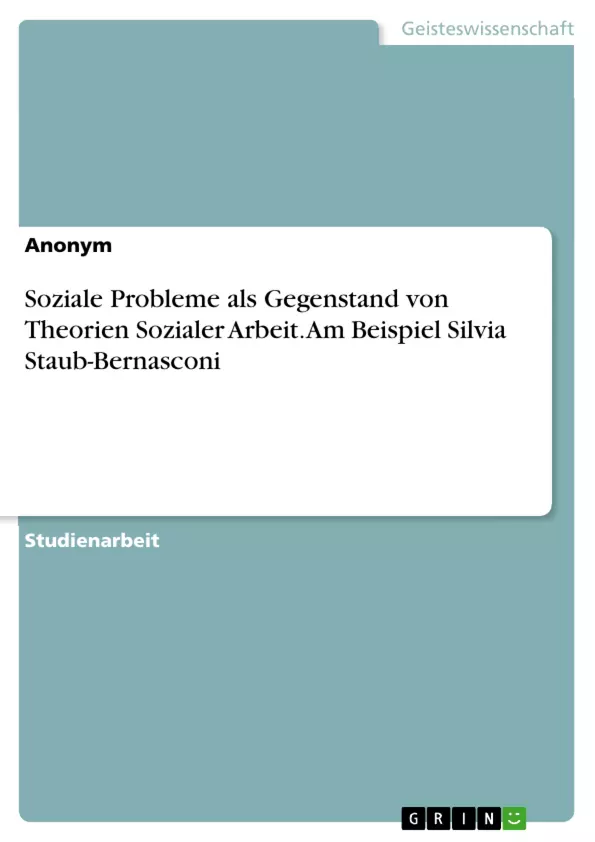Soziale Probleme sind zentraler Bestandteil Sozialer Arbeit, so bemühen sich Sozialarbeiter in ihrer täglichen Arbeit, diese zu verstehen, erklären und zu lösen. Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Leben und Schaffen von Silvia Staub-Bernasconi besonders im Fokus steht hierbei ihr Verständnis Sozialer Probleme.
Staub-Bernasconi sagt, dass interessanterweise immer wieder versucht wird einer Theorie Sozialer Probleme ihre Relevanz abzusprechen und es nicht möglich gemacht wird einen Beitrag zur human- und sozialwissenschaftlichen Theoriebildung zu leisten. Dabei ist natürlich klar, dass nur ein soziales Problem nicht ausreicht um eine vollständige Gesellschaftstheorie zu begründen. Mit einem Verweis an berühmte Theoretiker, wie Karl Marx, Emil Durkheim und Jane Addams wird aber deutlich, dass Soziale Probleme schon seit langem Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschungen und Theorien sind. Somit ist klar, das Soziale Probleme gewichtigen Anteil in Theorien Sozialer Arbeit nehmen sollten.
Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an arbeiten Frauen daran die Notstände, welche durch die Massenarmut des Frühkapitalismus kamen, zu beheben. Sie machten darauf aufmerksam, wie vom Staat und diversen Strukturen, wie der Kirche beispielsweise, mit Sozialen Problemen umgegangen wurde. Darüber hinaus protestierten sie und machten sich stark für ihre Rechte, welche ihnen verwehrt wurden, da sie nicht wählen und auch nicht an Universitäten studieren durften. Herausragende Frauen dieser Bewegung waren beispielsweise Jane Addams in den USA, Ellen Starr in England und Alice Salomon in Berlin. Mit ihnen reiht sich Silvia Staub-Bernasconi ein, welche in der Schweiz und Deutschland aktiv ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Silvia Staub-Bernasconi
- 1.1 Biografie
- 2. Staub-Bernasconis Verständnis sozialer Probleme
- 2.1 Ausstattungsprobleme
- 2.2 Austauschprobleme
- 2.3 Machtproblematik
- 2.4 Kriterien- und Werteproblematik
- 3. Das systemtheoretische Paradigma
- 3.1 Individuum und Gesellschaft
- 4. Handlungsmodell
- 4.1 Die Wissensdimensionen
- 4.2 Ziele Sozialer Arbeit
- 5. Professionalisierung Sozialer Arbeit
- 5.1 Der Transformative Dreischritt
- 5.2 Das Tripel Mandat
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Verständnis sozialer Probleme nach Silvia Staub-Bernasconi und ihren Einfluss auf die Theorie der Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet Staub-Bernasconis Biografie, ihre zentralen theoretischen Konzepte und deren Anwendung in der Praxis. Die Arbeit analysiert ihr systemtheoretisches Paradigma und das daraus abgeleitete Handlungsmodell.
- Staub-Bernasconis Biografie und ihre Bedeutung für die Soziale Arbeit
- Staub-Bernasconis Kategorisierung sozialer Probleme (Ausstattungs-, Austausch-, Macht- und Werteproblematik)
- Das systemtheoretische Paradigma und das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft
- Staub-Bernasconis Handlungsmodell und die Ziele Sozialer Arbeit
- Die Professionalisierung der Sozialen Arbeit nach Staub-Bernasconi (Transformativer Dreischritt und Tripelmandat)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sozialen Probleme in der Sozialen Arbeit ein und benennt Silvia Staub-Bernasconi als zentrale Figur für das Verständnis dieser Probleme. Sie unterstreicht die Relevanz von Sozialen Problemen für sozialwissenschaftliche Theorien und hebt Staub-Bernasconis Beitrag zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit hervor. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Hausarbeit und erläutert die Auswahl Staub-Bernasconis als Thema.
1. Silvia Staub-Bernasconi: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über das Leben und Wirken von Silvia Staub-Bernasconi. Es betont ihre Praxisnähe, ihre theoretischen Beiträge und die hohe Anerkennung, die sie in der Sozialen Arbeit genießt. Ihr Engagement für Menschenrechte und die Weiterentwicklung der Sozialen Arbeit als Disziplin wird hervorgehoben.
1.1 Biografie: Dieser Abschnitt präsentiert eine chronologische Zusammenfassung von Staub-Bernasconis Lebenslauf, beginnend mit ihrer Geburt und Ausbildung bis hin zu ihren akademischen und praktischen Tätigkeiten. Es werden wichtige Stationen ihrer Karriere und ihr Engagement in verschiedenen Bereichen der Sozialen Arbeit detailliert beschrieben, um ihren vielseitigen Einfluss zu verdeutlichen.
2. Staub-Bernasconis Verständnis sozialer Probleme: Dieses Kapitel analysiert Staub-Bernasconis Verständnis von sozialen Problemen. Es stellt ihre Einteilung in vier Problemkategorien (Ausstattungs-, Austausch-, Macht- und Werteproblematik) vor und erläutert die jeweiligen Charakteristika. Die Kapitel veranschaulicht die Komplexität sozialer Probleme und ihre vielschichtigen Ursachen.
3. Das systemtheoretische Paradigma: Dieses Kapitel beleuchtet Staub-Bernasconis Anwendung des systemtheoretischen Paradigmas in der Sozialen Arbeit. Es untersucht das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft innerhalb dieses Paradigmas und wie dies das Verständnis sozialer Probleme beeinflusst. Die Kapitel veranschaulicht die systemischen Zusammenhänge und Interdependenzen bei der Betrachtung sozialer Probleme.
4. Handlungsmodell: Dieses Kapitel beschreibt Staub-Bernasconis Handlungsmodell, das auf dem Systemismus Mario Bunges basiert. Es erläutert die Wissensdimensionen und die Ziele Sozialer Arbeit im Kontext dieses Modells. Die Kapitel zeigt auf, wie das Handlungsmodell als praxisorientierte Grundlage für die Intervention in sozialen Problemen dient.
5. Professionalisierung Sozialer Arbeit: Dieses Kapitel befasst sich mit Staub-Bernasconis Beitrag zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit. Es analysiert den "transformativen Dreischritt" und das "Tripelmandat" als zentrale Konzepte für die Entwicklung der Sozialen Arbeit als eigenständige Disziplin. Die Kapitel veranschaulicht die Bedeutung von professionellem Handeln und ethischen Standards in der Sozialen Arbeit.
Schlüsselwörter
Silvia Staub-Bernasconi, Soziale Probleme, Soziale Arbeit, Systemtheorie, Handlungsmodell, Professionalisierung, Menschenrechte, Ausstattungsprobleme, Austauschprobleme, Machtproblematik, Werteproblematik, Transformativer Dreischritt, Tripelmandat.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit über Silvia Staub-Bernasconi
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das Verständnis sozialer Probleme nach Silvia Staub-Bernasconi und ihren Einfluss auf die Theorie der Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet Staub-Bernasconis Biografie, zentrale theoretische Konzepte und deren praktische Anwendung. Schwerpunkte sind ihr systemtheoretisches Paradigma und das daraus abgeleitete Handlungsmodell.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Staub-Bernasconis Biografie und ihre Bedeutung für die Soziale Arbeit; ihre Kategorisierung sozialer Probleme (Ausstattungs-, Austausch-, Macht- und Werteproblematik); das systemtheoretische Paradigma und das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft; Staub-Bernasconis Handlungsmodell und die Ziele Sozialer Arbeit; sowie die Professionalisierung der Sozialen Arbeit nach Staub-Bernasconi (Transformativer Dreischritt und Tripelmandat).
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu Silvia Staub-Bernasconi (inkl. Biografie), ein Kapitel zu ihrem Verständnis sozialer Probleme, ein Kapitel zum systemtheoretischen Paradigma, ein Kapitel zum Handlungsmodell, ein Kapitel zur Professionalisierung Sozialer Arbeit, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgelistet.
Was sind Staub-Bernasconis zentrale Konzepte zum Verständnis sozialer Probleme?
Staub-Bernasconi kategorisiert soziale Probleme in vier Bereiche: Ausstattungsprobleme, Austauschprobleme, Machtproblematik und Werteproblematik. Diese Kategorisierung verdeutlicht die Komplexität und die vielschichtigen Ursachen sozialer Probleme.
Welche Rolle spielt die Systemtheorie in Staub-Bernasconis Ansatz?
Staub-Bernasconi verwendet ein systemtheoretisches Paradigma, um das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft zu analysieren und soziale Probleme zu verstehen. Dieses Paradigma betont die Interdependenzen und systemischen Zusammenhänge.
Was ist Staub-Bernasconis Handlungsmodell und wie funktioniert es?
Das Handlungsmodell basiert auf dem Systemismus Mario Bunges. Es beschreibt die Wissensdimensionen und Ziele Sozialer Arbeit. Es dient als praxisorientierte Grundlage für Interventionen in sozialen Problemen.
Wie trägt Staub-Bernasconi zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit bei?
Staub-Bernasconi leistet einen wichtigen Beitrag zur Professionalisierung durch den "transformativen Dreischritt" und das "Tripelmandat". Diese Konzepte betonen professionelles Handeln und ethische Standards in der Sozialen Arbeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Silvia Staub-Bernasconi, Soziale Probleme, Soziale Arbeit, Systemtheorie, Handlungsmodell, Professionalisierung, Menschenrechte, Ausstattungsprobleme, Austauschprobleme, Machtproblematik, Werteproblematik, Transformativer Dreischritt, Tripelmandat.
Wo finde ich mehr Informationen über Silvia Staub-Bernasconi?
Das Literaturverzeichnis der Hausarbeit enthält weiterführende Quellen und Literatur zu Silvia Staub-Bernasconi und ihren Arbeiten.
Für wen ist diese Hausarbeit gedacht?
Diese Hausarbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen in der Sozialen Arbeit.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Soziale Probleme als Gegenstand von Theorien Sozialer Arbeit. Am Beispiel Silvia Staub-Bernasconi, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1320309