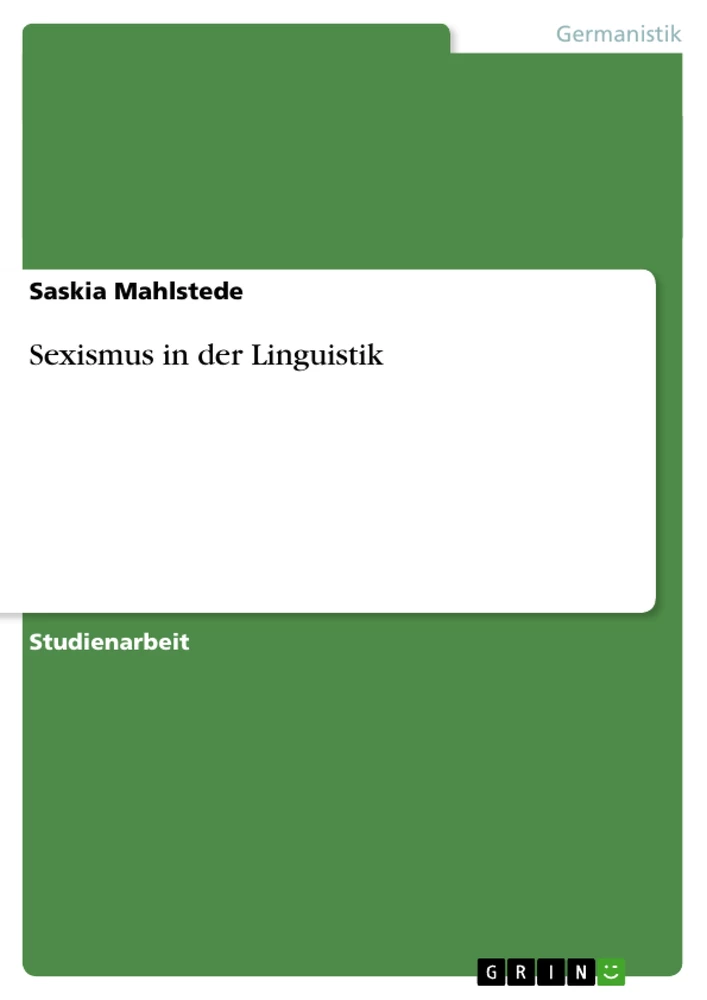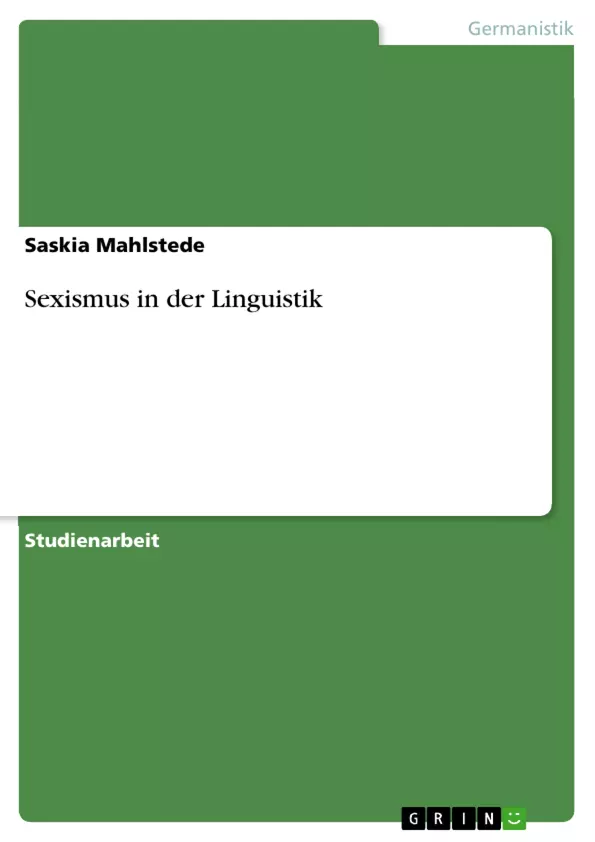Vor mehr als zwanzig Jahren entstand ein neues Forschungsgebiet innerhalb der Sprachwissenschaft:
Die feministische Linguistik. Sie versteht sich als Teil einer sozialen Bewegung,
eben der Frauenbewegung, und möchte die Sprache nicht wie die herkömmliche
Linguistik nur beschreiben sondern die Sprachnorm und das Sprachsystem kritisieren.
Feministische Linguistik stellt sich die Frage, wie Frauen bzw. das weibliche Geschlecht
in der Sprache vorkommen, welche Bereiche der Sprache männlich geprägt sind und ob
andere Sprachen auch so sind.
Sie vertritt die Auffassung, dass Frauen durch Sprache systematisch unterdrückt werden
und möchten durch Kritik zur Veränderung dieser Erscheinung beitragen. Feministische
Linguistinnen empfehlen, dass Frauen „in gesprochenen und geschriebenen Texten als eigenständige,
gleichberechtigte und gleichwertige menschliche Wesen behandelt werden.“
1
Für den deutschen Bereich sind als Autorinnen der ersten Generation die Feministinnen
TROEMEL-PLOETZ und PUSCH zu nennen, deren Arbeiten Ende der siebziger und Anfang
der achtziger Jahre erschienen. Sie stützten sich jedoch vielfach auf Titel aus dem
englischsprachigen Raum wie z.B. von LAKOFF (1975), HIATT (1977) und KRAMARAE
(1981).
In meiner Arbeit gehe ich zu erst auf den Zusammenhang zwischen Sprache und Gesellschaft
ein und erläutere die Begriffe „patriarchalische bzw. matriarchalische Sprachen“.
Im dritten Kapitel zeige ich Beispiele für einen sexistischen Sprachgebrauch in verschiedenen
Bereichen auf, u.a. bei den Berufsbezeichnungen, in deutschen Grammatiken und
Wörterbüchern oder in Sprichwörtern.
An dieser Stelle wird jeder/jede, der/die sich mit dieser Problematik bisher noch nicht näher
auseinandergesetzt hat, sicherlich erstaunt sein, wie verbreitet die Diskriminierung
der Frau durch Sprache eigentlich ist und wie verstärkt sie in der deutschen Sprache auftritt.
Im darauffolgenden Kapitel werden diverse Vorschläge wie z.B. von der UNESCO und
Luise F. Pusch zur Vermeidung des sexistischen Sprachgebrauchs vorgestellt. Im fünften
Kapitel wird die feministische Linguistik schließlich kritisch beleuchtet, denn dieser Bereich
der Sprachwissenschaft hat von zumeist männlichen Sprachwissenschaftlern teilweise
negative Reaktionen hervorgerufen, da sie an den Wurzeln der patriarchalischen
Gesellschaft rüttelt und die noch immer schlechte Position der Frau in der Gesellschaft
aufdeckt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Gesellschaft und Sprache
- Hat die Sprache ein Geschlecht? Frauensprache vs Männersprache
- Sexisten Sprachgebrauch
- Personenbezogene Pronomen: man, jedermann, jemand, der..
- Das generische Maskulinum
- Berufsbezeichnungen
- Sprichwörter
- Geschlechtsrollenstereotypen in Grammatiken und Wörterbüchern
- Richtlinien für ein geschlechtergerechtes Deutsch
- UNESCO
- Therapievorschläge von Luise F. Pusch
- Kritik an der feministischen Sprachkritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Entstehung und Entwicklung der feministischen Linguistik, die den Zusammenhang zwischen Sprache und Gesellschaft untersucht und sich für eine geschlechtergerechte Sprache einsetzt. Sie beleuchtet die Diskriminierung von Frauen in Sprache und Gesellschaft sowie die Auswirkungen auf die sprachliche Gleichstellung.
- Sexismus in der Sprache: Die Arbeit analysiert verschiedene Formen des sexistischen Sprachgebrauchs und untersucht, wie Sprache zur Unterdrückung von Frauen beiträgt.
- Geschlechterrollenstereotypen: Die Arbeit beleuchtet, wie Sprache Geschlechterrollen und Stereotypen widerspiegelt und wie diese auf die sprachliche Repräsentation von Frauen und Männern wirken.
- Feministische Sprachkritik: Die Arbeit untersucht die Kritik an der feministischen Linguistik und analysiert die Argumente für und gegen eine Veränderung der Sprachnorm.
- Geschlechtergerechte Sprache: Die Arbeit stellt verschiedene Ansätze und Vorschläge für einen geschlechtergerechten Sprachgebrauch vor.
- Frauensprache vs. Männersprache: Die Arbeit betrachtet die Frage, ob es eine "Frauensprache" gibt und welche sprachlichen Merkmale diese auszeichnen könnten.
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Die Arbeit stellt die feministische Linguistik vor und erläutert ihren Forschungsgegenstand. Sie diskutiert die Bedeutung der Sprache als ein Mittel der gesellschaftlichen Veränderung und beleuchtet die Unterdrückung von Frauen durch Sprache.
- Gesellschaft und Sprache: Dieses Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen Sprache und Gesellschaft. Es diskutiert die These, dass Sprache als ein historisch-gesellschaftliches Phänomen veränderbar ist und dass durch Sprache Gesellschaft verändert werden kann. Der Einfluss von Sprache auf unsere Vorstellungen und Handlungen wird diskutiert, sowie die Frage, ob Sprache gesellschaftliche Benachteiligung verändert oder umgekehrt.
- Hat die Sprache ein Geschlecht? Frauensprache vs. Männersprache: Dieses Kapitel untersucht die Frage, ob Sprache ein Geschlecht hat und wie die meisten Sprachsysteme patriarchalisch geprägt sind. Es wird beleuchtet, wie Frauen in Sprache benachteiligt werden und Beispiele für „matriarchalische Sprachen“ vorgestellt, in denen die sprachliche Unterdrückung der Frau ausgeschlossen ist.
- Sexisten Sprachgebrauch: Dieses Kapitel zeigt Beispiele für einen sexistischen Sprachgebrauch in verschiedenen Bereichen auf, z.B. bei den Berufsbezeichnungen, in deutschen Grammatiken und Wörterbüchern oder in Sprichwörtern. Es verdeutlicht, wie verbreitet die Diskriminierung der Frau durch Sprache ist und wie verstärkt sie in der deutschen Sprache auftritt.
- Richtlinien für ein geschlechtergerechtes Deutsch: Dieses Kapitel stellt verschiedene Vorschläge wie z.B. von der UNESCO und Luise F. Pusch zur Vermeidung des sexistischen Sprachgebrauchs vor.
Schlüsselwörter
Feministische Linguistik, Sexismus, Sprachgebrauch, Sprachnorm, Geschlechtergerechte Sprache, Frauensprache, Männersprache, Diskriminierung, Unterdrückung, Geschlechterrollenstereotypen, Sprachsystem, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der feministischen Linguistik?
Sie möchte die systematische Unterdrückung von Frauen in der Sprache aufdecken und durch Sprachkritik zu einer gleichberechtigten Behandlung beider Geschlechter beitragen.
Was versteht man unter dem generischen Maskulinum?
Es beschreibt die Verwendung männlicher Formen (z.B. "die Lehrer"), um gemischte Gruppen oder alle Menschen zu bezeichnen, wodurch Frauen sprachlich unsichtbar werden können.
In welchen Bereichen tritt sexistischer Sprachgebrauch auf?
Sexistischer Sprachgebrauch findet sich in Berufsbezeichnungen, personenbezogenen Pronomen (z.B. "man"), Sprichwörtern sowie in Grammatiken und Wörterbüchern.
Welche Vorschläge gibt es für ein geschlechtergerechtes Deutsch?
Es gibt Richtlinien der UNESCO sowie konkrete "Therapievorschläge" von Luise F. Pusch, um die männliche Dominanz im Sprachsystem aufzubrechen.
Gibt es eine spezifische "Frauensprache"?
Die Arbeit untersucht, ob Frauen anders sprechen als Männer und wie patriarchalische Sprachsysteme die Ausdrucksmöglichkeiten beider Geschlechter prägen.
- Arbeit zitieren
- Saskia Mahlstede (Autor:in), 2003, Sexismus in der Linguistik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13203