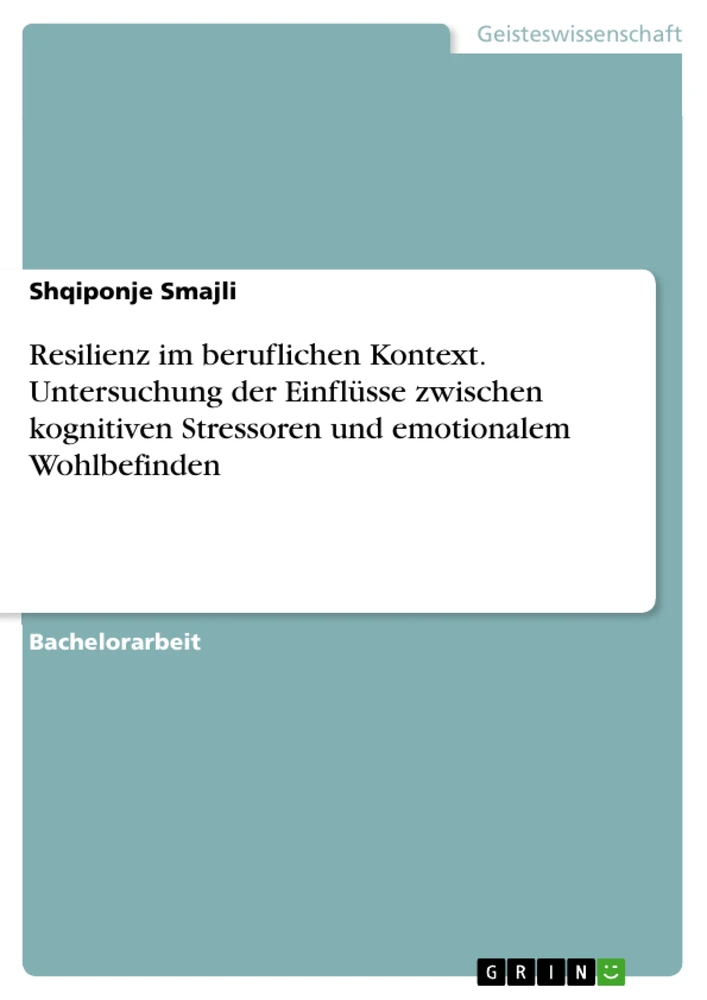Das Ziel dieser Studie ist es, die Wirkung der Resilienz im beruflichen Kontext zu untersuchen und zu klären, ob die Ressource zur Bewältigung arbeitsbezogener Herausforderungen und dem Erhalt des emotionalen Wohlbefindens beiträgt. Hierzu wurde eine kurze Längsschnittstudie durchgeführt, an der insgesamt 243 berufstätige Personen teilnahmen.
Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandsfähigkeit einer Person und wurde bisher hauptsächlich in der Entwicklungspsychologie als Ressource untersucht. In der vorliegenden empirischen Arbeit wird die Resilienz als Persönlichkeitsmerkmal – im Sinne einer personalen Ressource – konzipiert und in den arbeits- und organisationspsychologischen Bereich übertragen.
Vor diesem Hintergrund werden die Conservation of Resources Theory (COR-Theory), als Erklärung zum Zustandekommen von Stressreaktionen, und das transaktionale Stressmodell, zur Beschreibung der Wirkung der Resilienz auf die Beziehung zwischen Stressoren und Stressreaktionen, vorgestellt. Im Anschluss wird die Resilienz zunächst aus psychologischer Sichtweise dargestellt und in den beruflichen Kontext übertragen. Der Ergebnisteil stellt zunächst die deskriptiven Statistiken und Zusammenhänge zwischen den Variablen dar und erläutert die Ergebnisse der Hypothesenprüfungen.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Theoretischer Hintergrund
- Grundbegriffe und Definitionen
- Psychische Belastungen und Beanspruchungen
- Stresszustand, Stressoren und Stressreaktionen
- Ressourcen
- Psychischer Stress am Arbeitsplatz
- Die Conservation of Resources Theorie (COR-Theorie)
- Das transaktionale Stressmodell
- Arbeitsbezogene Stressoren
- Kognitive Stressoren
- Affektive Stressreaktionen
- Bedeutung der Resilienz als personale Ressource
- Resilienz in der Psychologie
- Resilience-Überzeugung und ihre Wirkungsweise
- Grundbegriffe und Definitionen
- Methode
- Stichprobe und Vorgehensweise
- Untersuchungsinstrumente
- Datenanalyse
- Ergebnisse
- Deskriptive Statistik und Korrelationen zwischen den Skalen
- Ergebnisse der Hypothesenprüfung
- Auswirkungen der kognitiven Stressoren auf affektive Stressreaktionen
- Auswirkungen der Resilience-Überzeugung auf negative Affekte
- Moderatoreffekte der Resilience-Überzeugung
- Diskussion
- Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
- Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die wechselseitigen Einflüsse zwischen kognitiven Stressoren und dem emotionalen Wohlbefinden sowie den moderierenden Einfluss der Resilienz. Dabei wird eine kurze Längsschnittstudie durchgeführt, um die Auswirkungen von kognitiven Stressoren auf affektive Stressreaktionen und die Rolle der Resilience-Überzeugung in diesem Zusammenhang zu beleuchten.
- Analyse der Beziehungen zwischen kognitiven Stressoren und emotionalem Wohlbefinden
- Untersuchung des Einflusses der Resilience-Überzeugung auf affektive Stressreaktionen
- Identifizierung von moderierenden Effekten der Resilience-Überzeugung auf die Beziehung zwischen kognitiven Stressoren und emotionalem Wohlbefinden
- Anwendung der Conservation of Resources Theorie (COR-Theorie) und des transaktionalen Stressmodells zur Erklärung der Ergebnisse
- Bedeutung der Resilienz als personale Ressource zur Bewältigung von Stresssituationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Bachelorarbeit gliedert sich in verschiedene Kapitel, die die Forschungsfrage aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Das erste Kapitel befasst sich mit der Problemstellung und stellt den theoretischen Hintergrund der Arbeit dar. Hier werden wichtige Konzepte wie psychische Belastungen, Stressreaktionen, kognitive Stressoren, Resilience-Überzeugung und ihre Bedeutung im Kontext des Arbeitsplatzes erläutert. Die Conservation of Resources Theorie (COR-Theorie) und das transaktionale Stressmodell werden als theoretische Rahmenbedingungen vorgestellt. In Kapitel 3 wird die Methodik der Studie erläutert, einschließlich der Stichprobe, der verwendeten Untersuchungsinstrumente und der Datenanalysemethoden. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Studie, die sowohl deskriptive Statistiken als auch Korrelationen zwischen den Skalen beinhalten. Weiterhin werden die Ergebnisse der Hypothesenprüfung hinsichtlich der Auswirkungen der kognitiven Stressoren auf affektive Stressreaktionen und den Einfluss der Resilience-Überzeugung auf negative Affekte dargestellt. Kapitel 5 schließlich diskutiert die Ergebnisse der Studie, zieht Schlussfolgerungen und würdigt die Arbeit kritisch.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen kognitive Stressoren, emotionales Wohlbefinden, Resilienz, Resilience-Überzeugung, Conservation of Resources Theorie (COR-Theorie), transaktionales Stressmodell, Längsschnittstudie, Arbeitsbezogene Stressoren, affektive Stressreaktionen, psychische Belastungen, Beanspruchungen, Ressourcen, Psychologie, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Resilienz im beruflichen Kontext?
Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandsfähigkeit einer Person, die als personale Ressource dient, um berufliche Herausforderungen und Stress erfolgreich zu bewältigen.
Was ist die „Conservation of Resources Theory“ (COR-Theorie)?
Diese Theorie erklärt Stressreaktionen als Folge des drohenden oder tatsächlichen Verlusts von Ressourcen (z.B. Zeit, Energie, Selbstwertgefühl).
Wie beeinflussen kognitive Stressoren das emotionale Wohlbefinden?
Kognitive Stressoren wie Informationsüberflutung oder komplexe Aufgaben können zu negativen affektiven Reaktionen und einer Minderung des Wohlbefindens führen.
Welche Rolle spielt die „Resilience-Überzeugung“?
Sie wirkt als Moderator, der den Zusammenhang zwischen Stressoren und negativen Gefühlen abmildern kann, indem die Person an ihre eigene Bewältigungsfähigkeit glaubt.
Was ist das Ergebnis der durchgeführten Längsschnittstudie?
Die Studie mit 243 Teilnehmern untersuchte, inwieweit Resilienz tatsächlich zum Erhalt des emotionalen Wohlbefindens bei hoher Arbeitsbelastung beiträgt.
Wie unterscheidet sich psychische Belastung von Beanspruchung?
Belastung sind die äußeren Faktoren (Stressoren), während Beanspruchung die individuelle Reaktion der Person auf diese Faktoren beschreibt.
- Arbeit zitieren
- Shqiponje Smajli (Autor:in), 2020, Resilienz im beruflichen Kontext. Untersuchung der Einflüsse zwischen kognitiven Stressoren und emotionalem Wohlbefinden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1320815