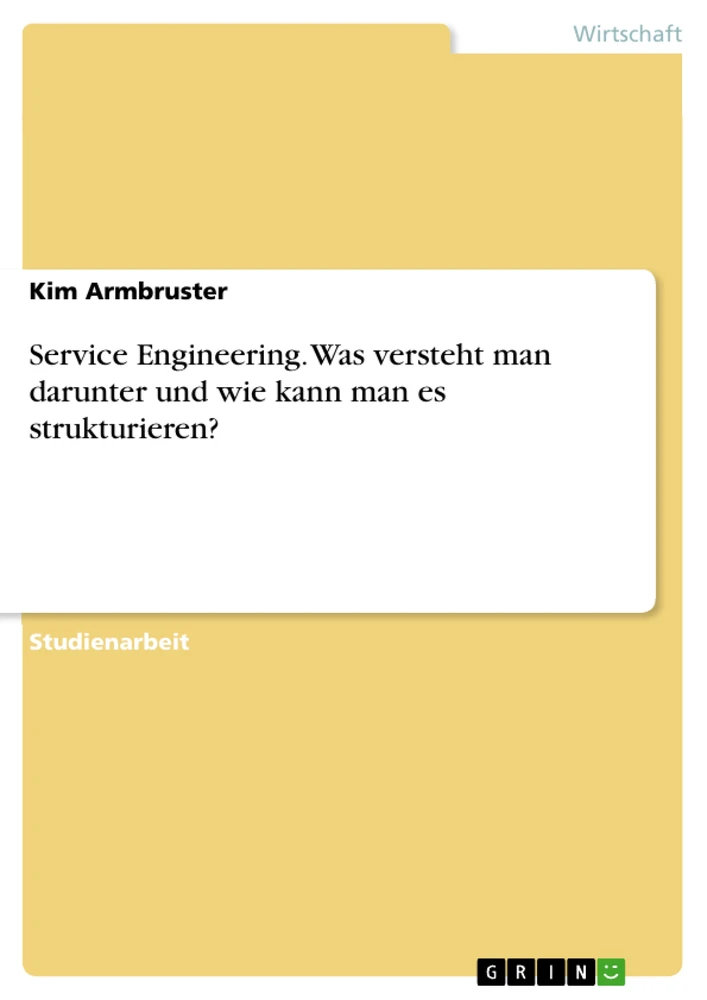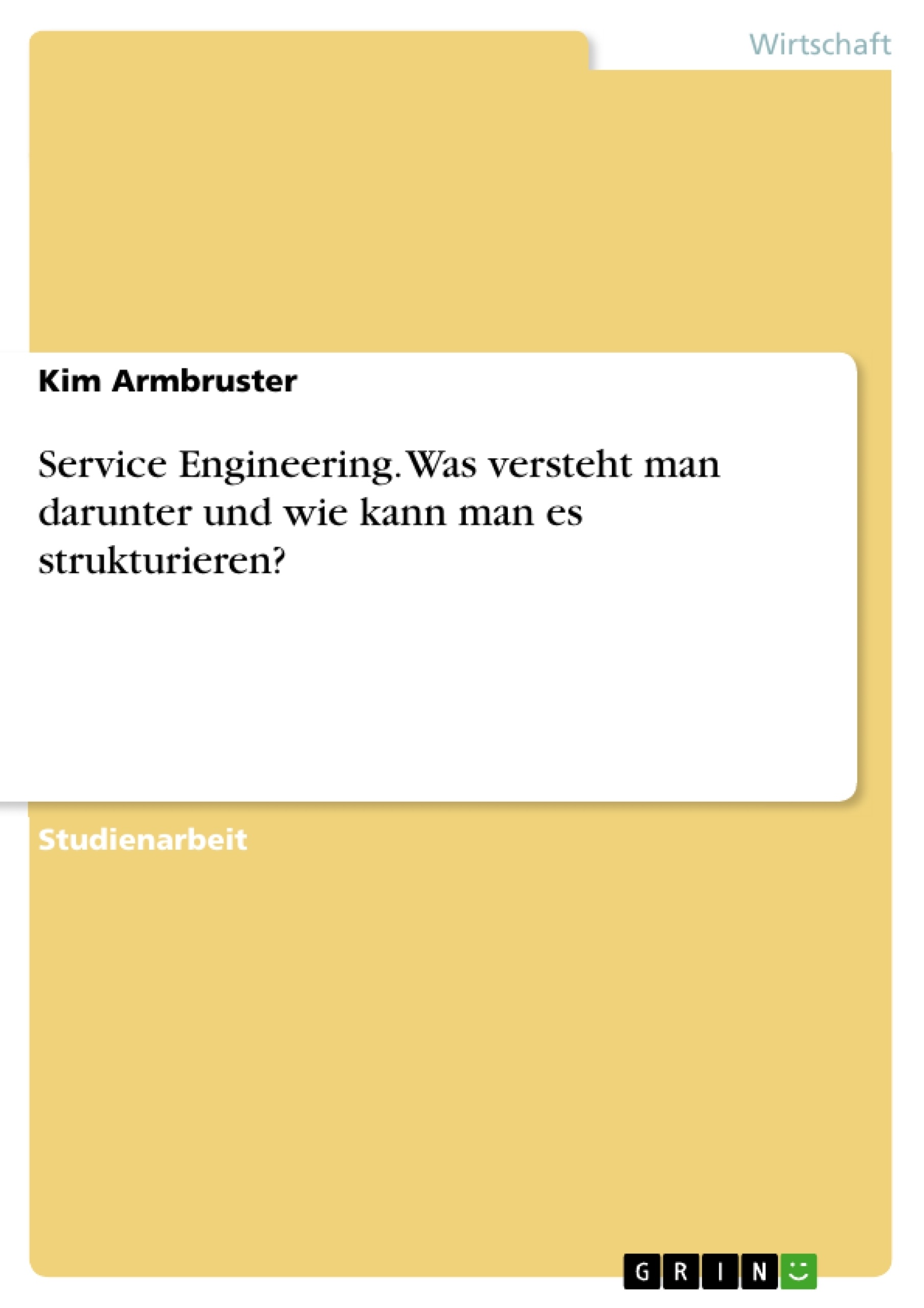Dieses Assignment befasst sich mit dem Thema des Service Engineerings. Ferner wird es sich mit der Bedeutung und der zunehmenden Wichtigkeit des Service Engineerings befassen und näher beleuchtet. Anschließend werden die Informationen über das Modell auf ein Beispielunternehmen gespiegelt und die Vor- und Nachteile der Anwendbarkeit beschrieben.
Der Sektor der Dienstleistungen gewinnt in Deutschland an immer weiterwachsender Wichtigkeit. Auch am Anteil der Bruttowertschöpfung ist dies zu sehen. Im Jahr 2020 betrug der Anteil des Bereiches der Dienstleistungen an der Bruttowertschöpfung 70,4 %. Der Trend Richtung Dienstleistungsgesellschaft wächst also immer weiter.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Die Bedeutung von Dienstleistungen in unserer Volkswirtschaft
1.2. Problemstellung
1.3. Zielstellung
2. Service Engineering
2.1. Definition des Begriffs „Service Engineering“
2.2. Die Phasen des Service Engineering
2.2.1. Startphase
2.2.2. Analysephase
2.2.3. Konzeptionsphase
2.2.4 Implementierung der Dienstleistung
3 Anwendung des Service Engineering anhand eines Beispielunternehmens
3.1. Vorstellung des Beispielunternehmens
3.2. Anwendung des Service Engineering
4 Kritische Betrachtung
5. Zusammenfassung und Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist Service Engineering?
Service Engineering bezeichnet die systematische Entwicklung und Gestaltung von Dienstleistungen unter Verwendung ingenieurwissenschaftlicher Methoden und Modelle.
Welche Phasen durchläuft der Service Engineering Prozess?
Der Prozess gliedert sich klassischerweise in vier Phasen: die Startphase, die Analysephase, die Konzeptionsphase und schließlich die Implementierung der Dienstleistung.
Warum wird Service Engineering in Deutschland immer wichtiger?
Der Dienstleistungssektor trägt mittlerweile über 70 % zur Bruttowertschöpfung in Deutschland bei. Um in diesem wachsenden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, ist eine strukturierte Dienstleistungsentwicklung essenziell.
Was passiert in der Analysephase?
In der Analysephase werden Kundenbedürfnisse, Marktpotenziale und Wettbewerbssituationen untersucht, um die Anforderungen an die neue Dienstleistung präzise zu definieren.
Gibt es Nachteile bei der Anwendung von Service Engineering Modellen?
Ein Nachteil kann die hohe Komplexität und der Zeitaufwand für die detaillierte Planung sein, was besonders für kleinere Unternehmen eine Herausforderung darstellen kann.
- Quote paper
- Kim Armbruster (Author), 2021, Service Engineering. Was versteht man darunter und wie kann man es strukturieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1320859