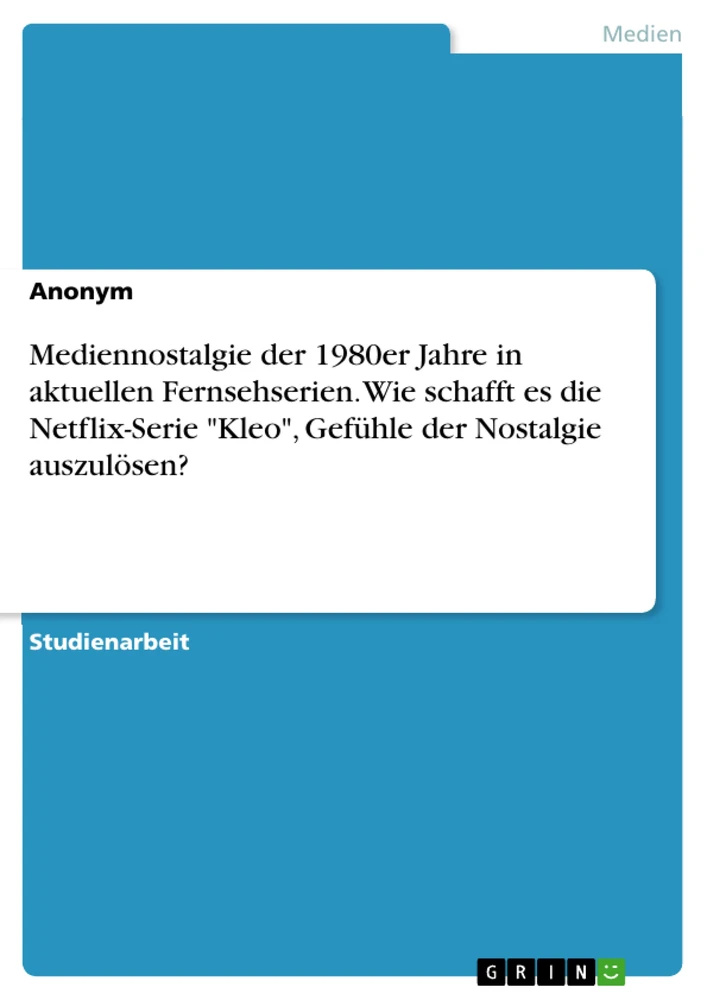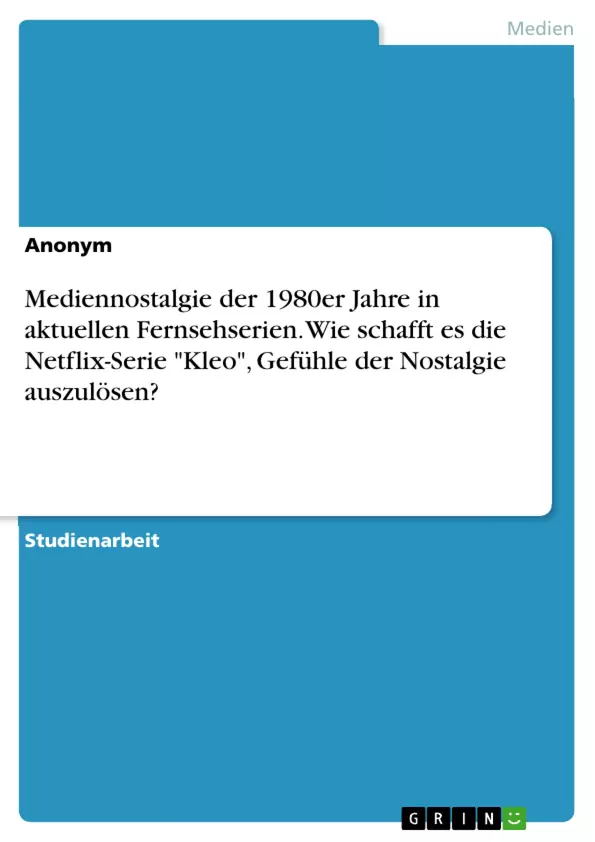Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Leitfrage, inwiefern die aktuelle Netflix-Serie "Kleo" Elemente der Mediennostalgie sowie intermediale Bezüge enthält, die sich auf das Ende der ehemaligen DDR und die Zeit unmittelbar nach der Wende beziehen, sich also zeitlich zwischen 1987 und 1990 verorten lassen. Die Forschungsfrage lautet folglich: Welche konkreten Charakteristika nutzt die Netflix-Serie "Kleo", um Gefühle der Nostalgie bezüglich der späten 80er Jahre innerhalb der DDR und der Zeit nach der Wende um 1990 im geeinten Deutschland bei den ZuschauerInnen auszulösen? Die intermedialen Bezüge sowie die Entstehung von Mediennostalgie soll durch die methodische Herangehensweise der Filmanalyse herausgearbeitet werden.
Retro-Serien auf Netflix boomen, da die ZuschauerInnen es lieben, alte Filme und Serien aus der Vergangenheit sowie neue Inhalte, die zeitlich in der Vergangenheit spielen, anzusehen. Auch die deutsche Netflix-Eigenproduktion "Kleo", die im August 2022 ihren Serienstart feierte, weckt bei den ZuschauerInnen nostalgische Gefühle, denn sie spielt im Zeitraum von 1987 bis 1990, zur Zeit der ehemaligen DDR und der anschließenden Wende im dann wiedervereinten Deutschland. Nostalgische Elemente in Filmen und Serien können positive Erinnerungen an die Vergangenheit eines jeden hervorbringen. Es passiert deshalb häufig, dass sich ZuschauerInnen mit nostalgischen Serien eher identifizieren können und hierdurch positive Gefühle bei ihnen ausgelöst werden. Analog zum Netflix-Original "Stranger Things", welches in den 80er Jahren in den USA spielt, schafft es auch "Kleo", eine affektive Bindung zur Vergangenheit herzustellen. Das gelingt zum einen durch die Darstellung des Systems der ehemaligen DDR und zum anderen durch die spezielle Ästhetik von Figuren und Umgebung, dem Einsatz von zeittypischen Medien sowie unter anderem der Verwendung von Musik aus den 80er Jahren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Mediennostalgie
- 2.1 Nostalgie – eine Begriffsdefinition
- 2.2 Intermedialität und Remediatisierung
- 2.3 Retro – der Blick zurück in die Zukunft
- 3. Die Retro-Serie Kleo von Netflix
- 3.1 Bildästhetik der Serie
- 3.2 Darstellung der Figuren und des Umfelds
- 3.3 Einsatz von Medien in der Serie
- 3.4 Einsatz von Musik in der Serie
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Netflix-Serie "Kleo" im Hinblick auf ihre Verwendung von Mediennostalgie und intermedialen Bezügen im Kontext des späten DDR-Regimes und der deutschen Wiedervereinigung (1987-1990). Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche konkreten Charakteristika nutzt die Serie, um nostalgische Gefühle bei den Zuschauern auszulösen?
- Mediennostalgie in Fernsehserien
- Die Darstellung der DDR in "Kleo"
- Intermedialität und Remediatisierung in "Kleo"
- Bildästhetik und die Inszenierung von Nostalgie
- Der Einsatz von Musik und Medien als nostalgische Elemente
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Mediennostalgie in aktuellen Fernsehserien ein und stellt die Netflix-Serie "Kleo" als Fallbeispiel vor. Sie hebt den Boom von Retro-Serien hervor und zeigt die Bedeutung nostalgischer Elemente für die Zuschauerbindung auf. Die Arbeit formuliert die zentrale Forschungsfrage und skizziert den Aufbau.
2. Mediennostalgie: Dieses Kapitel erörtert den Begriff der Mediennostalgie und deren Entwicklung. Es analysiert verschiedene Definitionen von Nostalgie, von der ursprünglichen Auffassung als Krankheit bis hin zu heutigen soziologischen und psychologischen Perspektiven. Der Unterschied zwischen reflexiver und restaurativer Nostalgie wird anhand von Svetlana Boyms Werk erläutert. Der Kapitel beschreibt den Kontext der steigenden Nostalgie in der modernen Gesellschaft, im Zusammenhang mit technologischem Wandel und gesellschaftlichen Umbrüchen.
Schlüsselwörter
Mediennostalgie, Netflix-Serie Kleo, DDR, deutsche Wiedervereinigung, 1980er Jahre, Retro-Ästhetik, Intermedialität, Remediatisierung, Filmanalyse, Nostalgie-Begriff, affektive Bindung, zeitgeschichtlicher Kontext.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Kleo": Mediennostalgie in einer Netflix-Serie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Netflix-Serie "Kleo" im Hinblick auf ihre Verwendung von Mediennostalgie und intermedialen Bezügen im Kontext des späten DDR-Regimes und der deutschen Wiedervereinigung (1987-1990). Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche konkreten Charakteristika nutzt die Serie, um nostalgische Gefühle bei den Zuschauern auszulösen?
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Mediennostalgie in Fernsehserien, die Darstellung der DDR in "Kleo", Intermedialität und Remediatisierung in "Kleo", Bildästhetik und die Inszenierung von Nostalgie sowie den Einsatz von Musik und Medien als nostalgische Elemente.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Mediennostalgie (inkl. Begriffsdefinition, Intermedialität und Remediatisierung, sowie Retro-Ästhetik), Die Retro-Serie Kleo von Netflix (inkl. Bildästhetik, Figuren- und Umfeld-Darstellung, Einsatz von Medien und Musik), und Fazit.
Wie wird Mediennostalgie definiert?
Das Kapitel "Mediennostalgie" erörtert den Begriff der Mediennostalgie und dessen Entwicklung. Es analysiert verschiedene Definitionen von Nostalgie, von der ursprünglichen Auffassung als Krankheit bis hin zu heutigen soziologischen und psychologischen Perspektiven. Der Unterschied zwischen reflexiver und restaurativer Nostalgie wird anhand von Svetlana Boyms Werk erläutert. Der Kontext der steigenden Nostalgie in der modernen Gesellschaft, im Zusammenhang mit technologischem Wandel und gesellschaftlichen Umbrüchen, wird ebenfalls beschrieben.
Welche Aspekte von "Kleo" werden analysiert?
Die Analyse von "Kleo" konzentriert sich auf die Bildästhetik der Serie, die Darstellung der Figuren und des Umfelds, den Einsatz von Medien (wie z.B. verschiedene Medienformate der Zeit) und den Einsatz von Musik als Mittel zur Erzeugung von Nostalgie.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mediennostalgie, Netflix-Serie Kleo, DDR, deutsche Wiedervereinigung, 1980er Jahre, Retro-Ästhetik, Intermedialität, Remediatisierung, Filmanalyse, Nostalgie-Begriff, affektive Bindung, zeitgeschichtlicher Kontext.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche konkreten Charakteristika nutzt die Serie, um nostalgische Gefühle bei den Zuschauern auszulösen?
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Netflix-Serie "Kleo" im Hinblick auf ihre Verwendung von Mediennostalgie und intermedialen Bezügen im Kontext des späten DDR-Regimes und der deutschen Wiedervereinigung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Mediennostalgie der 1980er Jahre in aktuellen Fernsehserien. Wie schafft es die Netflix-Serie "Kleo", Gefühle der Nostalgie auszulösen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1320865