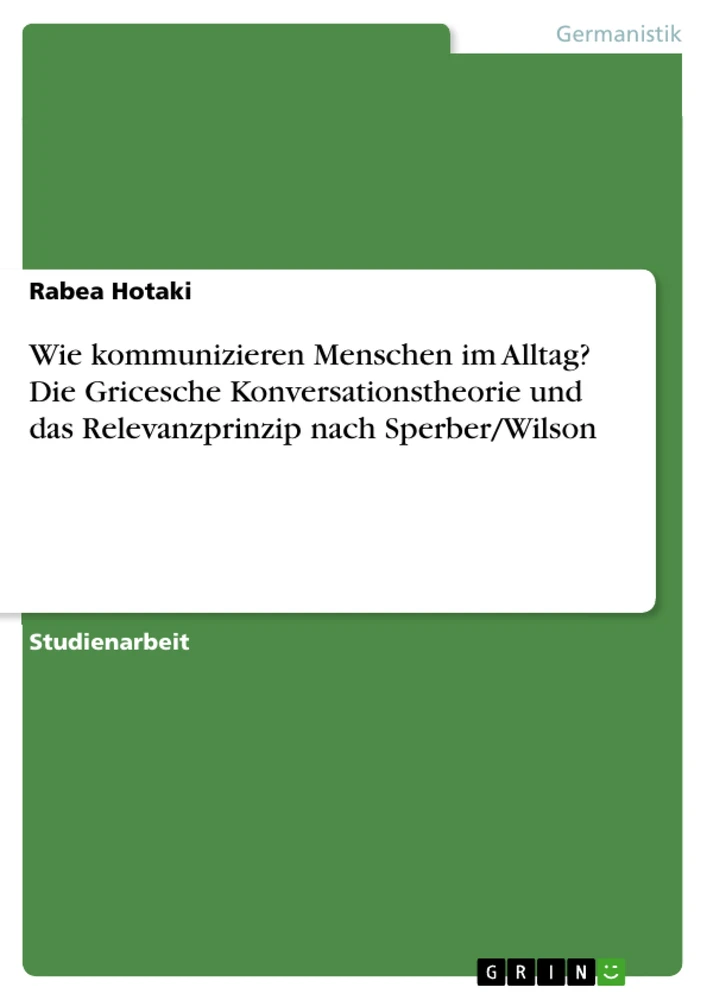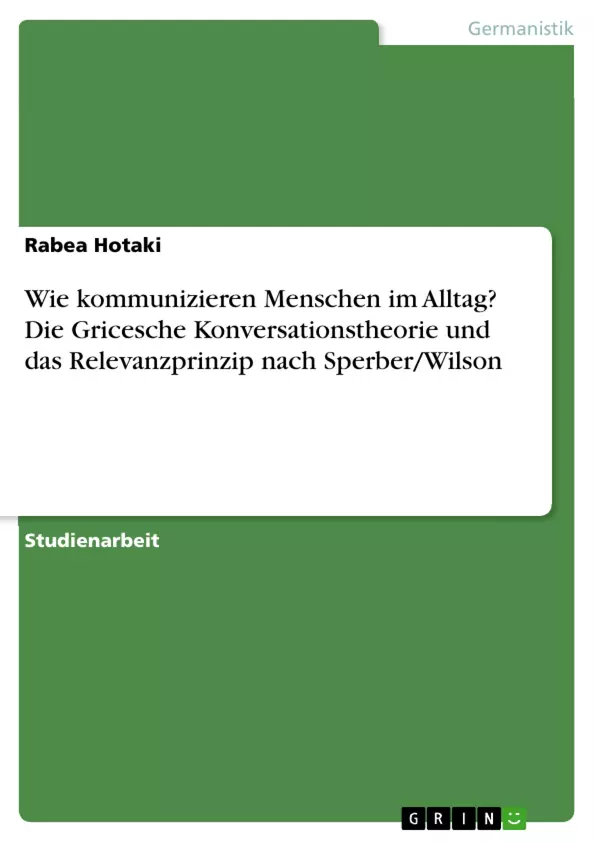Wie läuft die Kommunikation zwischen Menschen ab? Dazu gibt es einmal die Theorie nach Grice und das Relevanzprinzip nach Sperber/Wilson. Die Arbeit stellt beide Theorien vor und zeigt, wo ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede liegen und worin die Debatte zwischen diesen beiden Theorien besteht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Kooperationsprinzip nach Grice
- Die Konversationsmaximen
- Implikaturen
- Kritik an Grice
- Das Relevanzprinzip nach Sperber & Wilson
- Kritische Diskussion
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Debatte zwischen der Griceschen Konversationstheorie und dem Relevanzprinzip nach Sperber/Wilson. Sie analysiert die beiden Theorien und beleuchtet ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der beiden Konzepte zu entwickeln und ihre Bedeutung für das Verständnis von Kommunikation im Alltag zu erforschen.
- Das Kooperationsprinzip nach Grice und seine Konversationsmaximen
- Der Zusammenhang zwischen Implikaturentheorie und semantischen sowie pragmatischen Aspekten der Kommunikation
- Die Relevanztheorie nach Sperber/Wilson und ihre Funktionsweise
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Theorien
- Kritische Analyse und Darstellung der Debatte zwischen den beiden Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Kommunikation im Alltag ein und stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor. Sie beleuchtet den Unterschied zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir meinen, und führt die Implikaturentheorie von Grice ein. Kapitel 2 widmet sich dem Kooperationsprinzip nach Grice, seinen Konversationsmaximen und den daraus resultierenden Implikaturen. Es werden die einzelnen Maximen der Quantität, Qualität, Relevanz und Modalität erläutert und ihre Bedeutung für die Interpretation von Gesprächsbeiträgen verdeutlicht.
Kapitel 3 stellt die Relevanztheorie von Sperber/Wilson vor. Sie erklärt, wie Kommunikation nach dieser Theorie funktioniert und stellt den Zusammenhang zur Theorie von Grice dar. Kapitel 4 beinhaltet eine kritische Gegenüberstellung der beiden Theorien, um ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Es wird ebenfalls eine kritische Beleuchtung der beiden Theorien vorgenommen, um die Debatte zwischen ihnen darzustellen.
Schlüsselwörter
Konversationstheorie, Implikaturentheorie, Kooperationsprinzip, Konversationsmaximen, Relevanztheorie, Relevanzprinzip, Kommunikation, Sprachliches Handeln, Semantik, Pragmatik, Implikaturen, Sprachliche Bedeutung, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kooperationsprinzip von Paul Grice?
Das Kooperationsprinzip besagt, dass Gesprächsteilnehmer ihren Beitrag so gestalten sollten, wie es der Zweck oder die Richtung des Gesprächs erfordert.
Welche vier Konversationsmaximen stellte Grice auf?
Grice unterscheidet die Maximen der Quantität (Informationsgehalt), Qualität (Wahrheit), Relevanz und Modalität (Klarheit).
Was versteht man unter einer "Implikatur"?
Eine Implikatur bezeichnet das, was ein Sprecher andeutet oder meint, ohne es explizit auszusprechen, oft durch die bewusste Verletzung einer Konversationsmaxime.
Wie unterscheidet sich die Relevanztheorie von Sperber & Wilson von Grice?
Während Grice mehrere Maximen nutzt, reduzieren Sperber und Wilson die Kommunikation auf ein einziges Relevanzprinzip, das die kognitive Verarbeitung steuert.
Was sind die zentralen Kritikpunkte an der Griceschen Theorie?
Kritiker bemängeln oft die Unschärfe der Maximen und die Frage, ob Kooperation tatsächlich die universelle Basis jeder menschlichen Kommunikation ist.
- Quote paper
- Rabea Hotaki (Author), 2022, Wie kommunizieren Menschen im Alltag? Die Gricesche Konversationstheorie und das Relevanzprinzip nach Sperber/Wilson, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1320887