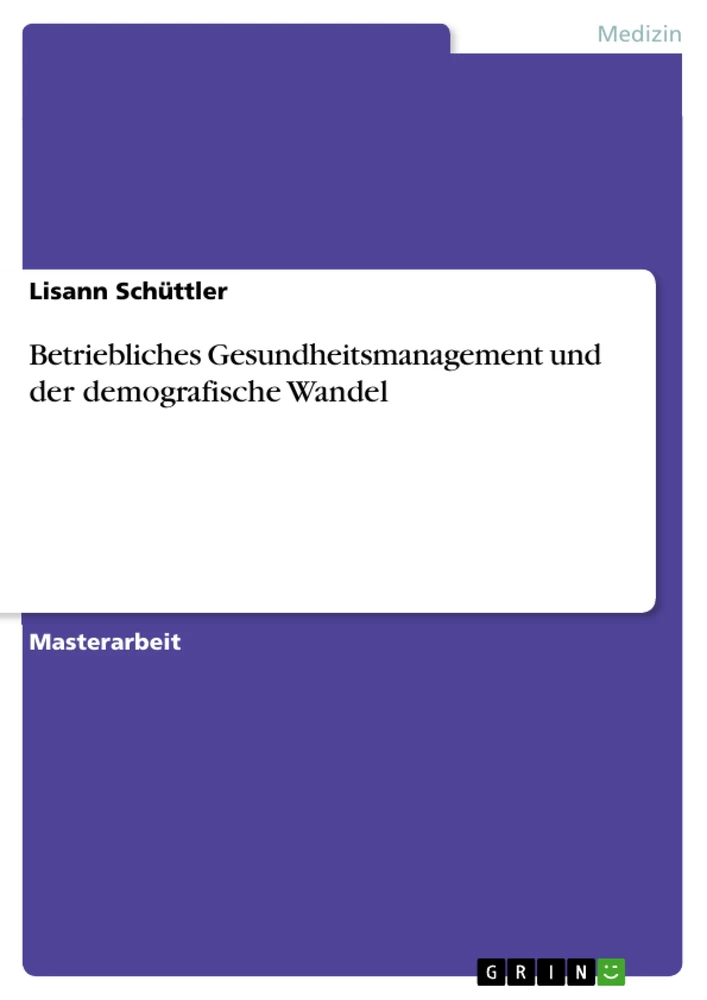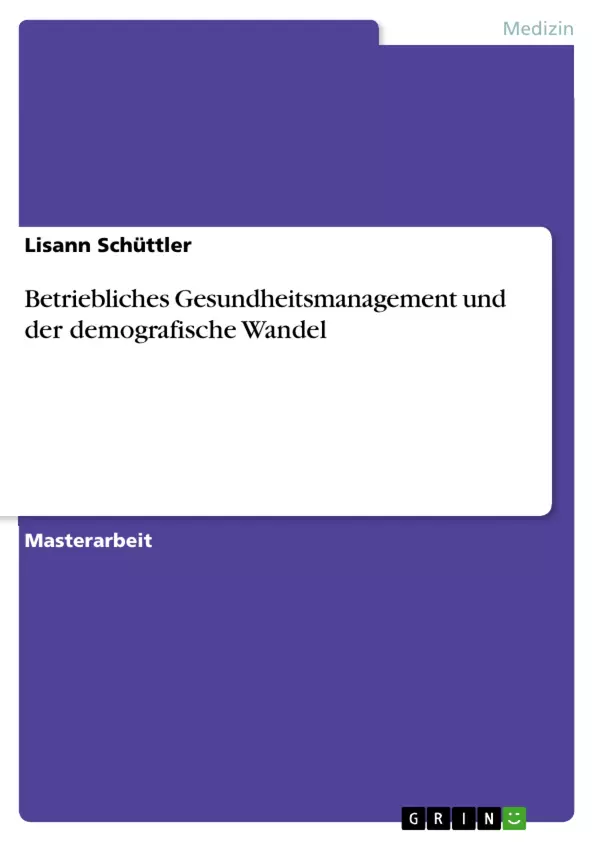Ziel der Arbeit ist es, auf Basis einer systematischen Literaturrecherche und -auswertung die Möglichkeiten zum Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit zu identifizieren und die Bedeutung des BGM in diesem Zusammenhang herauszuarbeiten.
Seit Jahren beschäftigen sich die Politik, die Sozialversicherung und die Betriebe und Arbeitnehmervertretungen mit der Bewältigung des demografischen Wandels. Während es für die Sozialversicherung vorrangig um die Versorgung Älterer geht, prüfen Unternehmen die Möglichkeiten, ältere Beschäftigte ohne Performanceeinbußen bis zur Rente im Unternehmen zu halten. Dass sich Fähigkeiten im Laufe eines Lebens verändern und die Arbeitsfähigkeit geringer wird, ist wissenschaftlich gut untersucht. Daher gilt es zu prüfen, welche Rolle in diesem Zusammenhang Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, der Aufbau eines BGM und die Verhältnisprävention (einschließlich Arbeitsorganisation und Arbeitszeitmodelle) spielen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG
- ZIELSETZUNG
- GEGENWÄRTIGER KENNTNISSTAND
- Der demografische Wandel in Deutschland
- Geburtenzahlen
- Die Lebenserwartung
- Wanderungsbewegungen
- Bevölkerungsentwicklung in Deutschland
- Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Arbeitswelt
- Gesundheit und Alter(n)
- Verständnis von Gesundheit
- Altern und Leistungsfähigkeit
- Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Definition und Grundlagen
- Digitales BGM
- Ziele und Nutzen
- Kernprozesse
- Handlungsfelder
- METHODIK
- Forschungsfragen
- Ablauf der Literaturrecherche
- ERGEBNISSE
- DISKUSSION
- Diskussion der Ergebnisse
- Kritische Reflexion der Vorgehensweise
- Ausblick auf zukünftige Studien und mögliche Gestaltungsmaßnahmen
- Fazit
- ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Master-Thesis analysiert die Bedeutung des betrieblichen Gesundheitsmanagements im Kontext des demografischen Wandels und dessen Beitrag zur Beschäftigungsfähigkeit von Personen ab 50 Jahren.
- Der demografische Wandel in Deutschland und seine Auswirkungen auf die Arbeitswelt
- Gesundheit und Alter(n) im Arbeitskontext
- Betriebliches Gesundheitsmanagement als strategische Ressource im Umgang mit dem demografischen Wandel
- Möglichkeiten zur Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer durch BGM
- Bewertung des Einflusses von BGM auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit älterer Beschäftigter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Relevanz des demografischen Wandels für die Arbeitswelt. Sie stellt die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit dar.
Kapitel 3 beleuchtet den aktuellen Kenntnisstand zum Thema Demografie und Altersentwicklung. Es behandelt verschiedene Aspekte wie die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland, die Auswirkungen des Wandels auf die Arbeitswelt, sowie die Bedeutung von Gesundheit im Alter.
Kapitel 3.3 konzentriert sich auf das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) und dessen Bedeutung für die Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen. Es werden die Grundlagen von BGM erläutert, sowie dessen Ziele, Nutzen und Kernprozesse.
Kapitel 4 beschreibt die Methodik der Arbeit, einschließlich der Forschungsfragen und des Ablaufs der Literaturrecherche.
Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Literaturrecherche und analysiert die verschiedenen Studien und deren Ergebnisse.
Kapitel 6 diskutiert die Ergebnisse im Detail, reflektiert die Vorgehensweise kritisch und gibt einen Ausblick auf zukünftige Studien und Gestaltungsmaßnahmen.
Das Kapitel "Zusammenfassung" fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Demografischer Wandel, Alter(n), Beschäftigungsfähigkeit, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Altersstruktur, Lebenserwartung, Fachkräftemangel, Digitales BGM, Handlungsfelder, Gesundheitsförderung, Altersgerechte Arbeitsbedingungen, Studien, Literaturrecherche, Ergebnisse, Diskussion
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst der demografische Wandel die Arbeitswelt?
Durch sinkende Geburtenraten und steigende Lebenserwartung altert die Belegschaft, was Unternehmen vor die Herausforderung stellt, die Arbeitsfähigkeit älterer Mitarbeiter zu erhalten.
Was ist die Aufgabe des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)?
BGM dient der Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen und der Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit durch Prävention und Gesundheitsförderung.
Können ältere Beschäftigte ohne Performanceeinbußen bis zur Rente arbeiten?
Die Arbeit untersucht, wie durch BGM und altersgerechte Arbeitszeitmodelle die Leistungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer (50plus) stabil gehalten werden kann.
Was versteht man unter „Digitalem BGM“?
Es umfasst den Einsatz digitaler Tools und Plattformen zur Unterstützung von Gesundheitsmaßnahmen im Betrieb, was ein modernes Handlungsfeld des BGM darstellt.
Was ist Verhältnisprävention?
Im Gegensatz zur Verhaltensprävention (Individuum) setzt sie an der Arbeitsorganisation und den Arbeitsbedingungen an, um Belastungen direkt am Arbeitsplatz zu reduzieren.
- Quote paper
- Lisann Schüttler (Author), 2022, Betriebliches Gesundheitsmanagement und der demografische Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1321427