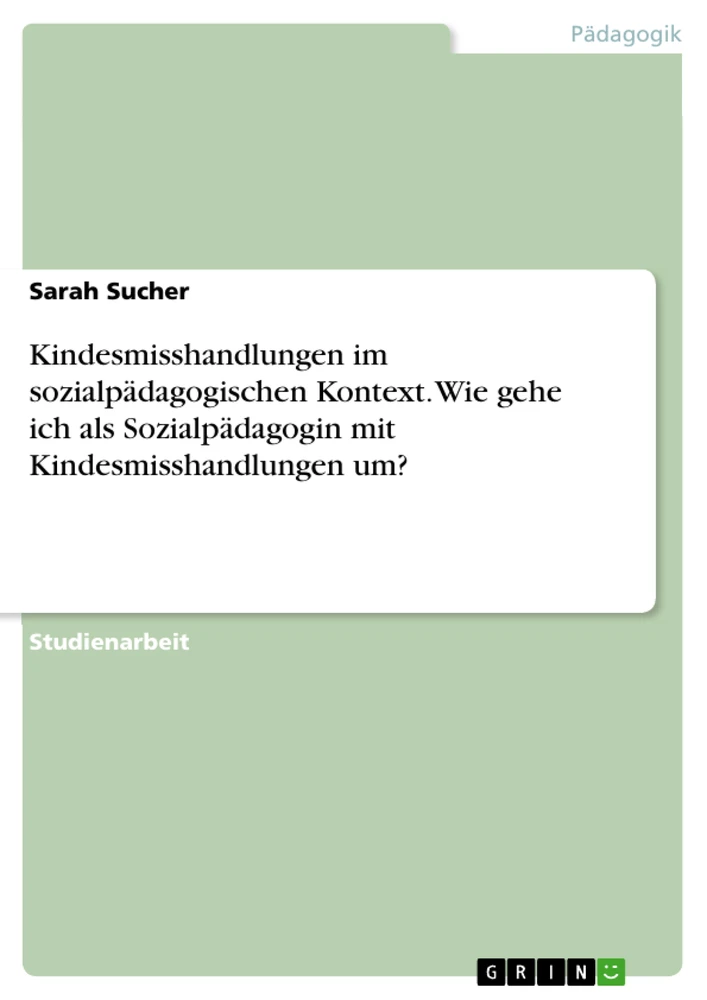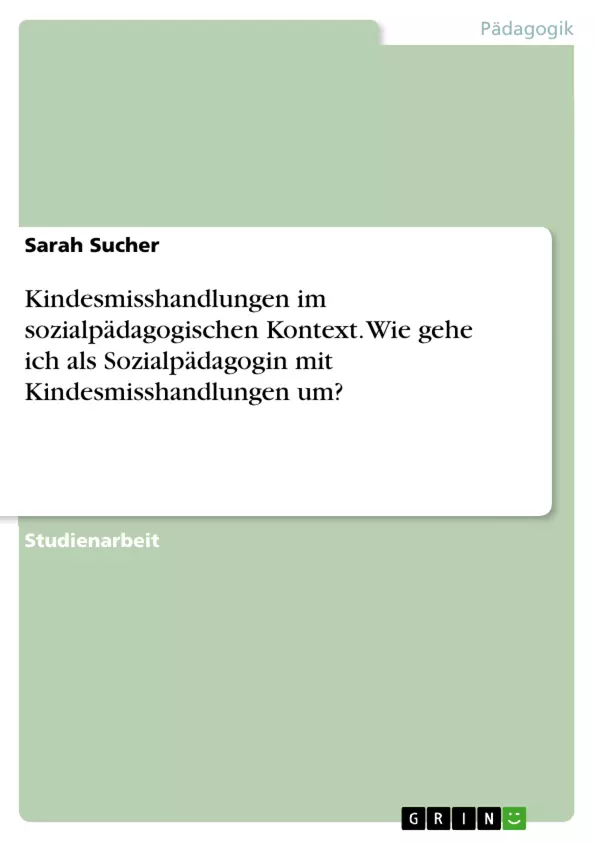In dieser Arbeit soll exemplarisch dargelegt werden, wie man Kindesmisshandlung erkennen und wahrnehmen kann und wie
Sozialpädagog*innen mit Verdachtsfällen umgehen müssen. Grundlage dieser Arbeit ist die Forschungsfrage: "Kindesmisshandlungen im sozialpädagogischem Kontext - Wie gehe ich als Sozialpädagogin (S) mit Kindesmisshandlungen um?"
Der Aufbau dieser Arbeit gliedert sich in verschiedene Kapitel und Unterkapitel. Innerhalb der ersten Kapitel bezieht sich die Arbeit auf die Gliederung der Arbeit und die Einleitung. Das zweite Kapitel beleuchtet die Rahmenbedingungen von Sozialpädagogik nach Getrud Bäumer, indem die Definition und die Aufgaben und Ziele von Sozialpädagogik beschrieben werden. Gertrud Bäumer wird dabei angewandt, da sie eine staatliche Fixierung der Sozialpädagogik wollte, damit das
Schicksal und die Zukunft der Kinder nicht alleine in der Hand der Familie beziehungsweise Erziehungsberechtigten liegt. Das dritte Kapitel setzt sich mit den theoretischen Grundlagen von Kindesmisshandlung auseinander, damit die Inhalte der Arbeit besser verstanden und nachvollzogen werden können. Demzufolge werden die Definitionen, rechtlichen Grundlagen und Typologien von Kindesmisshandlung beschrieben. Anschließend werden die Symptome und Hinweise auf Kindesmisshandlung dargelegt. Das vierte Kapitel beinhaltet die Verhaltensempfehlung bei Verdachtsfällen von Kindesmisshandlung, welche im
fünften Kapitel am Fallbeispiel Emmi angewandt werden. Dabei ist zu beachten, dass ich, Sarah Sucher, im Fallbeispiel Emmi die Sozialpädagogin (S) darstelle. Ebenfalls, dass das benannte Kind aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen in Emmi umbenannt wurde. Zum Schluss erfolgt ein Resümee, welches eine Zusammenfassung und eine Präsentation der Ergebnisse zur Forschungsfrage beinhaltet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rahmenbedingungen Sozialpädagogik nach Gertrud Bäumer...
- Rahmenbedingungen Kindesmisshandlung
- Kindesmisshandlung........
- Rechtliche Grundlagen nach dem SGB VIII
- Typologien von Kindesmisshandlung.
- Sexuelle Misshandlung ...
- Körperliche/ Physische Misshandlung
- Seelische/ Psychische Misshandlung
- Vernachlässigung......
- Symptome und Hinweise auf Kindesmisshandlung.
- Körperliche/ Physische Misshandlung
- Sexuelle Misshandlung.
- Vernachlässigung....
- Seelische/ Psychische Misshandlung
- Professionelle Verhaltensempfehlung bei Verdachtsfällen.....
- Baustein: Wahrnehmung ..
- Baustein: Wahrung
- Baustein: Handlung
- Fallbeispiel: Emmi.
- Limitationen.…......
- Resümee....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Kindesmisshandlung im sozialpädagogischen Kontext. Ziel ist es, Sozialpädagog*innen ein tieferes Verständnis für die Erkennung, Wahrnehmung und den Umgang mit Verdachtsfällen von Kindesmisshandlung zu vermitteln.
- Definition und rechtliche Grundlagen von Kindesmisshandlung
- Typologien von Kindesmisshandlung und deren Symptome und Hinweise
- Verhaltensempfehlungen für Sozialpädagog*innen bei Verdachtsfällen
- Relevanz der Sozialpädagogik nach Gertrud Bäumer im Kontext von Kindesmisshandlung
- Anwendung der Erkenntnisse anhand eines Fallbeispiels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Bedeutung des Themas Kindesmisshandlung und die Notwendigkeit einer sensiblen und professionellen Handlungsweise von Sozialpädagog*innen. Das zweite Kapitel beleuchtet die Rahmenbedingungen der Sozialpädagogik nach Gertrud Bäumer, wobei die Definition und die Aufgaben sowie Ziele der Sozialpädagogik erläutert werden. Im dritten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen von Kindesmisshandlung behandelt, einschließlich Definition, rechtlicher Grundlagen, Typologien und Symptome. Das vierte Kapitel widmet sich der professionellen Verhaltensempfehlung bei Verdachtsfällen von Kindesmisshandlung. Dieses Kapitel beinhaltet wichtige Bausteine wie Wahrnehmung, Wahrung und Handlung.
Schlüsselwörter
Kindesmisshandlung, Sozialpädagogik, Gertrud Bäumer, SGB VIII, Typologien, Symptome, Hinweise, Verhaltensempfehlung, Verdachtsfälle, Fallbeispiel.
Häufig gestellte Fragen
Wie können Sozialpädagogen Kindesmisshandlung erkennen?
Durch die Kenntnis spezifischer Symptome und Hinweise in den Bereichen körperliche, sexuelle und seelische Misshandlung sowie Vernachlässigung können Verdachtsfälle frühzeitig identifiziert werden.
Welche rechtlichen Grundlagen gelten bei Kindesmisshandlung?
Zentral sind die Bestimmungen des SGB VIII, die den staatlichen Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung definieren und das Handeln der Fachkräfte regeln.
Welche Rolle spielt die Theorie von Gertrud Bäumer?
Bäumer forderte eine staatliche Fixierung der Sozialpädagogik, damit das Schicksal von Kindern nicht allein in der Hand der Familie liegt, was die Basis für den modernen Kinderschutz bildet.
Was sind die Bausteine der professionellen Verhaltensempfehlung?
Die Empfehlungen gliedern sich in die drei Bausteine: Wahrnehmung (Erkennen), Wahrung (Datenschutz/Sicherheit) und Handlung (Intervention/Hilfeplan).
Welche Typologien von Kindesmisshandlung werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen sexueller Misshandlung, körperlicher (physischer) Misshandlung, seelischer (psychischer) Misshandlung und Vernachlässigung.
- Citar trabajo
- Sarah Sucher (Autor), 2023, Kindesmisshandlungen im sozialpädagogischen Kontext. Wie gehe ich als Sozialpädagogin mit Kindesmisshandlungen um?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1321547