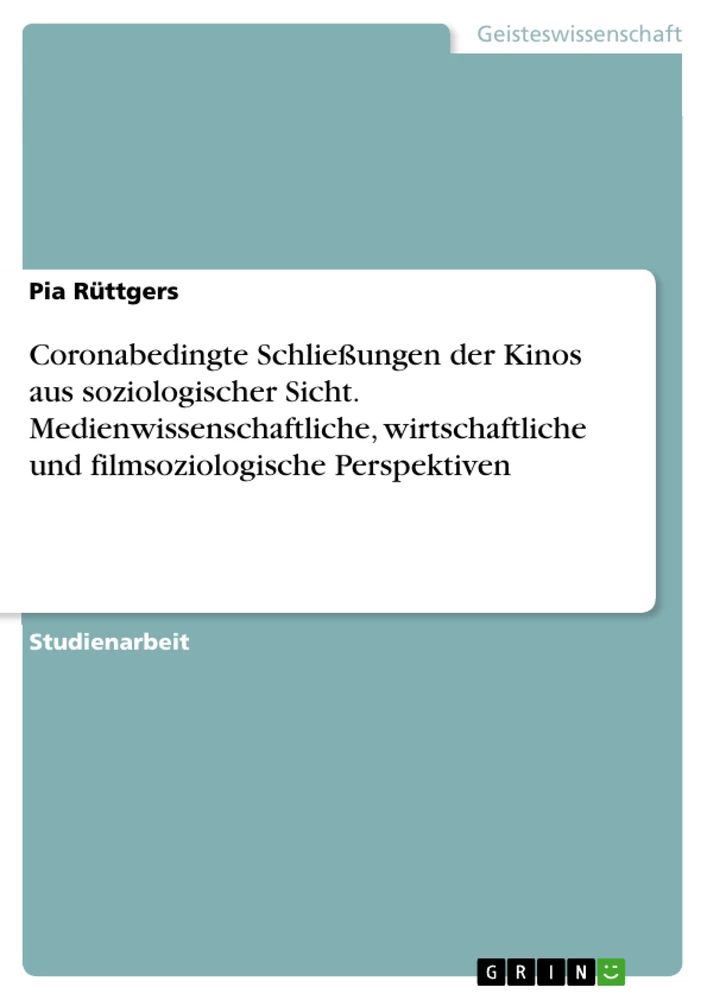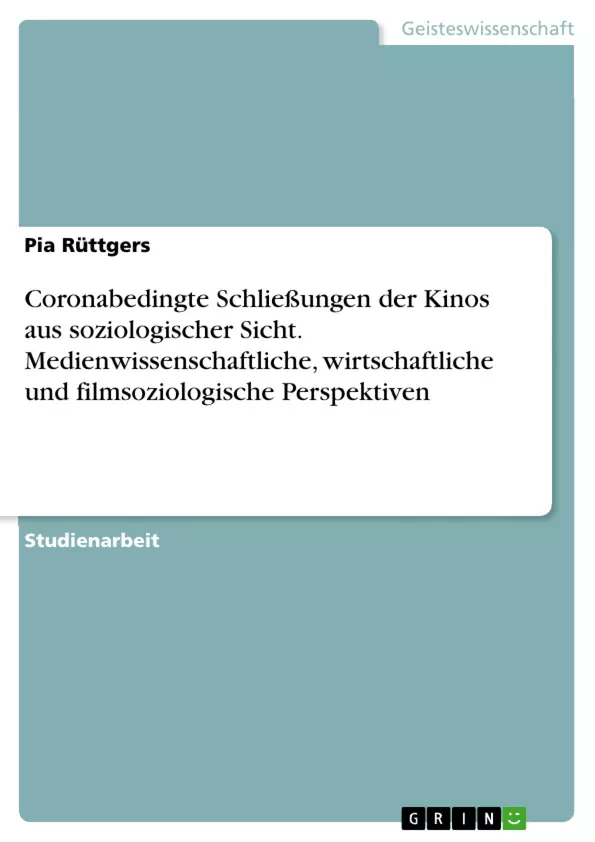Am 16. März 2020 wurde von der Bundesregierung zur Eindämmung des Infektionsgeschehens der Covid-19 Pandemie auch die bundesweite Schließung der Kinos beschlossen. Später durften die Bundesländer unter bestimmten Hygiene- und Abstandsregeln ihre Kinos wieder öffnen. Diese Situation wurde zum Anlass genommen, die Kino-Schließungen aus soziologischer Perspektive zu beurteilen. Hierzu wurde zunächst eine entsprechende Perspektive anhand verschiedener Beiträge zu einer Soziologie des Kinos zu erarbeitet, da es eine einschlägige Soziologie hierzu nicht gibt.
Der soziologischen Tradition in Folge Max Weber, Georg Simmel und anderen folgend kann das Kino nicht als fixe Institution vorausgesetzt werden. Es muss jenseits seiner typischen Merkmale (Technik, Raum, Medium Film etc.) als ein spezifisches Phänomen des „Zusammenseins von Menschen“ verstanden werden, um es in seiner gesamtgesellschaftlichen Bedeutung erklären und beurteilen zu können.
Nach einer kurzen Bestandsaufnahme der „Kino-Soziologien“ werden anhand einer Auswahl geeigneter Ansätze Dimensionen des Kinos in soziologischer Perspektive schrittweise herausgestellt. Dabei werden explizit Anleihen aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen unternommen, insofern sie Ansätze liefern, das Phänomen Kino auch soziologisch besser zu begreifen. Eine erste theoretische Annäherung erfolgt aus einer medienwissenschaftlicher Perspektive über das Konzept des „Kino-Dispositivs“. Es setzt die Kino-Technik in ein Struktur-Verhältnis mit den Kino-Subjekten. Aus einer eher wirtschaftlichen Perspektive wird das Verhältnis Kino und Film genauer in Augenschein genommen. Auch filmsoziologische Arbeiten bieten Ansätze, um das Kino in seiner gesellschaftlichen Funktion zu verstehen. Das Verständnis von Kino als 'Raum des Imaginären' verweist dabei auf weitere Spezifika des Kinos als Aufführungsort. In Anschluss daran wird das Kino als Erfahrungsraum unter den Begriffen Vergemeinschaftung, Individualisierung, Öffentlichkeit und Körperlichkeit um weitere soziologische Dimensionen ergänzt. Empirische Befunde werden sodann ergänzend hinzugezogen, um letztlich die Relevanz der soziologischen Kino-Dimensionen auch quantitativ begründen zu können. Abschließend werden die zentralen Erkenntnisse des Kinos in soziologischer Perspektive zusammenfassend dargestellt und auch die Auswirkungen der pandemiebedingten Schließungen beurteilt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Soziologie des Kinos
- 1.1 Kurze Bestandsaufnahme
- 1.2 Das Kino-Dispositiv
- 1.3 Kino und (Film-)Wirtschaft
- 1.4 Kino und Filmwelten
- 1.5 Kino als Erfahrungsraum
- 1.5.1 Vergemeinschaftung
- 1.5.2 Individualisierung
- 1.5.3 Öffentlichkeit
- 1.5.4 Körperlichkeit
- 1.6 Quantitative Kino-Zugänge
- 2. Beurteilung der Kinoschließungen in soziologischer Perspektive
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die soziologischen Auswirkungen der coronabedingten Kinoschließungen. Ziel ist es, das Kino nicht als fixe Institution, sondern als spezifisches Phänomen des Zusammenseins von Menschen zu verstehen und seine gesamtgesellschaftliche Bedeutung zu beleuchten. Dies geschieht anhand einer Analyse verschiedener soziologischer Ansätze.
- Das Kino als soziales Phänomen
- Das Kino-Dispositiv und seine Wirkung
- Das Kino als wirtschaftlicher und kultureller Faktor
- Das Kino als Erfahrungsraum: Vergemeinschaftung, Individualisierung, Öffentlichkeit und Körperlichkeit
- Soziologische Bewertung der Kinoschließungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Soziologie des Kinos: Dieses Kapitel erarbeitet eine soziologische Perspektive auf das Kino, da eine etablierte soziologische Theorie dazu fehlt. Es beginnt mit einer kurzen Bestandsaufnahme bestehender Ansätze, die sich als unzureichend für die Fragestellung erweisen. Anschließend werden verschiedene Dimensionen des Kinos vorgestellt, unter Einbezug medienwissenschaftlicher und wirtschaftlicher Perspektiven. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Kino als Erfahrungsraum gewidmet, analysiert anhand von Vergemeinschaftung, Individualisierung, Öffentlichkeit und Körperlichkeit. Abschließend werden empirische Befunde integriert, um die Relevanz der soziologischen Kino-Dimensionen quantitativ zu untermauern.
1.1 Kurze Bestandsaufnahme: Die Kapitelüberschrift ist etwas irreführend, denn es wird keine umfassende Bestandsaufnahme der Kino-Soziologie geboten. Stattdessen wird gezeigt, dass es kaum relevante Arbeiten gibt, welche die Fragestellung dieser Arbeit direkt adressieren. Der Fokus liegt auf der Feststellung dieser Forschungslücke und der Notwendigkeit, eine eigene soziologische Perspektive zu entwickeln. Die wenigen erwähnten Studien (Altenloh, Kracauer) werden als unzureichend für das Verständnis des modernen Kinos bewertet.
1.2 Das Kino-Dispositiv: Dieses Kapitel nutzt den medienwissenschaftlichen Begriff des „Kino-Dispositivs“, um die Beziehung zwischen kinematographischer Technik und den Kino-Subjekten zu analysieren. Es unterscheidet zwischen den Inhalten des Films und den medialen Wahrnehmungskonstruktionen des Publikums. Der Fokus liegt auf den Wirkungsbedingungen des Kinos und wie diese die Wahrnehmung der Realität beeinflussen. Das Konzept wird verwendet, um das Kino als gesellschaftliche Wahrnehmungsinstanz zu verstehen.
Schlüsselwörter
Kino, Soziologie, Kinoschließungen, Corona-Pandemie, Film, Medienwissenschaft, Gesellschaft, Erfahrungsraum, Vergemeinschaftung, Individualisierung, Öffentlichkeit, Körperlichkeit, Dispositiv, Wirtschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Soziologische Auswirkungen der coronabedingten Kinoschließungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die soziologischen Auswirkungen der coronabedingten Kinoschließungen. Sie betrachtet das Kino nicht als fixe Institution, sondern als spezifisches Phänomen des Zusammenseins von Menschen und beleuchtet seine gesamtgesellschaftliche Bedeutung anhand verschiedener soziologischer Ansätze.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf das Kino als soziales Phänomen, das Kino-Dispositiv und seine Wirkung, das Kino als wirtschaftlicher und kultureller Faktor, das Kino als Erfahrungsraum (Vergemeinschaftung, Individualisierung, Öffentlichkeit, Körperlichkeit) und eine soziologische Bewertung der Kinoschließungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht mindestens aus dem Kapitel "1. Soziologie des Kinos", welches eine kurze Bestandsaufnahme bestehender Ansätze, das Kino-Dispositiv, das Kino als wirtschaftlicher und kultureller Faktor, das Kino als Erfahrungsraum und quantitative Kino-Zugänge behandelt. Ein weiteres Kapitel befasst sich mit der "Beurteilung der Kinoschließungen in soziologischer Perspektive". Weitere Unterkapitel zu 1. Soziologie des Kinos sind "1.1 Kurze Bestandsaufnahme", "1.2 Das Kino-Dispositiv".
Was wird im Kapitel "Soziologie des Kinos" behandelt?
Dieses Kapitel entwickelt eine soziologische Perspektive auf das Kino, da eine etablierte soziologische Theorie dazu fehlt. Es analysiert verschiedene Dimensionen des Kinos unter Einbezug medienwissenschaftlicher und wirtschaftlicher Perspektiven, wobei dem Kino als Erfahrungsraum besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird (Vergemeinschaftung, Individualisierung, Öffentlichkeit, Körperlichkeit). Empirische Befunde untermauern die Relevanz der soziologischen Kino-Dimensionen quantitativ.
Was wird in Kapitel 1.1 "Kurze Bestandsaufnahme" behandelt?
Dieses Kapitel zeigt die Forschungslücke auf, da es kaum relevante Arbeiten gibt, die die Fragestellung dieser Arbeit direkt adressieren. Die wenigen erwähnten Studien werden als unzureichend für das Verständnis des modernen Kinos bewertet.
Was wird im Kapitel 1.2 "Das Kino-Dispositiv" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Beziehung zwischen kinematographischer Technik und den Kino-Subjekten. Es unterscheidet zwischen den Inhalten des Films und den medialen Wahrnehmungskonstruktionen des Publikums und betrachtet das Kino als gesellschaftliche Wahrnehmungsinstanz.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Kino, Soziologie, Kinoschließungen, Corona-Pandemie, Film, Medienwissenschaft, Gesellschaft, Erfahrungsraum, Vergemeinschaftung, Individualisierung, Öffentlichkeit, Körperlichkeit, Dispositiv, Wirtschaft.
Welche Forschungslücke wird in der Arbeit adressiert?
Es mangelt an einer etablierten soziologischen Theorie zum Kino, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen der coronabedingten Schließungen. Die Arbeit versucht, diese Lücke zu schließen.
- Quote paper
- M.A. Pia Rüttgers (Author), 2021, Coronabedingte Schließungen der Kinos aus soziologischer Sicht. Medienwissenschaftliche, wirtschaftliche und filmsoziologische Perspektiven, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1321654