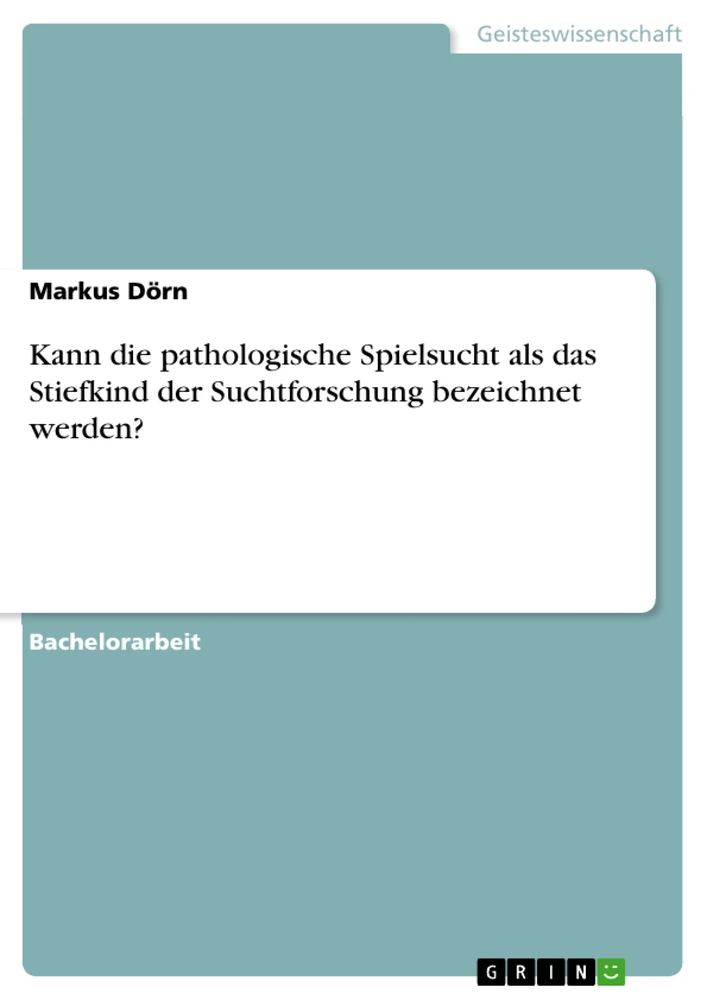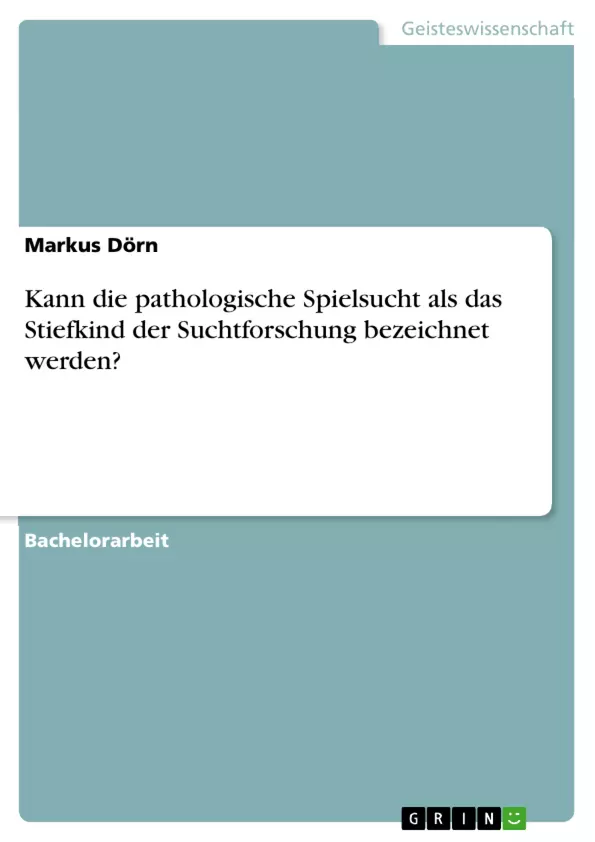Das Spielen ist schon seit langer Zeit ein fester Bestandteil der Kultur des Menschen. Das Glückspiel kann ebenso auf eine lange Geschichte zurückgeführt werden und ist Teil des Alltags der Gesellschaft geworden. Die daraus entstandene Spielsucht ist eine Form der stoffungebundenen Süchte. In der folgenden Arbeit wird die Entstehung und Behandlung dieser Sucht beschrieben. Neben den Definitionen der wichtigsten Begriffe werden die historischen, gesellschaftlichen, theoretischen und rechtlichen Aspekte beleuchtet. Darüber hinaus wird das Glückspiel in seinen verschiedenen Formen näher betrachtet sowie die oftmals vorhandene Komorbidität mit anderen Süchten untersucht. Der zentrale Bestandteil der Arbeit befasst sich mit der Behandlung der Spielsucht. Anhand eines Falles der Stiftung Maria Ebene werden aktuelle Behandlungskonzepte vorgestellt und nach dem derzeitigen Stand der Suchtforschung Alternativen aufgezeigt. Auch die Aufgabe der Sozialen Arbeit im Bereich der Spielsucht wird dabei näher erforscht. Die Arbeit wurde nach dem Sprachleitfaden für geschlechtergerechte Kommunikation verfasst. Dabei können gekürzt Paarformen auftreten, die eine bessere Lesbarkeit gewährleisten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Definitionen der Sucht
- 2.1.1. Stoffgebundene Sucht
- 2.1.2. Stoffungebundene Sucht
- 2.2. Historische Aspekte des Glückspiels
- 2.3. Rechtslage in Österreich
- 2.4. Pathologisches Glücksspiel
- 2.4.1. Definition pathologische Spielsucht
- 2.4.2. Spielerinnentypologien
- 2.4.3. Glückspielarten
- 2.4.4. Die Entstehung und der Verlauf von krankhaftem Glückspiel
- 2.5. Gesellschaftliche Faktoren der Glückspielsucht bei Männern
- 2.6. Komorbidität
- 2.7. Theoriekonzepte
- 2.8. Organisationsspezifischer Kontext
- 2.8.1. Die Stiftung Maria Ebene
- 2.8.2. Fall aus der Praxis
- 2.8.3. Behandlungskonzepte der Stiftung
- 2.8.3.1. Stationäre Behandlung
- 2.8.3.2. Ambulante Behandlung
- 2.8.4. Alternative Behandlungsmöglichkeiten nach dem Stand der Forschung
- 2.8.4.1. Stationäre Behandlung
- 2.8.4.2. Ambulante Behandlung
- 2.8.4.3. Selbsthilfegruppen
- 2.9. Aufgaben der Sozialen Arbeit
- 3. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der pathologischen Spielsucht und untersucht deren Entstehung, Behandlung und die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Neben einer Definition des Begriffs "Spielsucht" werden die historischen, gesellschaftlichen, rechtlichen und theoretischen Aspekte der Sucht näher beleuchtet.
- Definition und Abgrenzung der Spielsucht
- Historisches und gesellschaftliches Umfeld von Glücksspielen
- Rechtliche Rahmenbedingungen in Österreich
- Theoriekonzepte zur Erklärung von Spielsucht
- Behandlungsansätze und aktuelle Forschungsentwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema der Bachelorarbeit vor und erläutert den Forschungsgegenstand. Sie führt in die Thematik der Spielsucht ein und zeigt die Relevanz des Themas auf.
- Kapitel 2: Hauptteil: Der Hauptteil der Arbeit gliedert sich in mehrere Abschnitte, die unterschiedliche Aspekte der Spielsucht beleuchten. Zunächst werden die Begriffe "Stoffgebundene Sucht" und "Stoffungebundene Sucht" definiert. Anschließend werden die historischen Entwicklungen des Glückspiels und die rechtliche Situation in Österreich dargestellt. Im Anschluss daran wird die pathologische Spielsucht detailliert behandelt, unter Einbezug von Spielerinnentypologien, verschiedenen Glückspielarten und der Entstehung und dem Verlauf von krankhaftem Glücksspiel. Die Rolle gesellschaftlicher Faktoren bei der Entstehung von Spielsucht bei Männern wird analysiert, und die Komorbidität mit anderen Suchtformen wird beleuchtet. Darüber hinaus werden verschiedene Theoriekonzepte vorgestellt, die die Spielsucht zu erklären versuchen. Schließlich widmet sich die Arbeit dem organisationsspezifischen Kontext der Stiftung Maria Ebene und stellt den Behandlungsansatz der Einrichtung vor. Im Rahmen eines Fallbeispiels werden aktuelle Behandlungskonzepte präsentiert, und es werden alternative Behandlungsmöglichkeiten diskutiert. Die Aufgaben der Sozialen Arbeit im Bereich der Spielsucht werden ebenfalls erläutert.
Schlüsselwörter
Pathologische Spielsucht, Glücksspiel, Sucht, Stoffgebundene Sucht, Stoffungebundene Sucht, Komorbidität, Behandlung, Sozialarbeit, Stiftung Maria Ebene, Theoriekonzepte, Rechtliche Rahmenbedingungen, Gesellschaftliche Faktoren, Österreich.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen stoffgebundener und stoffungebundener Sucht?
Stoffgebundene Sucht bezieht sich auf Substanzen (z. B. Alkohol, Drogen), während stoffungebundene Sucht Verhaltensweisen betrifft, wie etwa das pathologische Glücksspiel.
Wie wird pathologische Spielsucht definiert?
Es handelt sich um ein chronisches, zwanghaftes Bedürfnis zu spielen, das trotz negativer sozialer, beruflicher und finanzieller Folgen fortgesetzt wird.
Welche Behandlungsmöglichkeiten bietet die Stiftung Maria Ebene?
Die Stiftung bietet sowohl stationäre als auch ambulante Therapiekonzepte an, die speziell auf die Bedürfnisse von Spielsüchtigen zugeschnitten sind.
Was versteht man unter Komorbidität bei Spielsucht?
Komorbidität bedeutet das gleichzeitige Auftreten von Spielsucht mit anderen Störungen, wie Depressionen, Angstzuständen oder Alkoholabhängigkeit.
Welche Aufgaben hat die Soziale Arbeit im Bereich der Spielsucht?
Die Soziale Arbeit unterstützt Betroffene bei der Schuldenregulierung, der sozialen Reintegration und bietet präventive Beratung für Angehörige an.
- Arbeit zitieren
- Markus Dörn (Autor:in), 2012, Kann die pathologische Spielsucht als das Stiefkind der Suchtforschung bezeichnet werden?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1322327