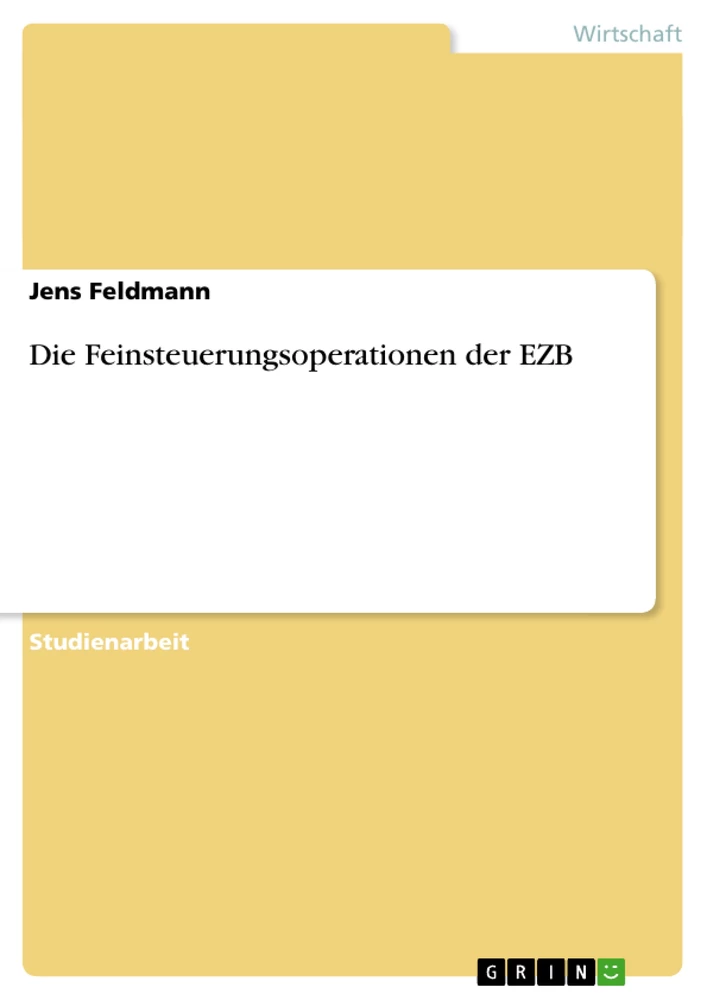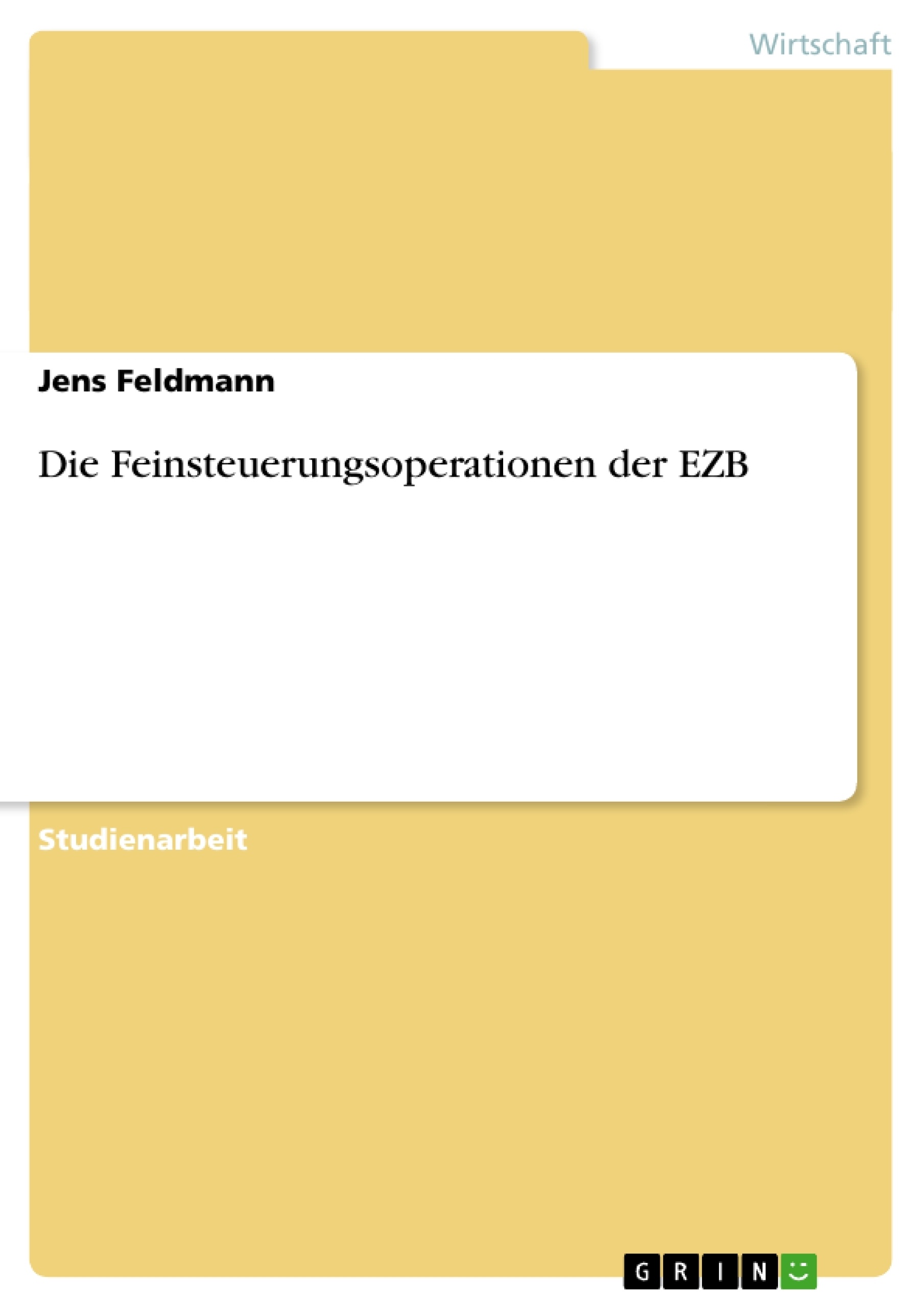Am 1. Januar 1999 nahm das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) seine Arbeit auf, womit die dritte Stufe der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion startete. Mit dieser dritten Stufe wurde ein neues monetäres Regime geschaffen, welches sich wesentlich von den bisherigen nationalen monetären Systemen unterscheidet. Es wurde erschaffen, um vornehmlich einem Ziel zu dienen; der Gewährleistung der Preisstabilität. Um dieses Ziel
auch erreihen zu können, wurde die Europäische Zentralbank (EZB) mit einem geldpolitischen Instrumentarium ausgestattet, mit welchen sie Offenmarktgeschäfte durchführt, ständige Fazilitäten anbietet und das Halten von Mindestreserven den Kreditinstituten vorschreibt.
Die vorliegende Arbeit will speziell auf die Feinsteuerungsoperationen des ESZB eingehen. Nachdem die Feinsteuerungsmaßnahmen im Allgemeinen dargestellt werden, bemüht sich die Arbeit, die einzelnen Instrumente der Feinsteuerung sowie das Verfahren und die Bestimmungen von Feinsteuerungsoperationen bündig zu erörtern. Im Anschluss soll die Anwendung der Feinbesteuerungsinstrumente in der Praxis seit Bestehen der ESZB untersucht werden. Dabei soll auch gezeigt werden, wie massiv die EZB seit den weltweiten Finanzmarkt-Turbulenzen im August 2007 eingreifen musste, um ihrem obersten Ziel, der Preisstabilität, dienlich zu sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Feinsteuerungsoperationen
- Instrumente der Feinsteuerung
- Befristete Transaktionen
- Endgültige Käufe bzw. Verkäufe
- Devisenswapgeschäfte
- Hereinnahme von Termineinlagen
- Feinsteuerungsoperationen: Verfahren und Bestimmungen
- Feinsteuerungsoperationen von 1999 bis August 2007
- Feinsteuerungsoperationen 2007 und die US-Subprime-Krise
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Feinsteuerungsoperationen des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) und analysiert deren Rolle in der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Arbeit untersucht die verschiedenen Instrumente der Feinsteuerung, das Verfahren und die Bestimmungen der Operationen sowie deren praktische Anwendung seit der Einführung des Euro.
- Die Rolle der Feinsteuerungsoperationen in der Geldpolitik der EZB
- Die verschiedenen Instrumente der Feinsteuerung
- Das Verfahren und die Bestimmungen der Feinsteuerungsoperationen
- Die praktische Anwendung der Feinsteuerungsoperationen seit der Einführung des Euro
- Der Einfluss der Feinsteuerungsoperationen auf die Marktliquidität und die Zinssätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Feinsteuerungsoperationen des ESZB und erläutert deren Bedeutung für die Geldpolitik der EZB. Im zweiten Kapitel werden die Feinsteuerungsoperationen im Allgemeinen dargestellt und in vier Kategorien unterteilt: Hauptrefinanzierungsgeschäfte, längerfristige Refinanzierungsgeschäfte, strukturelle Operationen und Feinsteuerungsoperationen. Das dritte Kapitel befasst sich mit den einzelnen Instrumenten der Feinsteuerung, darunter befristete Transaktionen, endgültige Käufe bzw. Verkäufe, Devisenswapgeschäfte und die Hereinnahme von Termineinlagen. Das vierte Kapitel erläutert das Verfahren und die Bestimmungen von Feinsteuerungsoperationen. Die Kapitel fünf und sechs untersuchen die Anwendung der Feinsteuerungsinstrumente in der Praxis seit Bestehen der ESZB, wobei auch der Einfluss der weltweiten Finanzmarkt-Turbulenzen im August 2007 auf die Feinsteuerungsoperationen der EZB beleuchtet wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Feinsteuerungsoperationen, die Geldpolitik der EZB, das Europäische System der Zentralbanken (ESZB), die Offenmarktgeschäfte, die Instrumente der Feinsteuerung, das Verfahren und die Bestimmungen der Feinsteuerungsoperationen, die praktische Anwendung der Feinsteuerungsoperationen, die Marktliquidität, die Zinssätze und die weltweiten Finanzmarkt-Turbulenzen im August 2007.
- Citar trabajo
- Jens Feldmann (Autor), 2008, Die Feinsteuerungsoperationen der EZB, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132384