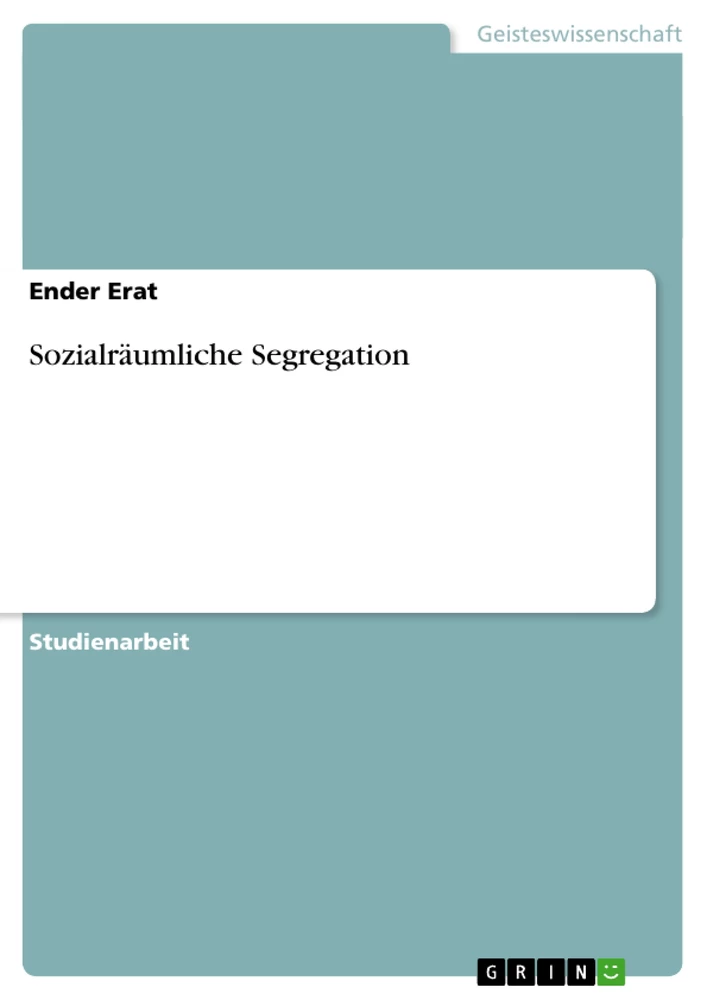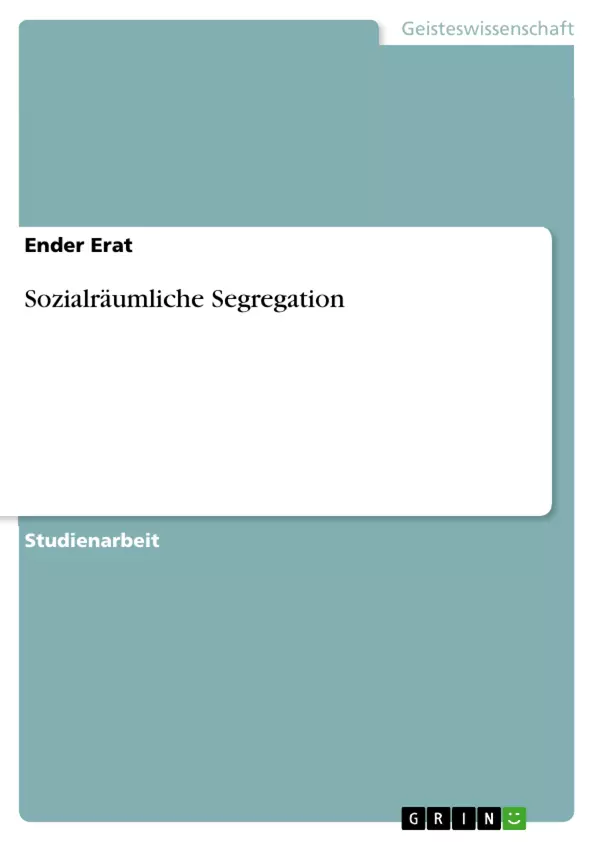[...] Wählt
man als Raumeinheit beispielsweise eine Stadt, so können sich diese
Merkmalsträger, also Menschen, auf unterschiedlichster Weise innerhalb dieser
Stadt räumlich verteilen. Dabei kommt es nicht selten vor, daß gerade solche
Individuen, die durch gleiche oder ähnliche Merkmale charakterisiert sind, sich zufällig
oder bewußt gruppieren und somit die soziale Gliederung der Stadt, die sich auch
im räumlichen Anordnungsmuster dieser unterschiedlichen Gruppen ausdrückt,
beeinflussen. Damit allerdings die sozialräumliche Gliederung einer Raumeinheit
erfaßt werden kann, ist es unabdingbar, die Struktur der Bevölkerung, die in ihr lebt,
genau zu erfassen. Der Gegenstand dieser Arbeit setzt genau an dieser Stelle an:
Denn das Ziel dieser Arbeit ist es, einerseits theoretische und praktische Ansätze aus
der Sozialökologie vorzustellen und andrerseits zu zeigen, daß diese Ansätze dazu
dienen können, die Bevölkerungsstruktur in einem kleinräumigen Rahmen zu
analysieren und damit die sozialräumliche Gliederung einer räumlichen Untersuchungseinheit
zu bestimmen.
Im ersten Teil werden hinführend auf den Hauptteil dieser Arbeit, die wichtigsten
Merkmale einer Bevölkerung, die ihre Struktur bestimmen, vorgestellt. Dazu gehören
demographische, rassische, ethnisch-kulturelle und sozio-ökonomische Merkmale,
deren Grundlage Daten aus Volkszählungen und anderen Erhebungen bilden.
Im Hauptteil dieser Arbeit wird zunächst eine historisch geleitete Einführung in die
sozialökologische Forschung geliefert. Dabei geht es um die Entwicklung der Sozialökologie
von der klassischen Sozialökologie, über die neo-klassischen Richtungen,
zu den zwei bedeutendsten Ansätzen - die Sozialraumanalyse und die Faktorialökologie.
Da mit dem klassischen Ansatz auch drei schematischen Stadtmodelle von
Burgess, Hoyt und Harris und Ullman einher gehen, soll ebenso auf deren Inhalte
skizzenhaft eingegangen werden. Der eigentliche Schwerpunkt dieses Hauptteils
liegt allerdings auf der kritischen Erörterung der Sozialraumanalyse und der Faktorialökologie.
Dabei sollen zwei empirische Untersuchungen, die in Hamburg (1977)
und München (1993) durchgeführt wurden, die Anwendung dieser beiden Ansätze
zur kleinräumige Analyse der Bevölkerungsstruktur exemplifizieren.
Diese Arbeit wird mit einer Diskussion über den praktischen Nutzen von sozialökologischen
Analysen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft abgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Strukturmerkmale der Bevölkerung
- Die demographischen Merkmale
- Die rassischen und ethnisch-kulturellen Merkmale
- Exkurs: Das Phänomen der Segregation
- Sozio-ökonomische Merkmale
- Die Sozialökologie
- Die Entstehung und Entwicklung der Sozialökologie
- Die Forschungsrichtungen der Sozialökologie
- Die klassische Sozialökologie
- Der ökologische Aspekt der klassischen Sozialökologie
- Der soziale Aspekt der klassischen Sozialökologie
- Stadt- und Stadtstrukturmodelle
- Das Modell der konzentrischen Zonen Burgess (1925).
- Das Sektorenmodell von Hoyt (1939).
- Das Mehrkerne-Modell von Harris und Ullman (1945).
- Die neo-klassische Sozialökologie
- Die Sozialraumanalyse von Shevky und Bell (1955)
- Der theoretische Hintergrund der Sozialraumanalyse
- Die Dimensionen der Sozialraumanalyse.
- Anwendungsbeispiel zur kleinräumigen Analyse der Bevölkerungsstruktur
- Die Faktorialökologie
- Die Faktorenanalyse
- Eine allgemeine Einführung.
- Die Faktorenanalyse in der Sozialgeographie
- Anwendungsbeispiel zur kleinräumigen Analyse der Bevölkerungsstruktur
- Die Faktorialökologie aus einer kritischen Perspektive
- Das erste Problemkomplex: Die Datengrundlage
- Das zweite Problemkomplex: Die Ausgangsvariablen
- Das dritte Problemkomplex: Die Methodik und technische Verfahren
- Das vierte Problemkomplex: Die Etikettierung und Interpretation
- Der praktische Nutzen von faktorialökologischen Untersuchungen
- Die Faktorenanalyse
- Die klassische Sozialökologie
- Zusammenfassendes Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, theoretische und praktische Ansätze der Sozialökologie vorzustellen und zu demonstrieren, wie diese Ansätze zur Analyse der Bevölkerungsstruktur in einem kleinräumigen Rahmen genutzt werden können.
- Entwicklung der Sozialökologie
- Anwendung der Sozialökologie zur Analyse der Bevölkerungsstruktur
- Kritik der Sozialraumanalyse und der Faktorialökologie
- Praktischer Nutzen sozialökologischer Analysen
- Bedeutung der Strukturmerkmale der Bevölkerung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der sozialräumlichen Gliederung von Städten ein und erläutert das Ziel der Arbeit, die sozialökologische Analyse der Bevölkerungsstruktur vorzustellen.
Kapitel 2 beschreibt die Strukturmerkmale der Bevölkerung, die für die Analyse der sozialräumlichen Gliederung relevant sind. Dazu gehören demographische, rassische, ethnisch-kulturelle und sozio-ökonomische Merkmale.
Kapitel 3 stellt die Sozialökologie vor, beginnend mit ihrer Entstehung und Entwicklung, und beleuchtet verschiedene Forschungsrichtungen. Die klassische Sozialökologie wird mit ihren ökologischen und sozialen Aspekten sowie den Stadtmodellen von Burgess, Hoyt und Harris und Ullman vorgestellt. Ein Schwerpunkt liegt auf der kritischen Erörterung der Sozialraumanalyse und der Faktorialökologie. Anhand von empirischen Untersuchungen in Hamburg (1977) und München (1993) wird die Anwendung dieser Ansätze zur kleinräumigen Analyse der Bevölkerungsstruktur verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Sozialökologie, Bevölkerungsstruktur, sozialräumliche Segregation, Stadtentwicklung, Sozialraumanalyse, Faktorialökologie, demographische Merkmale, rassische und ethnisch-kulturelle Merkmale, sozio-ökonomische Merkmale, klassische Sozialökologie, neo-klassische Sozialökologie, Stadtmodelle, empirische Untersuchungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist sozialräumliche Segregation?
Segregation bezeichnet die räumliche Trennung von Bevölkerungsgruppen innerhalb einer Stadt nach Merkmalen wie Einkommen, Ethnizität oder Lebensphase.
Welche Ansätze bietet die Sozialökologie zur Stadtuntersuchung?
Die Sozialökologie nutzt Ansätze wie die Sozialraumanalyse und die Faktorialökologie, um die Bevölkerungsstruktur in einem kleinräumigen Rahmen zu analysieren.
Welche Stadtstrukturmodelle sind klassisch bekannt?
Bekannte Modelle sind das konzentrische Zonenmodell von Burgess, das Sektorenmodell von Hoyt und das Mehrkerne-Modell von Harris und Ullman.
Was ist das Ziel der Faktorialökologie?
Sie nutzt die Faktorenanalyse, um aus einer Vielzahl von Variablen grundlegende Dimensionen (Faktoren) der städtischen Differenzierung zu identifizieren.
Welchen praktischen Nutzen haben diese Analysen?
Sozialökologische Analysen dienen Politik und Stadtplanung als Grundlage, um soziale Brennpunkte zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Stadtentwicklung zu planen.
- Quote paper
- Ender Erat (Author), 2003, Sozialräumliche Segregation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13240